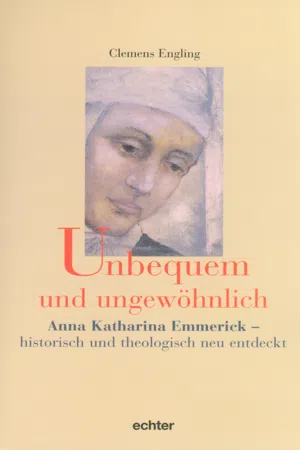![]()
Erster Hauptteil:
Anna Katharina Emmerick
(1774 – 1824)
Ihr Leben im historischen Kontext
![]()
»Der Historiker ist ein rückwärts gekehrter Prophet.«
Friedrich Schlegel
1. Kriterien der Erforschung
Zu Beginn meines Versuches, die Biographie Anna Katharina Emmericks aus den historischen Quellen1 neu zu lesen und zu schreiben, möchte ich Kriterien nennen, die mich von der bisherigen hagiographischen Betrachtungsweise unterscheiden, aber auch Gesichtspunkte, die mich leiten, wie sie z. T. schon in der Einleitung anklangen.
Zunächst möchte ich einschränkend feststellen: Ich schreibe keine historisch-kritische Biographie2. Das scheint mir bei Anna Katharina Emmerick deswegen nicht erforderlich, weil das reichlich vorhandene historische Material mir genügend erforscht erscheint. Die Art, wie es vorgelegt wurde, scheint mir das Problem zu sein. – Vielleicht muss ich vorsichtiger formulieren, wie es schon mehrfach in der Einleitung anklang: Die Darbietung der bisherigen Biographien ist sehr zeitbezogen, ja einem nicht unbekannten hagiographischen Stil verhaftet3, sodass von mir das verlangt ist, für den Beginn des 21. Jahrhunderts Anna Katharina Emmericks Leben, Leiden und Wirken neu zu entdecken und kritisch zu würdigen.
Drei Biographien sind zu nennen, die jeweils zu ihrer Zeit eine große Bedeutung bei aller Einseitigkeit hatten: A) K. E. Schmöger, Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Erster Band: Vom Jahre 1774–1819, Freiburg 1867. – Zweiter Band: Letzte Lebensjahre und Tod, Freiburg 1870. – B) Th. Wegener, Das Leben der Anna Katharina Emmerick, Stein am Rhein 1990.4 C) H. J. Seller, I. Dietz, Im Banne des Kreuzes. Lebensbild der stigmatisierten Augustinerin A. K. Emmerick, Aschaffenburg 1974. – Im Unterschied zu Schmöger und Wegener nehmen der Verfasser P. Seller und der Herausgeber P. Dietz schon eine kritische Haltung gegenüber Brentano ein. Doch darf die von Clemens Brentano verfasste »Einleitung und Lebensumriss der Anna Katharina Emmerich«6, die er 1834 seinem einzigen von ihm selbst herausgegebenen Emmerick-Buch voranstellt, als erste und eher nüchterne Darstellung des Lebens, Wirkens, Leidens und Sterbens Anna Katharina Emmericks hervorgehoben werden. Schließlich ist Brentano ein Erstzeuge neben Dr. Wesener und vielen anderen.7
Nicht erwähnt werden in diesem kurzen Überblick unzählige Arbeiten im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts. Nur kurz nennen möchte ich die theologische Diplomarbeit der in Dülmen geborenen Franzis Kettelake, Anna Katharina Emmerick, Ein Leben aus dem Glauben, Dülmen 1985, die als kurze Darstellung in Dülmen und außerhalb auf lebhaftes Interesse stieß. Franzis Kettelake hatte im mündlichen Gespräch zu Recht formuliert: »Diese Frau fasziniert mich!«
Leider liegt die von P. J. Adam für den Seligsprechungsprozess innerhalb der »Positio super virtutibus« (Vorlage über die Tugenden)8 neu gefasste Biographie der Emmerick nur in französischer Sprache und in Deutschland nicht allgemein greifbar vor. Viele einschlägige Abschnitte der Positio sind noch von P. Adam selbst redigiert in den Emmerickblättern erschienen.9
Bei der folgenden Darlegung des Lebens, Leidens und Sterbens Anna Katharina Emmericks, sowie ihrer auf den ersten Blick sehr ungewöhnlichen Phänomene: Stigmatisation, Nahrungslosigkeit, Fähigkeit zu außergewöhnlicher Menschenkenntnis, zu Vision, ja Prophetie und Erkenntnis von Reliquien und geweihten Gegenständen, soll mich an erster Stelle Nüchternheit und Liebe zum historischen Detail leiten.
Wie in der Einleitung aufgezeigt, sind in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren, vor allem in den drei Symposien, neue Erkenntnisse, ja eine ganz neue Sichtweise der Mystikerin des Münsterlandes gefasst worden, die mir für meine Interpretation eine ganz große Hilfe bedeuten.
Ich möchte sehr viel stärker als die bisherigen Biographien auf die jeweiligen historischen Zeitumstände eingehen; Anna Katharina Emmerick eingebettet sehen in das Zeugnis vieler Zeitgenossen, die z. T. besser erforscht sind als sie selbst; ich nenne als Beispiele nur Clemens Brentano, Melchior von Diepenbrock und Johann Michael Sailer.
Gerade die außergewöhnlichen Phänomene, die in den oben genannten Biographien z. T. als übernatürliche Wunder erklärt werden, sind noch zu wenig erforscht.10 Es wird auch gerade nach der Seligsprechung die Aufgabe von Psychologen, Parapsychologen, aber auch Theologen und Erforschern der Frauenmystik sowie von Historikern und Germanisten sein, hier weiteres Licht in die geheimnisvollen Tiefen der Persönlichkeit Anna Katharina Emmericks zu bringen11, die aber wohl immer rätselhaft bleiben wird.12
2. Geburt und Kindheit. Die Eltern. Das soziale und religiöse Umfeld
Die Lebenszeit Anna Katharina Emmericks von 1774–1824 fällt fast symbolisch in eine Umbruchszeit, eine sog. Schwellenzeit13 politischer, wirtschaftlicher, vor allem auch religiös-geistiger Art. Die »Epochenschwelle um 1800«14 lässt die Auswirkungen der Französischen Revolution und das Wirken Napoleons in Deutschland erst voll spürbar werden.
Der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 ordnet die politischen Verhältnisse in Deutschland neu. Vor allem die geistlichen Herrschaften, so auch das Fürstbistum Münster, finden ihr Ende. Doch zur Zeit der Geburt Anna Katharina Emmericks ist es noch nicht soweit.
Anna Katharina Emmerick wurde am 8. September 1774 in der Bauerschaft Flamschen, drei Kilometer südwestlich von Coesfeld, einer Kreisstadt des Westmünsterlandes, geboren. Coesfeld hat im Jahre 1795 2061 Einwohner. Münster war mit 17500 Bewohnern die weitaus größte Stadt im sog. Oberstift des Fürstbistums, das einen großen Teil des heutigen Westfalens umfasste.15 »Das Fürstbistum Münster stellte das ausgedehnteste geistliche Territorium des Alten Reiches dar.«16
»Münster und das Münsterland gelten als urkatholisch, Konfession und landschaftlicher Charakter als seit undenkbaren Zeiten miteinander verwoben … eine letzte Bastion ungebrochener Katholizität angesichts einer in Norddeutschland beherrschend gewordenen Stellung der lutherischen und deutsch-reformierten Kirchentümer.«17
Die Gründe für eine solch starke Identifizierung der Menschen mit der katholischen Religion, die der Kirchengeschichtler Andreas Holzem als »Sonderfall« bezeichnet, liegen in der Übereinstimmung von geistlicher und weltlicher Herrschaft der Fürstbischöfe zwischen 1500 und 1800, die in den meisten deutschen Fürstentümern kaum übereinstimmten.18
Dabei gehörte das Fürstbistum Münster eher zu den dünn besiedelten Regionen Westfalens. Etwa 76 Prozent der Menschen lebten auf dem Land. »Ein gewisses Maß an Rückständigkeit« habe »tatsächlich zum absichtsvoll gehüteten Wesen geistlicher Territorien« gehört, so Holzem in der Bistumsgeschichte.19 – Viele Kleinstädte, so Coesfeld und Dülmen, unterschieden sich nicht von großen Dörfern (Ackerbürgerlandwirtschaft, wenig differenziertes Handwerk).20
Für Coesfeld kann die Reisebeschreibung des emigrierten Domherrn Baston »Coesfeld um 1800 – Erinnerungen des Abbé Baston«21 ein sehr anschauliches Bild über die näheren Sitten und Gebräuche und Lebensumstände geben, ein seltener Glücksfall von erlebter Geschichte aus dem Blickfang eines Ausländers. Abbé Baston schreibt in einem Kapitel über »Einfachheit und Armut in Coesfeld«: »Coesfeld ist eine arme Stadt. Wenn es ein Dutzend wohlhabender Familien in seinen Mauern hat, ist es viel. Und diesen kommt der Begriff ›wohlhabend‹ nur vergleichsweise zu. Die Ausstattung der besten Häuser ist unbeschreiblich erbärmlich. Kaum kennt man den Luxus eines Sessels, der dem verwöhnten Geschmack mehr als einfaches Stroh zum Sitzen bietet.«
Baston betont, dass er diese »achtbare Einfachheit« nicht »bekrittele«; er schätze sie mehr als den »Luxus« vieler seiner eigenen Landsleute in Frankreich. »Coesfeld hat nicht den geringsten Handel«. Jeder sei Kaufmann in seiner eigenen Weise. Puder müsse aus Münster besorgt werden; stattdessen nehme man Kartoffelstärke; »parfümierten Puder«, kenne man schon gar nicht. Baston schließt den kleinen Abschnitt: »Gebe Gott, dass die Coesfe...