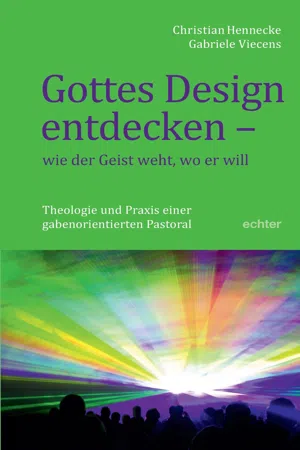![]()
I. Entdeckungen und Herausforderungen
1. Gabenorientierung schillert – Zu den Ambivalenzen einer Neuentdeckung und ihrer Agenda
Was fasziniert, schillert oft in den buntesten Farben, ist verheißungsvoll. Und wie schon beschrieben gilt das auch für Charismenorientierung oder Gabenorientierung. Es weckt pastorale Fantasie, und in Zeiten, in denen ein gewachsenes System endgültig ins Wanken gerät, greift man schnell nach neuen Methoden und Rezepten. Was im besten Fall gelingen kann, ist dann eine Verlängerung der Sterbeprozesse. Das ist nur zu verständlich. Zu fragen ist aber: wer will das?
Und es ist ja klar: die Kirche befindet sich in einem epochalen Sterbeprozess, und das ist für die meisten eine Katastrophe. Denn für sie – Gemeinden, die sich engagieren, und Priester und Bischöfe, die sich sorgen – wird immer mehr deutlich, dass dieser Prozess irreversibel ist. Lange genug hat man sich bemüht, die Sterbeprozesse zu ignorieren und zu bekämpfen. Nun ergibt man sich mit wenig Hoffnung. Die Kirche wird kleiner, es gibt keine patentierten Nachfolger für das System einer Gemeindekirche. Und was erst ein europäisches Problem zu sein schien – und darin vor allem ein katholisches nördlich der Alpen –, das spüren inzwischen auch evangelische Landeskirchen. Und natürlich stemmt man sich dagegen, versucht von anderen zu lernen, findet immer wieder neue Rezepte. Und es lässt sich nicht sagen, dass man nicht alles versucht hätte. Und selbst dann, wenn Bischöfe und andere von hoffnungsvollen Aufbrüchen sprechen, hat man oft den Eindruck, sie würden es selbst nicht wirklich glauben, bestenfalls hervorsagen wollen.
Dabei wird häufig eines nicht gesehen. Dieser Sterbeprozess, der nun schon seit mehr als zwei Generationen voranschreitet, führt zwar zum Ende einer bestimmten Konfiguration der Kirche. Er betrifft dabei nicht nur Äußerlichkeiten, sondern das gesamte Grundgefüge einer vornehmlich hochinstitutionalisierten und hochprofessionalisierten (und dennoch nicht immer sehr professionellen) Kirche. Dieser Prozess führt aber zugleich auch in eine tiefgreifende Verwandlung und somit zu einer Erneuerung.
Noch besser: diese Erneuerung ist schon im Gang, seit einiger Zeit. Doch sie fällt zu wenig auf. Es scheint, als ob unsere Augen nicht sehen könnten, was schon ist. Und auch die, die von ermutigenden Aufbrüchen sprechen, tun dies häufig mit der Hoffnung auf eine neuerliche Fortführung einer nur zu gewohnten Form kirchlichen Lebens. Wenn man aber einmal unbefangen hinschaut, dann zeichnen sich Umrisse einer Erneuerung ab, die deutlich machen, dass nun auf einmal Horizonte aufreißen und ein Szenario evangelischer Freiheit sich öffnet. Eine solche Perspektive befreit aus einer unfruchtbaren Kampfdialektik gegen Formen, die einfach zu eng geworden sind und den Zeiten nicht entsprechen.
Es geht um eine Reformation10, die an Radikalität nichts zu wünschen übrig lässt. Und vor ihr kommt man leicht ins Fürchten: Geht dabei nicht unsere ganze Tradition vor die Hunde? So fürchten Traditionalisten, so fürchten aber auch jene, die nicht gänzlich vom Geist einer sehr spezifischen und damit relativen Vergangenheit (der nicht identisch ist mit dem Heiligen Geist) durchdrungen sind.11 Nein, unsere Tradition ist vielmehr neu zu durchdenken, ist vielmehr neu zu sehen, gerade auch in ihren sensibelsten Bereichen.
Und genau dahinein, in diese brodelnde Situation der Unsicherheit, fällt die Rede von der Gabenorientierung. Und während die einen sie noch als Pflaster oder neueste Beatmungsmaschine einsetzen und damit eine Antwort auf die Frage suchen, wie heute, in der Postmoderne, Ehrenamtliche zu gewinnen, zu rekrutieren oder zu werben sind, damit gewachsene und neuere Erfahrungen, Sozialformen und Projekte der Kirche weiter funktionieren können, könnte man umgekehrt anhand der Gabenorientierung auch die Reformation illustrieren, in der wir stehen. Das hat aber eine Konsequenz : es reicht dann nicht, Gaben- und Charismenorientierung irgendwie einzubauen in das Bild einer Kirche, das weithin von ihrer versorgenden Institutionalität geprägt ist – man muss dieses Bild verlassen. Und das wollen wir hier tun, in der gebotenen Kürze.12
Vielleicht wird dann deutlich, dass dabei ein faszinierendes neues Bild entsteht. Eine Kirche, die nicht mehr so sehr im Mittelpunkt steht, angstvoll um sich selbst bemüht und voller Furcht, den eigenen Ursprung zu verlieren. Das – in der Tat – wäre der Weg, sich wirklich zu verlieren. Und dann ringt man um das Amtsverständnis, um die Sakramente, um das Lehramt, um die Rolle der Laien, um die Sozialformen der Gemeinden und gerät von Unklarheit zu Unklarheit. Genau das ist zu beobachten. Und was ist, wenn man Vertrauen investiert und der Tradition und ihrer katholischen Weite mehr zutraut, als doch nur die eigene Statik zu zementieren?
Die Dynamik des Evangeliums, die in jeder Zeit immer wieder neu das Ganze des Glaubens in neues Licht rückt, führt dann auch zu einer neuen Entdeckung der eigenen Tradition. Und das kann man im Kontext der Gabenorientierung bestens illustrieren.
Kirchenentwicklung: wie Gabenorientierung über die Kirche hinauswächst
Die Ambivalenzen der Gabenorientierung lassen sich leicht illustrieren, wenn man sie zusammenbringt mit den Entwicklungsdimensionen des Kircheseins, wie sie karikierend und treffend weltkirchlich ins Gespräch gebracht werden und so einen Bewusstseinsbildungsprozess ermöglichen.13
Versorgungskirche als Versuchung
Diese erste Entwicklungsphase der Kirche zeigt eine deutliche Dominanz. Oft kommt man darauf, dass hier ein vorvatikanisches Paradigma geerdet wird. So sei es gewesen, als Priester (und die Person auf dem Podest ist ein Priester!) von oben das Volk versorgten, und dieses Volk sich versorgen ließ. Ein klares Oben – Unten. Aber es wäre zu leicht, dieses Bild in eine ungefährliche Vergangenheit zu transferieren. Drei Gründe sprechen dagegen.
Zum einen ist es unglaublich wirkmächtig. Selbst wenn diese Konstellation der Vergangenheit angehören sollte, sie ist dennoch noch sehr präsent und bildet präzise Kampfzonen und Autoritätskonflikte ab. Sie wirken unterschwellig weiter, wenn etwa Priester den ihnen anvertrauten Gläubigen verbieten wollen, sich zum Gebet zu treffen, weil sie doch alleine für Gottesdienste zuständig seien. Sie wirken nach, wo Gemein-dereferentInnen Eltern und Kindern ihre geniale Erstkommunionvorbereitung aufnötigen (und diese sie gerne aushalten oder unwillig ertragen), sie zeigen sich im massiven Misstrauen von Seiten einiger Verantwortlicher in der Kirche gegen Neuaufbrüche. Und sie sind leider auch dann im Spiel, wenn Professionalität in einer Weise in Stellung gebracht wird, die andere sofort zu Unprofessionellen macht, zu „Laien“ im abschätzigen Sinn des Wortes. Und sie zeigt sich auch dort, wo Ehrenamtlichkeit gegen „passives Christentum“ ins Spiel gebracht wird. Es ist geradezu verräterisch, wie sehr hier Hierarchien ins Spiel kommen: multitaskende Ehrenamtliche versus Sonntagskirchgänger versus Gelegenheitschristen und Ungläubige. Summa summarum: all das ist schrecklich präsent, und wie! Leider!
Zum anderen: es entspricht einem Bild der Kirche, dass diese zu einer Institution degenerieren lässt. Entscheidend ist hier die Institution. Sie besteht aus Professionellen, die für die anderen sorgen. Und das soll ewig so bleiben. Das Groteske dieses Bildes ist eindrücklich, wenn man es als Standfoto einer menschlichen Entwicklungsphase betrachtet. Natürlich ist es wichtig, dass Lebensanfänger mit allem Nötigen versorgt werden – Kleinkinder leben von ihren Eltern. Aber eben nur am Anfang. Es ist doch fatal, wenn Christen in Kirchengemeinden angesichts der Herausforderungen der heutigen Zeit nach neuen Hauptberuflichen, nach Versorgern rufen und dies als die Lösung der schwierigen Lage ansehen. Es ist paradox, weil viele doch gar nicht Anfänger im Glauben sind, sondern profilierte Christinnen und Christen, die es möglicherweise sehr viel besser könnten als die meisten Hauptberuflichen.
Aber: die Prägung funktioniert bei einigen bis heute. Und Priester und Hauptberufliche haben dafür gesorgt, sie sind häufig für diesen Zustand selbst verantwortlich. Und so sind viele Menschen aus den Kirchengemeinden gegangen, weil in ihrem Entwicklungsweg nicht Versorgung, sondern individuelle Selbstverantwortung von Anfang an eingeübt wurde – und eine solche Pastoral extrem bevormundend, wenn nicht übergriffig erscheint. Wer geblieben ist, erleidet diese präpotenten Anwandlungen und ringt um mehr Erlaubnisse zur Selbstgestaltung. Das ist keine Vergangenheit. Es hat auch damit zu tun, dass die Professionalität oder auch das Amt für sich in Anspruch nehmen, es besser zu können. Und was dabei fehlt, ist eine ermöglichende Entwicklungsperspektive. Ganz ehrlich: welcher Hauptberufliche in der Kirche, welcher Priester möchte alles dafür tun, dass das Volk Gottes über ihn hinauswächst? Die Angst ist mehr als spürbar: „Mache ich mich überflüssig?“ „Können die hohen Standards gehalten werden?“ – und mit dogmatischer Keule: „Wird das eine Kirche ohne Priester?“ Was für eine Perspektive – aber auch welche abgrundtief schlechte Theologie wird hier zur Wahrung der eigenen Position heraufbeschworen.
Und hier sind wir beim dritten Aspekt – und würdigen diesen Anfangszustand mancher Entwicklung. Denn es ist ja auch Wahres in diesem Bild. Das hat damit zu tun, dass am Anfang jeder Entwicklung die Beziehung steht. Und dass es dringend Orientierung, Inspiration und Vertrauen braucht. Und es braucht jemanden, der den Weg öffnet, ermöglicht, Räume des Ausprobierens schafft und sie schützt. Und jemand, der Potentiale hervorsagt, hervorruft oder sieht und würdigt. Das ist vornehme Aufgabe geschwisterlichen Miteinanders, die darin besteht, genau dies zu ermöglichen: einen Entwicklungsprozess zu initiieren.
Wir müssen ehrlich sein: explizit gewusst haben wir das nie. Als Priester, als Pfarrer habe ich gemacht und getan, Projekte gestartet und beendet – aber hatte ich wirklich das Wachsen der Brüder und Schwestern im Sinn? War es wirklich so klar in meiner Ausbildung, was Presbyterorum Ordinis 6 harsch formuliert: „Noch so schöne Zeremonien und noch so blühende Vereine nutzen wenig, wenn sie nicht auf die Erziehung der Menschen zu christlicher Reife hingeordnet sind.“ Nein, das habe ich nicht gelernt, jedenfalls nicht in der Ausbildung. Und ich würde sagen: nur ganz selten ist diese Perspektive einer ermöglichenden Entwicklung auch in anderen Berufsgruppen präsent. Und wo ist es Programm, dass Emanzipationsprozesse der Gläubigen angezielt werden? Ich kann es wenig beobachten.
Und damit sind wir mitten in der Diskussion um die Gabenorientierung und eine ihr entsprechende Kirchenkultur. Denn: wer sich ernsthaft mit dem Thema der Gaben und der Charismen beschäftigt, dem wird schnell deutlich, dass es nicht nur darum gehen kann, die Gläubigen zu belehren, sie zu versorgen (ob sie wollen oder nicht), sondern mit ihnen Fragende und Suchende zu sein. Vor allem gilt, was Bischof Rouet im Blick auf eine rurale Kirchenentwicklung der örtlichen Gemeinden in seinem Bistum Poitiers gesagt hat: „Wir haben sie gefirmt – glauben wir nicht, dass der Heilige Geist in ihnen wirkt?“ Dieses bestärkende Vertrauen wäre der richtige Blick. Dieser Blick, der die Potentiale und Fertigkeiten, die Kunst und Kompetenz der Schwestern und Brüder stärkt, könnte zur Freude am Wachstum beitragen. Auch wenn dann alles anders wird. Aber genau das ist doch die Freude derer, die andere inspirieren: nicht klonen, sondern freisetzen.
Umgekehrt: eine Kirche, die so stark institutionell geronnen und fixiert ist, eignet sich bestens als kindliche Projektionsfläche für Konflikte, wie sie Personen eigen ist, die nicht erwachsen werden durften. Auch das lässt sich erkennen. Aber ein weiterer Einwand ist hier einzubringen: Möglicherweise weist auch die Kritik derer, die die Kirche auf dem Markt der Weltanschauungen sehen und ihre Schwäche denunzieren, noch auf Reste institutioneller Eierschalen des Bildes einer dominierenden Versorgungsinstitution. Als ginge es darum, dass diese Institution ihre Mitglieder noch einordnen müsste. Muss sie nämlich nicht. Auch dann würde man noch von einer parallelen societas (imperfecta?) träumen oder albträumen … (was eigentlich das Gleiche ist).
Es geht um etwas anderes. Wer von den Potentialitäten und Gaben aller her denkt, der sprengt das Bild einer institutionell geschlossenen Kirche – wem Entwicklungsräume aller wichtig wären, der würde damit auch dieser Institution und ihren Profis eine andere Rolle zuschreiben. Der müsste Gemeinde, Gemeinschaft, Sendung, Gaben, Charismen und Talente neu beschreiben. Doch dazu später.
Aufgaben oder Gaben?
Kirchenentwicklung ereignet sich, hat sich ereignet, wird sich ereignen. Ob als geplanter Entwicklungsprozess oder als „normaler“ Weiterentwicklungsweg einer Kirche der Profession: in dieser nächsten Phase der Kirchenentwicklung geschieht erstmals so etwas wie „In-Dienst-Nahme“: Es gibt so viele Aufgaben, und geeignete Personen werden gesucht, diese Aufgaben durchzuführen. Klar ist, wer „schickt“: es sind die Profis, die aussuchen, schicken und machen lassen, für bestimmte Aufgaben.
Es ist eine klassische Delegationslogik. Aufträge werden übertragen, und Menschen übernehmen – auch sehr gerne – Aufgaben, die ihnen zugetraut oder zugemutet werden. Und man kann ja auch vertrauen, dass diejenigen, die mich anfragen, auch wirklich um meine Gaben und Talente wissen – und mich deswegen ansprechen.
Auf der einen Seite sind wir diesen Entwicklungsschritt längst gegangen – und die klassische Kultur des Ehrenamtes hat hier ihre Wurzeln. Man versteht auch, was hinter diesem Begriff steht. Es ist eine Ehre, Dienste zu tun, mit denen ich betraut, beehrt werde, eben auch gewürdigt. Eigentlich wäre es nicht meine Aufgabe, aber die Verantwortlichen teilen ihre Aufgaben mit mir – dem Laien, der Laiin. Das führt zu einer ungeheuren Erweiterung und Verlebendigung kirchlichen Lebens. Denn ja, es ist ja unmöglich, dass Hauptamtliche alle diese Dinge tun, und sie nehmen mich in ihre Aufgaben mit hinein. Und ihre umfassende Aufgabe ist die Seelsorge, an der ich nun Anteil haben darf.
Aber auch dieser Entwicklungsschritt ist notwendig, verweist er doch auf eine echte Entwicklungsmöglichkei...