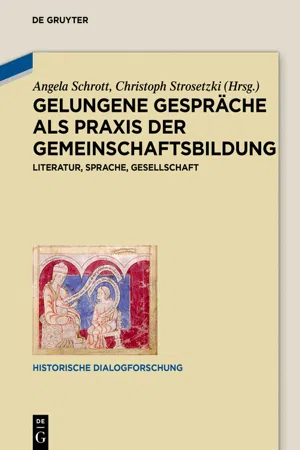
Gelungene Gespräche als Praxis der Gemeinschaftsbildung
Literatur, Sprache, Gesellschaft
- 298 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Gelungene Gespräche als Praxis der Gemeinschaftsbildung
Literatur, Sprache, Gesellschaft
Über dieses Buch
Eine grundlegende Frage der Dialogforschung ist das Gelingen von Konversation: Was versteht man in unterschiedlichen Kulturgemeinschaften, zu unterschiedlichen Zeiten unter gelingender Kommunikation? Welche Faktoren tragen zum Gelingen eines "guten" Gesprächs bei und welche Parameter erschweren die Kommunikation und bewirken, dass sich das Glück der Konversation nicht einstellt? Dabei sehen wir das "gelungene Gespräch" als ein Mittel der Gemeinschaftsbildung: Gelungene Gespräche schaffen und bestätigen Gemeinschaft, während als misslungen bewertete Gespräche eine Dialoggemeinschaft gefährden und möglicherweise zum Ausschluss von Akteuren führen. Wir behandeln diese Fragestellungen in einer dezidiert methodologischen Verschränkung von Literatur- und Sprachwissenschaft und in einer historischen Perspektive. Die diachrone Vertiefung ist notwendig, weil das Konzept der gelungenen Konversation ein kulturelles und damit historisches Konzept ist, das sich erst in der diachronen Sicht erschließt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
I Konzepte des Gelingens zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik
Konversation als Spiel: Charles Sorel vs. Grice und Gadamer
Mißverstehen (perverse interpretari, perperam intellegere) heißt, mit der Rede einen anderen als den ihr eigenen Sinn verknüpfen, sei es, daß man wegen Verwechslung eine Andeutung nicht auf das eigentlich Gemeinte (‚referend‘), sondern auf Nichtgemeintes bezieht, sei es, daß man den unausgesprochenen Bestandteil einer elliptischen Rede (ihre Voraussetzungen) falsch ergänzt.1
Sokrates: Wohin so eilig?
Fred: Zum Tennis!
Sokrates: Wo spielst Du denn?
Fred: Nun, doch natürlich in dem besten Klub der Stadt.
Sokrates: So, du weißt also, welcher der beste ist?
Fred: Natürlich.
Sokrates: Das interessiert mich. Bei so vielen Dingen habe ich vergeblich gefragt, was das ist, was etwas gut sein läßt. Ich bin glücklich, jemanden gefunden zu haben, der es weiß, wenn auch nur im Tennis. Darf ich fragen?
Fred: Bitte.
Sokrates: Sag mir, warum ist dein Klub der beste?
Fred: Weil man die besten Verbindungen bekommt.
Sokrates: Was für Verbindungen? Zum Tennisspielen?
Fred: Ach wo, halt Verbindungen.
Sokrates: Aber sage mir, gehst du nicht in den Tennisklub, um Tennis zu spielen?
Fred: O ja, das auch.
Sokrates: Nun, dann sage mir, warum dein Klub für dein Tennisspielen der beste ist. (Gadamer 2000: 227)
Verstehen [heißt] primär […] sich in der Sache verstehen, und erst sekundär, die Meinung des anderen als solche abheben und verstehen. Die erste aller hermeneutischen Bedingungen ist das Vorverständnis das im Zu-tun-haben mit der gleichen Sache entspringt. (Gadamer 2010: 299, zit. nach Wagner 2011: 145)
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Einleitung
- I Konzepte des Gelingens zwischen Literaturwissenschaft und Linguistik
- II Gespräch und Philosophie
- III Gelungene Gespräche, Gesellschaft und Gemeinschaftsbildung
- IV Gelingende Interaktion und Gender
- V Fiktionen des Gelingens