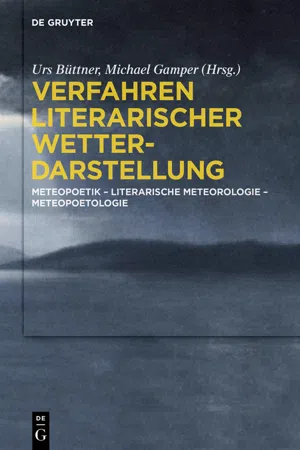
eBook - ePub
Verfahren literarischer Wetterdarstellung
Meteopoetik – Literarische Meteorologie – Meteopoetologie
- 344 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfahren literarischer Wetterdarstellung
Meteopoetik – Literarische Meteorologie – Meteopoetologie
Über dieses Buch
Der Band deckt literarische Thematisierungsweisen des Wetters auf. Diese erfüllen eine Vielzahl von Funktionen, die über reine Staffage und Effekt hinausführen. Der komparatistische Zugang entwickelt möglichst verallgemeinerbare Kategorien zu ästhetischer Praxis sowie poetologischer Reflexion und trägt den Entwicklungen in unterschiedlichen Literaturen Rechnung.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Verfahren literarischer Wetterdarstellung von Urs Büttner, Michael Gamper, Urs Büttner,Michael Gamper im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literaturkritik für Vergleichende Literaturwissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Meteorologie/Mediologie. Luft in der Lyrik des 18. Jahrhunderts
Jana Schuster
Für nichts ist der Mensch so offen wie für die Luft.
In ihr bewegt er sich noch wie Adam im Paradies,
rein und schuldlos […].1
(Elias Canetti)
Nach überstandener Gefahr wird das Atemholen zum unwahrscheinlichen Glück. Es braucht die katastrophale »Wendung der Dinge«,2 um die Atemluft, erste und »letzte Allmende«3 des Lebendigen, bewusst werden zu lassen. Als Jeronimo Rugera, durch den plötzlichen Zusammenbruch seines Gefängnisses unwillkürlich vor dem Selbstmord gerettet und aus der zertrümmerten Stadt geflüchtet, aus der »tiefsten Bewusstlosigkeit«, die ihn auf einem Hügel außerhalb überwältigt, erwacht und sich »halb auf dem Erdboden« erhebt, ergreift ihn »ein unsägliches Wonnegefühl«, da ein »Westwind, vom Meere her«, »sein wiederkehrendes Leben anweht[ ]«.4 Unversehens findet sich der Straftäter in einem postapokalyptischen Paradies wieder, einer »blühende[n] Gegend«, in der nur die »verstörten Menschenhaufen« irritieren; beim Dankesgebet, über dem »seine Stirn den Boden berührt[ ]«, dessen Erbeben ihm das schon verworfene Leben gerettet hat, »weint[ ] er vor Lust«,5 noch lebendig zu sein. Wiedervereint mit der totgeglaubten Geliebten und dem gemeinsamen Kind wähnt er sich im »Tal von Eden« und genießt eine Nacht »voll wundermilden Duftes, so silberglänzend und still, wie nur ein Dichter davon träumen mag«6 – es sind die von der empfindsamen Idylle des 18. Jahrhunderts fortgeführten Topoi bukolisch-lieblicher und biblisch-paradiesischer Natur, die sich als trügerisch-traumartiges Intermezzo in das zweifache Katastrophenszenario von Kleists Erstlingsnovelle Das Erdbeben in Chili (1806/10)7 einschieben und den lapsarischen Riss vorübergehend schließen. Ein frischer Luftzug eröffnet dieses idyllische Mittelstück in Kleists Triptychon, während in der Stadt »alles, was Leben atmet[ ]«,8 unter Trümmern begraben wird. Der laue Westwind, der mythische Zephyros, der mit jedem neuen Frühling den ewigen Frühling des Goldenen Zeitalters aufleben lässt, kommt für Kleists Überlebenden dem göttlichen Odem gleich, der im ersten Schöpfungsbericht der Genesis אָדָם ’ādām, dem Menschen aus dem Staub der Erde (אֲדָמָה ’ădāmāh), den Atem des Lebens einhaucht. Im Westwind umweht die gefallene Kreatur noch ein Zug des Paradieses9 – so will es die Idylle und so will es das »Ur-Vorurteil«10 von der fraglosen Zuträglichkeit der Lebensgrundlage Luft.
Luftwissen der Lyrik
Als allgegenwärtige, notorisch schwer fassbare »hyperobjects«11 haben die globale Atmosphäre und die in dieser atembare Luft auch in der kulturwissenschaftlichen Klimatologie derzeit Hochkonjunktur:12 Die anthropogene Klimaerwärmung im Anthropozän rückt die Luft ins Zentrum eines neuen Fragehorizonts nach der historischen Tiefenzeit des kulturellen ›Stoffwechsels‹,13 den Gesellschaften mit ihrer planetarischen Lebensgrundlage unterhalten.14 Die Literaturwissenschaft kann in diesem Kontext epochen- und gattungsspezifische ästhetische Ausgestaltungen und poetologische Funktionen kulturellen Luftwissens aufzeigen,15 das in der per definitionem sanglichen Lyrik jeweils zu einem disziplinären Spezialwissen um Praktiken von Atem, Stimme, Rhythmus und Klang in produktivem Bezug steht. In der deutschsprachigen Literatur kommt hier dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle zu: Bei Barthold Heinrich Brockes konstituiert sich eine aus funktionalen Kontexten zunehmend gelöste, empirisch fundierte Naturdichtung, die auch die flüchtige Luft zum Gegenstand einer – die antike Elementenlehre, die Alchimie und die neuzeitliche Chemie der Gase integrierenden – Wissenspoetik macht. Empirisch neu gegründet sind Luft, Wind und Hauch damit auch als topische Elemente des locus amoenus,16 den im 18. Jahrhundert die Anakreontik, die Landlebendichtung und die empfindsame Idylle vielfach variieren. Albrecht von Haller und Ewald von Kleist sprechen der durchsichtigen, hör- und spürbaren Luft in ihren Langgedichten Die Alpen (1729/31) und Der Frühling (1749/56) von der Landschaftsmalerei inspirierte ästhetische Qualitäten zu und differenzieren die semantischen Valenzen der vormals topisch-formelhaften Bezeichnung von Phänomenen und Sensationen der Luft, des Windes und auch des etymologisch von diesem abgeleiteten Wetters17 entschieden aus. Klopstocks freirhythmische Hymnik eröffnet diesem lyrischen Diskurs neue poetologische Dimensionen, die Goethes Sturm-und-Drang-Hymnen und Hölderlins Oden weiter ausschöpfen werden. So lässt sich ein lyrisches Gattungswissen der Luft im 18. Jahrhundert an vier epochenspezifischen Genres profilieren: am Lehrgedicht und an dem ›naturbeschreibenden‹ Gedicht18 des Brockes, die zeitgenössische Luftlehren erläutern bzw. dramatisch ausgestalten, an der Ode bzw. Hymne Klopstocks, die die (göttlich durchwirkte) Luft als elevatorisches Medium inszeniert, und an der prosalyrischen Idylle Geßners, deren empfindsame Sensitivität die Luft als sinnliches Milieu des Lebendigen erschließt und subtil erotisiert. Wie zu zeigen sein wird, lassen sich diese verschiedenen generischen Formen lyrischen Luftwissens entlang ihrer jeweiligen Ausgestaltung des Luft- und des Gewittermotivs mit den von Michael Gamper und Urs Büttner vorgeschlagenen Kategorien korrelieren: Brockes’ Gewitterbeschreibung mit einer (vorwiegend an der Darstellung atmosphärischer Phänomene selbst interessierten) ›Literarischen Meteorologie‹, Klopstocks Gewitterhymne mit einer (am meteorologischen Gegenstand genuin poetische Potentiale erprobenden) ›Meteopoetologie‹ und Geßners Idylle mit einer anthropologisch grundierten ›Meteopoetik‹ bzw. poetischen ›Meteo-Anthropologie‹,19 die menschliches Leben und Lieben von sensitiven Sphären her denkt und poetisch in Szene setzt. Epistemologisch relevante Beiträge zu einem nicht auf die neuzeitlich-moderne Naturwissenschaft reduzierten Luft- und Wetterwissen leisten aber alle diese Texte gerade in ihrer virtuosen sprachästhetischen Gestaltung.
Der literarischen Darstellung von Wetterereignissen und Witterungsverhältnissen noch vorgelagert, konturiert sich ›Meteorologie‹ hier im ursprünglichen, umfassenden Wortsinn als systematische Aufmerksamkeit für das ›In-der-Luft-Schwebende‹20 und auf die Sphäre, Phänomenalität und Dynamik der Luft selbst, die unter dem neuen empirischen Fokus aufklärerischer Naturdichtung als elementares Medium aisthetischer Wahrnehmung begreifbar wird und damit zugleich die poetologische Reflexion auf die von der Luft getragene phonetisch-rhythmische Akustik befördert. In diesem doppelten Sinn werden die Luft und das Meteorisch-Schwebende in der Lyrik des 18. Jahrhunderts zum Gegenstand einer immanenten aisthesiologischen und poetologischen Mediologie, die entlang ihrer genrespezifischen Varianten zu einer Ontologie des ›In-der-Luft-Seins‹21 beitragen kann. Eine solche hat Joseph Vogl für das meteorologische Wissen um 1800,22 Stephan Gregory für Ästhetik und Darstellungspraxis der Malerei schon des Cinquecento dargelegt.23 Die von Gregory geforderte »Genealogie der Wahrnehmung von Luft und Atmosphäre«24 führte transdisziplinär und transmedial durch Mythologie, antike Naturphilosophie, Medizin, Theologie, Alchimie, die neuzeitliche Wissenschaftsgeschichte und die gattungs- und genrespezifischen literarischen, bildkünstlerischen, musikalischen und theatralen Ausgestaltungen eines im umfassenden Sinn zu verstehenden Luftwissens. Peter Sloterdijk, der 2002 im Rahmen seines Sphären-Projekts das Luftdenken des 20. Jahrhunderts exponiert und damit die kult...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Meteopoetik – Literarische Meteorologie – Meteopoetologie. Eine kritische Verhältnisbestimmung
- Shakespeares Meteopoetik
- Meteorologie/Mediologie. Luft in der Lyrik des 18. Jahrhunderts
- »Ahndungsvolle Beleuchtung«. Funktionen des Wetters in Goethes Herrmann und Dorothea
- Realismus und die Banalität des Wetters
- Produktive Verwandlungen. Meteorologische Störung bei Stifter, Vischer und Benjamin
- Oden an das Ozon. Spott und Spekulation über den ›potenzierten Sauerstoff‹ in satirischer Dichtung des Viktorianischen Zeitalters
- Menschen im Nebel. Ein Beitrag zur Meteopoetik des Unheimlichen
- Zeitenwandel und Wetterwechsel. Ein Streifzug durch Virginia Woolfs Meteopoetologie
- El cuento que se llevó el viento?! El (real) maravilloso, das Erzählen und der Wind bei Cristóbal Colón, Juan Rulfo und Gabriel García Márquez
- »aus-/gewirbelt«. Meteopoetologie des Schnees in Celans Lyrik
- »And so I long for snow«. W. G. Sebalds Poetik des Schnees
- Die Stadt und ihr Wetter. Eckpunkte zu einer Geschichte der urbanen Meteopoetologie
- Künstliche Blitze und Metaschnee. Wetterphänomene zwischen Natur, Kunst und Technik in der Lyrik Ben Lerners
- Of Clouds and Cox. Zur Politik der Übertragung in Christoph Ransmayrs Cox oder Der Lauf der Zeit
- Übers Wetter reden. Roland Barthes über Klima, Alltäglichkeit, Seinsgefühl und Poetik
- Register