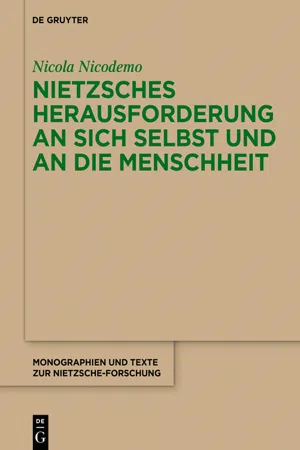Schaffen: das ist die grosse Erlösung vom Leiden und des Lebens Leichtwerden (Z, KSA 4.110)
Wer nicht lügen kann, weiss nicht, was Wahrheit ist (Z, KSA 4.361)
10.1 Der Anspruch auf Selbstverwirklichung
Mit MA, M und FW hat Nietzsche die Hauptfragen seiner Philosophie aufgeworfen und sich zum Ziel gesetzt, Philosoph des Lebens zu werden. Er hat den Menschen und die tradierten Wertschätzungen von verschiedenen Standpunkten aus hinterfragt und ihren nicht metaphysischen, sondern historischen, psychologischen und triebhaften Ursprung kenntlich gemacht. Am Ende seiner Freigeisterei erlebt Nietzsche das ungeheure Ereignis Europas und der Menschheit im Allgemeinen: den Tod Gottes. Seine neue Aufgabe zeichnet sich im 7. Aphorismus von FW ab: die Notwendigkeit der Erforschung der „Existenz-Bedingungen“ und ein jahrhundertelanges Experiment, „ob die Wissenschaft im Stande sei, Ziele des Handelns zu geben, nachdem sie bewiesen hat, dass sie solche nehmen und vernichten kann“ (FW, KSA 3.379).
Dass es aber keine ewigen, absoluten Werte gibt und jede Teleologie hinfällig geworden ist, heißt nicht, dass die Menschheit zugrunde ginge. Nach Nietzsche ist dies für den Menschen vielmehr ein guter Grund, um seine Kräfte, Erkenntnisse, Gefühle und Ansprüche auf Autonomie auf die Probe zu stellen. Seine Antwort ist, das Leben als Mittel zur Erkenntnis einzusetzen, mit der Absicht, ein experimentelles Leben zu führen, in dem die Kunst die entscheidende Rolle als verklärende Kraft spielt. Da die Menschheit nicht von Gott, sondern von sich selbst gesteuert wird, lässt sich, wie zu Beginn von Teil II erörtert, die historische Frage nach der unmetaphysischen Gesinnung der Menschheit stellen: „wie wird sich dann die menschliche Gesellschaft, unter dem Einfluss einer solchen Gesinnung, gestalten?“ (MA, KSA 2.42) Die Antwort auf diese Frage besteht nach Nietzsche in der neuen Aufgabe der größten Geister des nächsten Jahrhunderts. Sie sollen eine grundlegende Kenntnis der Bedingungen der Kultur als wissenschaftlichen Maßstab für ökumenische Ziele ermitteln. Nietzsche will nicht bloß die Bedingungen der Kultur, sondern diejenigen Existenzbedingungen feststellen, die eine höhere Kultur ermöglichen. Zu diesen Existenzbedingungen gehört die unlogische Grundstellung des Menschen zu allen Dingen, der Irrtum, das Lügen mitsamt dem Wissen um die Notwendigkeit des Lügens für das Leben, der Erkenntnistrieb bzw. die Leidenschaft der Erkenntnis, der schöpferische Trieb bzw. die schöpferische Kraft, die Kunst bzw. die Verklärung, die dichtende Vernunft und die experimentelle Haltung des Menschen zum Leben. Letztlich erweist sich der Mensch als „künstlerisch schaffendes Subjekt“ (WL, KSA 1.883), das Werte zu seiner Selbsterhaltung und Selbstüberwindung schafft und schaffen muss. Er ist „der Messende“ (WS, KSA 2.554), weil er das Maß und das Messen entdeckt hat und zwangsläufig benötigt, um seinem Leben einen Wert zu verleihen und es so lebenswert erscheinen zu lassen. Damit er sich aber der Aufgabe widmen kann, „die Gesetze des Lebens und Handelns neu auf[zu]bauen“, muss er ein experimentelles Leben führen. Der Mensch muss Ernüchterung erleben und versuchsweise mit den Dingen verfahren, um sich, auf seine echten Bedürfnisse zurückbesinnend, einen neuen Horizont schaffen zu können. Er muss daher zunächst seine Kraft auf sich als Kunstwerk verwenden, um sich selbst zu beherrschen und Herr in seiner eigenen Werkstatt zu werden. Der Mensch strebt nach seiner Selbstverwirklichung. Er will der werden, der er ist, der Einmalige, der Unvergleichbare, der Sich-selber-Gesetzgebende, Sich-selber-Schaffende (FW, KSA 3.563). Dies können aber nach Nietzsche die allerwenigsten. Genau deswegen ist Z „ein Buch für Alle und Keinen“. In ihm macht Nietzsche die Bedingungen der Selbstverwirklichung ausfindig.
In Kontinuität mit der in FW 335 erhobenen Forderung, „beschränken wir uns also auf die Reinigung unserer Meinungen und Werthschätzungen und auf die Schöpfung neuer eigener Gütertafeln“ (FW, KSA 3.563), geht es auch in Z darum, alte Tafel zu zerbrechen und neue zu schaffen, wie auch am längsten Abschnitt „Von neuen und alten Tafeln“ deutlich wird. Nietzsche bringt sein neues Lebensbild durch einen Dichter, durch Zarathustra zum Ausdruck und stellt, statt weitere Fragen aufzuwerfen, in dieser Schrift seine Hauptgedanken vor: den Willen zur Macht, den Übermenschen, die ewige Wiederkehr des Gleichen und die große bzw. kleine Vernunft des Leibes. Damit liefert er uns neue Anhaltspunkte, die dem Menschen bei einer Um- und Neuorientierung vor dem neuen, unmetaphysischen Lebenshorizont dienen. Z ist also kein Buch mehr über „die ästhetische Wissenschaft“ (GT, KSA 1.25), wie sich noch von GT behaupten lässt, sondern ein Kunstwerk. Nietzsche versucht hier, die bisher von ihm gefundenen Lebensbedingungen in einem einheitlichen Sinnbild zusammenzuführen. Obgleich er von der Verklärungskraft der Kunst überzeugt ist, zielt er nicht mehr auf eine metaphysische Rechtfertigung der Welt und des Daseins, sondern auf die in FW gestellte Aufgabe, „das Wissen sich einzuverleiben und instinctiv zu machen“ (FW, KSA 3.383), es zu verwirklichen. Aus diesem Grund sucht man in Z vergeblich nach einem Konzept oder einer neuen Formulierung der Aufgabe. Zu Beginn und am Ende des vierten und letzten Buchs und damit am Ende der ganzen Schrift sagt Zarathustra: „Mein Leid und mein Mitleiden – was liegt daran! Trachte ich denn nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!“ (Z, KSA 4.408) In dieser aussagekräftigen Behauptung, die zugleich Nietzsches neuen philosophischen Anspruch beinhaltet, ertönt die von ihm bereits in der Zeit von Fatum und Geschichte gespürte Tragik des Schaffens: „o, niederreißen ist leicht, aber aufbauen!“ (KGW I 2.433) und die existentielle Herausforderung der Aufgabe: „Ein solcher Versuch ist nicht das Werk einiger Wochen, sondern eines Lebens.“ (KGW I 2.431 f.) Nietzsche zielt auf tatsächliche Wirkung ab, er will die Wirkung am Menschen. Er macht daher mit Z den ersten Schritt zur Verwirklichung seiner ab JGB benannten Aufgabe einer „Umwerthung der Werthe“. Zu diesem Zweck geht er der Sinnfrage, der Rolle des Leibes und der Bedeutung der Kunst in der Erkenntnis nach, wie sich im Folgenden zeigen wird.
10.2 Der Tod Gottes und der Sinn des Lebens
Das in FW angekündigte „ungeheure Ereigniss“ (FW, KSA 3.481), der Tod Gottes, klingt auch in Z durch. Bereits zu Beginn seines ersten „Untergangs“ wundert sich Zarathustra, dass der alte Heilige „in seinem Walde noch Nichts davon gehört hat, dass Gott todt ist!“ (Z, KSA 4.14) Für Zarathustra aber lebt der alte Gott nicht mehr: „der ist gründlich todt“ (Z, KSA 4.326). Wie kann man aber einen Gott töten? Indem man nicht mehr an ihn glaubt oder denkt. Gott ist eine Mutmaßung, ein Gedanke, eine nicht mehr gültige und inzwischen unverbindliche Wahrheit wie, nach der prägnanten Wendung von WL, „eine Metapher, die abgenutzt und sinnlich, kraftlos geworden ist“. Wenn es aber keinen Gott mehr gibt, „wer tränke alle Qual dieser Muthmaassung, ohne zu sterben? Soll dem Schaffenden sein Glaube genommen sein und dem Adler sein Schweben in Adler-Fernen?“ (Z, KSA 4.110) Der Schaffende ist, wie Nietzsche immer wieder deutlich gemacht hat, von der Gefahr bedroht, zugrunde zugehen. Ein gottloses Leben ist außerdem gefährlich und sinnbedürftig. In „Von tausend und Einem Ziele“ stellt Zarathustra fest: „Tausend Ziele gab es bisher, denn tausend Völker gab es. Nur die Fessel der tausend Nacken fehlt noch, es fehlt das Eine Ziel. Noch hat die Menschheit kein Ziel.“ (Z, KSA 4.76) Zarathustra will aber der Menschheit ein Ziel geben. Er ist der Bahnbrecher einer neuen Zeit: „Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze.“ (Z, KSA 4.19) In einer unmetaphysischen, gottlosen Welt geht es nicht mehr um Sinnfindung, sondern um Sinnerfindung. Hinsichtlich dieses Paradigmenwechsels und in Bezug auf die philosophische Tradition sagt Zarathustra: „Unheimlich ist das menschliche Dasein und immer noch ohne Sinn: ein Possenreisser kann ihm zum Verhängniss werden. Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren: welcher ist der Übermensch, der Blitz aus der dunklen Wolke Mensch.“ (Z, KSA 4.23) „Der Übermensch ist der Sinn der Erde.“ (Z, KSA 4.14) Deswegen fragt Zarathustra seine Brüder: „Könntet ihr einen Gott schaffen? […] Könntet ihr einen Gott denken?“ (Z, KSA 4.109) Diese Fragen sind rhetorisch. Statt einer Antwort seiner „Brüder“ findet man Forderungen Zarathustras: „aber ich will, dass euer Muthmaassen nicht weiter reiche, als euer schaffender Wille. […] Aber ich will, dass euer Muthmaassen begrenzt sei in der Denkbarkeit.“ Zarathustra fordert auch den „Wille zur Zeugung“.
Trotz der Aufforderung Zarathustras vermag der Mensch es noch nicht, Gott oder Übermensch zu schaffen oder selbst zu sein. Er könnte sich jedoch selbst zum Vater und Vorfahren des Übermenschen wandeln. Er sollte daher seine eigenen „Sinne zu Ende denken“, so „dass Alles verwandelt werde in Menschen — Denkbares, Menschen — Sichtbares, Menschen — Fühlbares!“ (Z, KSA 4.110) In einem nachgelassenen Fragment notiert Nietzsche: „Wer das Große nicht mehr in Gott findet, findet es überhaupt nicht mehr — er muß es leugnen oder schaffen.“ (NL 1[86], KSA 10.194) Das lässt sich mit Zarathustras Aussage verbinden: „Wenig begreift das Volk das Grosse, das ist: das Schaffende.“ (Z, KSA 4.65) Was der Mensch Welt nannte, das soll erst von ihm geschaffen werden: seine Vernunft, sein Bild, sein Wille, seine Liebe (vgl. Z, KSA 4.110).
Wie lässt sich nach dem Tod Gottes die Zukunft denken? Wie kann man der Menschheit neue Ziele setzen? Der Tod Gottes ist eng mit der Sinnfrage verbunden. Dem Leben ein Ziel und einen Sinn zu geben, heißt zugleich, die Welt neu und nach menschlichen Maßstäben schaffen. Dazu muss der Mensch seine Sinne zu Ende denken: Er muss den Leib bedenken. Er hat, im Gegensatz zu den „Hinterweltlern“, auf die Stimme des gesundes Leibes zu hören: „Redlicher redet und reiner der gesunde Leib, der vollkommne und rechtwinklige: und er redet vom Sinn der Erde“ (Z, KSA 4.38). Der Leib nimmt im Zarathustra eine Schlüsselstellung ein.
10.3 Der schaffende Leib und seine Werk- und Spielzeuge
In „Von den Verächtern des Leibes“, einer der prägnanteren und dichteren Rede von Z, wird die Idee des Leibes geschildert. Bei der Lektüre dieser Rede werden auf den ersten Blick Nietzsches Absichten deutlich, die bisher vollzogenen Gedanken über Vernunft, Bewusstsein und Unbewusstsein auf den Leib zurückzuführen, sie am und im Leib zu verankern. Der Mensch ist für Nietzsche Leib durch und durch131: „Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser – der heisst Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er.“ (Z, KSA 4.40) Damit will Nietzsche beim Denken und Handeln aber nicht die Vernunft ausschließen und verwerfen. Er will, wie gezeigt, den alten Vernunftbegriff abschaffen und einen neuen einführen. Wie Zarathustra sagt: „Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit. Und wer weiss denn, wozu dein Leib gerade deine beste Weisheit nöthig hat?“ (Z, KSA 4.40) Der Mensch ist also kein irrationales Wesen. Vielmehr ist der Leib „eine grosse Vernunft, eine Vielheit mit Einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Heerde und ein Hirt.“ (Z, KSA 4.39) Zu dieser Vielheit gehört auch die „kleine Vernunft des Leibes“, also der Geist oder das Ich: „Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du „Geist“ nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner grossen Vernunft.“ (Z, KSA 4.39) Dass Zarathustra hier von einer großen und einer kleinen Vernunft des Leibes spricht, heißt nicht, dass er damit wieder einen Leib-Seele-Dualismus einführt. Man könnte die Unterscheidung als Ausdruck oder Gleichnis verstehen, um den sich als Kampf der Triebe gegeneinander und größtenteils unbewusst abspielenden Prozess des Denkens zu erklären, den Nietzsche von MA bis FW beschreibt. Im Unterschied zu den früheren Werken wird in Z der kämpferische und mitunter zum Frieden kommende Prozess des Denkens als Kampf zwischen dem, der befiehlt, und dem, der gehorcht, geschildert. Darauf baut Nietzsche sein Konzept des Willens zur Macht und später in GM das Paradigma der Herren- und Sklavenmoral. Das Selbst und das Ich, die große und die kleine Vernunft, der Leib und der Geist oder die Seele sind nur Relationsbegriffe: Begriffe also, die ausschließlich in einem vielfältigen, wechselseitigen Zusammenhang Sinn ergeben. Was die Rolle der kleinen Vernunft in diesem Zusammenhang betrifft, bleibt sie, wie am exemplarischen Fall von M 119 erörtert, im schopenhauerschen Sinne ein Mittel der Instinkte. Neu dabei ist aber die Einsicht, dass auch der Sinn neben dem Geist ein Werkzeug der großen Vernunft des Leibes ist: „Werk- und Spielzeuge sind Sinn und Geist: hinter ihnen liegt noch das Selbst.“ (Z, KSA 4.39) Nicht zufällig betrachtet Nietzsche den Geist und die Sinne als Werk- und Spielzeuge der großen Vernunft des Leibes: Sie sind die wirksamsten Mittel, durch die der Mensch die Wahrheit oder die Illusion bilden kann, die es ihm ermöglicht, sich im Leben zu erhalten und zu steigern. Illusionen sind daher nicht nur Sinnestäuschungen, sondern auch Täuschungen der Vernunft. Gefühle und Gedanken sind auf den Leib angewiesen und dienen sogar seinen Zwecken:
Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge. „Was sind mir diese Sprünge und Flüge des Gedankens? sagt es sich. Ein Umweg zu meinem Zwecke. Ich bin das Gängelband des Ich’s und der Einbläser seiner Begriffe.“
Das Selbst sagt zum Ich: „hier fühle Schmerz!“ Und da leidet es und denkt nach, wie es nicht mehr leide – und dazu eben soll es denken.
Das Selbst sagt zum Ich: „hier fühle Lust!“ Da freut es sich und denkt nach, wie es noch oft sich freue – und dazu eben soll es denken. (Z, KSA 4.40)
Nietzsche geht also davon aus, dass das Selbst „das Gängelband des Ich’s und der Einbläser seiner Begriffe“ oder, nach M 119, „der Souffleur“ der kleinen Vernunft ist. Über seine Bemerkungen in M und FW hinaus behauptet er, dass der Geist wie auch die Wertschätzungen und Gefühle ein Produkt des Leibes sind: „Das schaffende Selbst schuf sich Achten und Verachten, es schuf sich Lust und Weh. Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine Hand seines Willens.“ (Z, KSA 4.40) Selbst wenn der Leib auch ohne Geist schöpferisch ist, kann er nicht auf den Geist verzichten, wenn er sich die Welt nach menschlichem Maßstab zurechtmachen will. Dass der Geist als „Hand des Willens“ geschaffen wird, ist der unwiderlegbare Hinweis, dass der Geist das einzige und unverzichtbare Mittel ist, das dem Leib zur Steigerung der Kräfte verhelfen und den Willen mächtiger machen kann. Nur durch den Geist vermag der Leib die Welt zu interpretieren und sie, im weitesten...