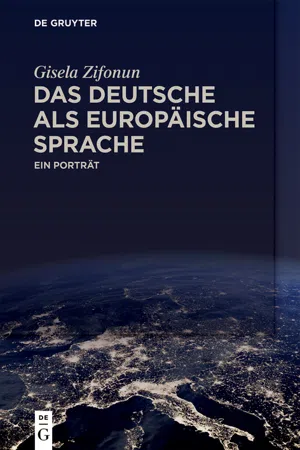Die folgenden Kapitel behandeln charakteristische, denk- und merkwürdige Eigenschaften des Deutschen. Sie beschreiben Teile eines Puzzles, die zusammengesetzt ein Bild des Deutschen ergeben. Dieses Bild ist notwendigerweise subjektiv. Nicht nur, dass diese Sprache wie jede andere so zahlreiche Facetten hat, dass kein Bild sie alle angemessen fassen könnte. Auch das Wesen dieser Sprache überhaupt ist vielseitig und je nach Blickrichtung wandelbar. Umso wichtiger ist es, bevor die eigentliche Arbeit am Bild beginnt, die Facetten, die identifiziert werden können, und die Perspektiven, die ich einnehmen werde, zu benennen und zu klären, was in das Bild eingehen wird und welche Gewichtungen vorgenommen werden sollen.
Aktuelle und virtuelle Sprache
Einmal haben wir es mit der lebendigen oder aktuellen Sprache zu tun, die sich in den selbstverständlichen Handlungen manifestiert, durch die wir uns „auf Deutsch“ verständigen. Dabei haben wir jedoch nicht nur eine flüchtige Folge von Lauten im Ohr, sondern wir registrieren und verstehen einen an diese gegliederte Lautgestalt gebundenen Inhalt. Die Lautgestalten tragen Bedeutung; Gestalt und Bedeutung sind untrennbar. Worin das Wesen sprachlicher Bedeutung besteht, darüber streiten sich die Experten. Fest steht, dass wir Bedeutungen mental, also in unserem Gehirn, gespeichert haben, in Assoziation mit jeweils bestimmten Lautfolgen. Das gilt für die Wörter, also die einzelnen Bausteine der Sprache. Satzbedeutungen dagegen sind nicht als Ganze gespeichert, ebenso wenig die Abermillionen Sätze selbst, die wir produzieren und verstehen. Vielmehr kennen wir nur die Bauanleitungen für Sätze des Deutschen – oder der anderen Sprachen, die wir beherrschen – und die mit diesen Regeln verbundenen Vorgaben für die Bedeutungen der produzierten Sätze. Bei jedem Äußerungs- oder Verstehensakt aktivieren wir diese Bau- und Interpretationsregeln.
Damit habe ich bereits die nächste Erscheinungsform von Sprache angesprochen: die virtuelle. Als solche existiert sie in Form unserer Muttersprache und der anderen Sprachen, die wir gelernt haben, in unseren Köpfen – auch ohne dass wir gerade Lautereignisse (oder Schriftsprachliches) hervorbringen oder aufnehmen. Es gibt somit sicher „eine Sprache hinter dem Sprechen“.1 Als virtuelle Sprache existiert somit das Deutsche im Kopf jedes Mitglieds dieser Sprachgemeinschaft. Auf welche Weise sie in unserem Geist oder gar in unserem Gehirn existiert, wissen wir nicht, auch wenn die Neurowissenschaften uns phantastische bunte Bilder etwa über die Aktivierung von Gehirnarealen beim Sprechen und Vernehmen von Sprache liefern können. Wo Sprachverarbeitung stattfindet und auch welche Neuronen-Milliarden bei der Sprachverarbeitung „feuern“, sagt so viel und auch so wenig über die geistige Natur der Sprache wie die Ausschüttung von Oxytocin über die psychische Natur der Liebe. Da wir aber als Sprecher des Deutschen alle (annähernd) die gleiche Sprache sprechen, ist die virtuelle Sprache auch überpersönlich. Sie ist – aus meiner Sicht – eine grundlegende Form des Gemeinguts (commons), eine Ressource, an der alle Mitglieder der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können (sollten).2 Sind dann die sprachlichen Regelsysteme in den Köpfen der Einzelnen nur Abbilder eines unbekannten kollektiven Wesens? Oder, was wahrscheinlicher erscheint, da wir ja kaum an die Existenz einer Geistsprache oder Geistersprache glauben, lernen wir voneinander, von Eltern, Geschwistern, Erziehern und im alltäglichen Austausch mit anderen überhaupt, die Regeln unserer Sprache? So wie wir auch die anderen Regeln unseres sozialen Lebens lernen? Sie existieren zwischen uns und gleichzeitig durch und in uns.
Sprache ist darüber hinaus nicht nur Wortschatz und Regelsystem, also Grammatik, in aktuell lebendiger und virtueller Gestalt, sondern auch individuelles Vermögen bzw. Persönlichkeitsmerkmal, soziales Kapital und historisches Erbe. Zudem steht das Deutsche als Standardsprache den Dialekten und Regiolekten gegenüber; die eine Sprache gliedert sich in zahllose regionale, aber auch funktionale Varietäten. Varietäten können sich auch vertikal unterscheiden, nach Schichten des Sprechens, von der gehobenen literarischen Rede bis zum kollegialen Umgangston am Arbeitsplatz. Und schließlich besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Deutsch, zwischen einer Unterhaltung am Mittagstisch und dem Leitartikel der ZEIT, oder auch einer Gattung wie dem Internet-Blog und einem Gedicht von Celan.
Historisches Erbe
Jede „natürliche“ Sprache entsteht, entwickelt sich und möglicherweise stirbt sie einmal. Wie viele „tote“ Sprachen – neben dem Lateinischen oder Altgriechischen – mag es geben? Das Deutsche unserer Zeit, das haben die großen Sprachforscher des 19. Jahrhunderts gezeigt, entsteht in einem langen Prozess aus der indoeuropäischen Sprachfamilie heraus, es ist Teil des germanischen Zweigs dieser Sprachfamilie. Wie das Englische und das Niederländische gehört es zur westgermanischen Gruppe. All diese Entwicklungen vollziehen sich in vorhistorischer Zeit, also vor jedem schriftlichen Zeugnis. Erst als ein westgermanischer Dialekt schon zum Deutschen geworden ist – so sehen wir es zumindest rückblickend – ist uns ein Existenznachweis überliefert: in Form der althochdeutschen zwischen ca. 600 und 1050 entstandenen Sprachdenkmäler, der Merseburger Zaubersprüche, des Hildebrandslieds, der Bibelübersetzungen des Tatian, des Notker und einiger weniger anderer Texte.4 Die weitere Geschichte überblicken wir, zunächst allerdings weitgehend auf der vornehmsten Sprachebene: Dem Mittelhochdeutschen (ca. 1050–1350) begegnen wir weitgehend nur als Sprache der Dichtung und der Dichter, denken wir an das Nibelungenlied, die Versepen von Wolfram von Eschenbach und Hartmann von Aue oder die Lyrik des Minnesangs. Auch das so genannte Frühneuhochdeutsche (bis ca. 1650) ist uns als Literatursprache – etwa von Sebastian Brants „Narrenschiff“ – und als so genannte „Kanzleisprache“ überliefert, also der Ausprägung, in der die juristischen und administrativen Texte, z. B. Urkunden, Erlasse oder Gerichtsprotokolle, an den Fürstenhöfen oder in den Freien Reichsstädten verfasst waren. Und natürlich sind die luthersche Bibelübersetzung und Luthers andere Schriften Zeugnisse des Frühneuhochdeutschen, ebenso wie die nach der Erfindung des Buchdrucks sprunghaft angestiegene literarische und publizistische Produktion des Reformationszeitalters insgesamt.
Allerdings begegnet uns im Verlauf der Sprachgeschichte nicht eine Gestalt des Deutschen, eine Varietät, wie Sprachwissenschaftler sagen, sondern eine ganze Menge regionaler Varietäten, die dann später durch Wissenschaftler eingeordnet und klassifiziert wurden. Überhaupt existierte das Deutsche bis weit in die Epoche des Neuhochdeutschen hinein überhaupt nur in Form solcher regionaler Varietäten. Eine Standardsprache, wie wir sie heute kennen, bildet sich – nach einer Vorläuferphase in Form der Vorherrschaft einer Regionalsprache, nämlich des Ostmitteldeutschen, das auch die Sprache Luthers war – erst im 17. und 18. Jahrhundert heraus, in der Zeit der Aufklärung und der Klassik, zunächst als übergreifende Literatur- und Wissenschaftssprache, dann auch als allgemeine Verkehrssprache. Für die Umsetzung dieser einheitlichen Schriftsprache in gesprochene Sprache gibt es seit 1898 eine Regelung. Offiziell galt sie als „Bühnenaussprache“ nur für das Deklamieren im Theater, sie wurde dann aber mit gewissen Abstrichen als allgemeine Richtschnur, etwa für den Schulunterricht, akzeptiert. Als ,Nationalsprache‘ spielt die deutsche Standardsprache auch eine Rolle im Kontext der Entstehung des deutschen Nationalstaats Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei ist das Deutsche damals wie heute natürlich eine ,plurizentrische‘ Sprache, die in der Schweiz und Österreich ebenso Nationalsprache oder eine der Nationalsprachen ist. Darüber hinaus werden Varietäten des Deutschen als Minderheitensprache gesprochen, etwa am Rande des zusammenhängenden deutschen Sprachgebiets wie im Elsass oder in Südtirol, aber auch in osteuropäischen Ländern, auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion oder in Übersee.5 Auf bundesrepublikanischem Staatsgebiet, in der Lausitz, ist im Übrigen auch die westslawische Sprache Sorbisch in den Varietäten Nieder- und Obersorbisch vertreten, mit heute noch etwa 20.000 bis 30.000 Sprechern.
Wie mag es aber vor dieser Vereinheitlichung gewesen sein, wenn ein Sprecher, sagen wir aus Celle oder Wuppertal, einer Alemannisch-Sprechenden aus dem Schwarzwald begegnete? Haben sie einander überhaupt verstanden? War die Situation womöglich vergleichbar mit der Begegnung zwischen einer Sächsin und einem Schweizer aus einer abgeschiedenen Alpenregion, die beide ihren Dialekt sprechen? Bis ins 19. Jahrhundert hinein bleibt uns das Deutsch des Mannes und der Frau auf der Straße unbekannt. Erst aus dieser Zeit haben wir Briefe und Tagebuchnotizen auch des sogenannten „kleinen Mannes“. Noch weiter müssen wir uns der Gegenwart nähern, wenn wir authentisches gesprochenes Material vorfinden wollen.
Dieser Gang durch die Sprachgeschichte mit Siebenmeilenstiefeln6 zeigt nebenbei eine aufregende Facette von Sprache: Sprachen scheinen Lebewesen zu sein: Sie stammen von anderen Sprachen ab, sie entwickeln sich, werden reifer und älter. Kränkeln und Verfall sind nicht auszuschließen, ebenso wenig wie der Tod. Sind diese Zuschreibungen von Leben und Tod nur bildlich, metaphorisch zu verstehen? Sprechen wir so über die Seinsweise von Sprache(n), weil wir kein anderes Vokabular zur Verfügung haben, meinen das aber nicht wörtlich? Wahrscheinlich verhält es sich so: Biologische Metaphern haben für unser Sprechen eine große Bedeutung, nicht nur beim Sprechen über Sprache, dem so genannten ‚metasprachlichen‘ Sprechen, sondern auch bei anderen Gegenständen der Rede. Auch der Aktienmarkt kann kränkeln und sich erholen, ein Land kann gesunden und blühende Landschaften hervorbringen, seine Bedeutung kann wachsen oder schrumpfen. Aber mit Sprachen hat es doch eine besondere Bewandtnis. So können, glaubt man einer Publikation aus dem Jahr 20147, Methoden der Evolutionsbiologie mit Erfolg auch aufs Sprachliche übertragen werden: Die lautgesetzlichen Entwicklungen von Wörtern korrespondieren mit den Prinzipien für die Weitergabe von biologischen Veränderungen, die z. B. durch Genmutationen oder Gentransfer zustande gekommen sind. Die vergleichende Sprachwissenschaft des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts hat aus eben solchen Lautgesetzen den Stammbaum der indoeuropäischen Sprachen rekonstruiert. Diese umwälzenden Einsichten können also heute angeblich mit diesen aus der Biologie bzw. der Bioinformatik adaptierten Methoden „bewiesen“ werden. Noch spektakulärer erscheinen die Verbindungen zwischen genetischen Merkmalen von Teilen der Weltbevölkerung und spezifischen Struktureigenschaften der von diesen Gruppen gesprochenen Sprachen. Eine wichtige Unterscheidung ist die zwischen ‚Tonsprachen‘ wie dem Chinesischen und ‚Nichttonsprachen‘ wie dem Deutschen und allen anderen europäischen Sprachen: In Tonsprachen wird durch die Veränderung der Tonhöhe oder der Tonbewegungen – zum Beispiel einer Bewegung von hoch nach tief in einem Vokal gegenüber der umgekehrten Bewegung von tief nach hoch – ein Bedeutungsunterschied ausgedrückt. In Nichttonsprachen geschieht das nicht. Es liege nun eine Kovarianz zwischen diesen sprachlichen und genetischen Merkmalen vor: „Betrachtet man die weltweite Verteilung dieser Sprachen, so fällt auf, dass sie der Verteilung eines von zwei Allelen – also Ausprägungen – der Gene ASPM und Microcephalin entspricht“, heißt es in einer Mitteilung des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen.8
Jedenfalls sind Sprachen zumindest halbwegs auch Natur. Auf intrikate Weise vermischen sich Natur und Kultur in ihnen, und damit schließlich gleichen sie den Sprechern selbst. Wir Menschen sind ebenfalls ein Mischprodukt von Natur und Kultur, in aller Banalität gesagt. Veränderung, Wandel, ist nicht nur eine sprachgeschichtliche Tatsache, sondern geschieht ständig, wenn auch kaum merklich. Ein Beispiel ist der langsame Abbau der Endung -e im Dativ Singular von Substantiven wie Mann oder Kind bzw. der gesamten Klasse der so genannten starken Non-Feminina. Während noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts Formen wie dem Manne oder im Kinde stilistisch eher unauffällig waren, finden wir sie heute vorwiegend in sprichwörtlichen Wendungen (wie Dem Manne kann geholfen werden) oder wenn der Sprecher sich ironisch bzw. altertümelnd geben will.9 Die Sprecher allerdings haben ein ambivalentes Verhältnis zum Sprachwandel. Rational mag ihnen bewusst sein, dass wir Sprachen nicht „anhalten“ können, dass Stillstand Abwirtschaften bedeutet. (Wenn man die angedeutete ökonomische Analogie ernster nehmen möchte: Es geht nicht um weiteres Wachstum, sondern um Anpassungsfähigkeit.) Aber gefühlsmäßig möchten viele Sprecher ihre Sprache so erhalten, wie sie ist. Jede Veränderung wird als Verlust oder Verfall betrachtet. Manchmal wird sogar eine Rückkehr zu früheren Sprachstufen gefordert oder zumindest eine solche vermeintlich reinere Sprachstufe als anzustrebende Idealnorm propagiert.
Und wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen: Wie kam überhaupt der Mensch zur Sprache, und wann geschah das? Auch auf diesem Tableau wiederholt sich die Analogie von Sprache und Sprecher: Wie Darwinisten und Kreationisten miteinander über den Ursprung des Menschengeschlechts streiten, so stehen sich, zumindest in der Vergangenheit, die Verfechter des göttlichen Ursprungs der Sprache und die eines „säkularen“ Ursprungs feindselig gegenüber. Heute, so scheint es, ist eine „evolutionäre“ Sicht auf das menschliche Sprachvermögen die übliche Sehweise. In neuester Zeit etwa wird der Zeitpunkt der Sprachentstehung immer weiter zurückverlegt. War noch vor wenigen Jahren fraglich, ob die Neandertaler, die engsten Verwandten des Homo sapiens, schon über Sprachvermögen verfügten, so wird neuerdings der Sprachursprung auf die Zeit vor 1,8 Millionen bis 1 Million Jahren datiert.10 Bei der Frage nach einer so frühen Sprachfähigkeit werden physiologische, archäologische und kulturelle Befunde gegeneinander abgewogen: Der heute als Sprechapparat dienende Teil der menschlichen Anatomie muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit überhaupt Sprachlaute produziert werden können, das Gehirn muss eine bestimmte Reife erreicht haben, um zu dieser hochkomplexen Aufgabe in der Lage zu sein. Auf der anderen Seite ist eine arbeitsteilige Gesellschaftsform, in der spezialisierte Werkzeuge gefertigt, schamanische Kulte zelebriert wurden und Kreativität ihren Ausdruck in fantastischen Darstellungen fand, etwa in den Höhlen von Chauvet, Lascaux oder Altamira, ohne sprachlichen Austausch kaum denkbar. Dem evolutionären Zeitgeist entsprechend werden verschiedene Szenarien des Sprachursprungs entworfen, bei denen die Sprachfähigkeit jeweils als Überlebensvorteil oder als soziale Anpassungsleistung im Kampf ums Überleben gewertet wird, etwa als besonders effektive Fertigkeit bei der Partnergewinnung, dem so genannten „Bonding“.11 Als plausible Annahme erscheint mir, dass die Lautsprache gestischen Formen der Kommunikation nachfolgte und sich zunächst nur in Form etwa von Anreden und Ausrufen in diese non-verbale Form der Interaktion einmischte. Manche nehmen auch die angeborene Musikalität des Menschen als Voraussetzung für die Ausbildung einer Lautsprache an.12 Außerdem hat man sich die „Erfindung“ der Sprache nicht als ein Geschehen von jetzt auf nachher vorzustellen, sondern als eine lange Periode der allmählichen Verfertigung von immer mehr ihrer Funktion oder vielmehr immer vielfältigeren Funktionen angepassten sprachlichen Werkzeugen. Wie differenziert erste „vollständige“ lautsprachliche Äußerungen dann waren, ob es schon so etwas wie Subjekt und Prädikat oder Nomen und Verb gab, das muss Spekulation bleiben.
Wie mag eine solche „Protosprache“ aus der Zeit vor 100.000 oder 50.000 Jahren geklungen haben? Oder: Was mögen die Sprachen der einzelnen Clans „gekonnt“ haben? War ihr Wortschatz eingeschränkt auf die Bedürfnisse des täglichen Lebens und Überlebens? Fanden sie Worte für ihre Ängste und Freuden oder gar für das Schöne und Göttliche, das sie in ihren künstlerischen Darstellungen feierten? War ihre Grammatik flexibel genug, um das uns vertraute Repertoire an Sachverhaltsbezügen und Sprechhandlungen zu kodieren? Konnten sie mit Sprache in die Zukunft vorausgreifen, über Vergangenes erzählen oder Spekulationen formulieren? Wenn wir etwa den Doku-Fiktionen über die frühe Menschheit Glauben schenken wollen, dann klang das recht „sapiens“haft, ein bisschen rauer und schroffer – eben wie man sich den Menschen dieser Zeiten vorstellt. Woher mögen die Filmemacher nur die Versatzstücke dieser „Sprachen“ nehmen?
Allerdings scheint es einen bitteren Streit zu geben zwischen Wissenschaftlern, die glauben, die Sprachfähigkeit sei aus einer kognitiven Evolution hervorgegangen und denjenigen, die meinen, sie sei das Ergebnis einer kulturellen Evolution. Die „Kognitivisten“, wie ich sie nennen möchte und die durch die verschiedenen Spielarten der auf Noam Chomsky zurückgehenden „Generativen Grammatik“ vertreten werden, sehen den entscheidenden Schritt in einer – ggf. durch Mutationen bewerkstelligten – besonderen Fähigkeit des menschlichen Geistes, insbesondere in der Fähigkeit zu rekursiven, also sich selbst einbettenden Strukturen.13 Die „Kulturalisten“, die unter anderem bei Sprachtypologen und funktional orientierten Forschern ihre Anhängerschaft haben, sehen Sprache als „cultural tool“, entwickelt, um Probleme des Zusammenlebens dieser besonderen Tierspezies zu lösen.14 Wie auch in anderen Zusammenhängen, beruht jede der Positionen auf einer einseitigen Überspitzung von kooperierenden Faktoren. Und: Es werden uralte Debatten neu aufgelegt: Die Kognitivisten führen Aristoteles‘ Sicht auf Sprache als Repräsentation des Geistes fort, die Kult...