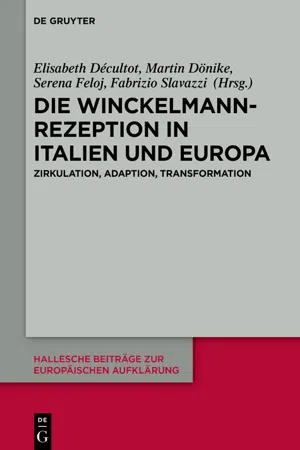250 Jahre Winckelmann-Jubiläen in europäischer Perspektive
Die internationale Tagung in der Villa Vigoni Ende 2017 über „Winckelmanns italienische und europäische Rezeption“ war durch ein Jubiläum veranlasst: 2017 wurde der 300. Geburtstag des 1717 in Stendal geborenen Gelehrten gefeiert, 2018 sein 250. Todestag.49 Die deutsch-italienische Vigoni-Tagung fügte sich ein in einen veritablen Reigen internationaler Veranstaltungen. Zu nennen wären etwa die Winckelmann-Ausstellungen in Florenz, Chiasso, Neapel, Weimar, Berlin, Wörlitz, Mailand, Rom und München, aber auch die Winckelmann-Tagungen und Vortragszyklen in St. Petersburg, New York, Halle, Zürich, Madrid, Rom, Oxford und London.50
Natürlich hat es eine Ausstellung und eine Tagung auch in Winckelmanns Heimatstadt Stendal gegeben; zudem sind vom deutschen Bundesministerium der Finanzen eine Briefmarke und eine Silbermünze zu Ehren Winckelmanns ausgegeben worden.51 Schon das genannte Spektrum von Städtenamen macht deutlich, dass Winckelmanns Bedeutung nicht eine genuin deutsche, vielmehr eine internationale ist. In diesem Sinne hat Ernst Osterkamp im Katalog zur Weimarer Ausstellung Winckelmann als einen „Europäer“ charakterisiert, der „ganz der europäischen Gelehrtenkultur des 18. Jahrhunderts“ angehört habe:
Er korrespondierte mit Altertumskennern in allen wichtigen Nationen Europas, er schrieb für ein internationales Publikum von antikebegeisterten Lesern, unterhielt Freundschaften zwischen Spanien und dem Baltikum, zwischen Kopenhagen und Neapel, konversierte in den Salons von Rom, Neapel und Florenz mit Reisenden, Gelehrten, Künstlern, Diplomaten aus allen Ländern, interessierte sich für spanische Megalithgräber nicht anders als für das englische Stonehenge [...] und für die künstlerischen Entwicklungen in Frankreich ebenso wie für diejenigen in England.52
Diese Beschreibung dürfte heutzutage wohl auf allgemeine Zustimmung treffen. Winckelmanns Lektüren, Werke und Briefe zeigen, dass er ein europäischer Gelehrter war, der sich als Mitglied einer internationalen res publica litteraria verstand und tatsächlich auch international rezipiert wurde. Dennoch ist es nicht allzu lange her, dass Winckelmann als ein genuiner Deutscher galt, der sich von Italienern, Engländern und Franzosen nicht beirren ließ und zu einem der Grundpfeiler deutsch-nationaler Identität erklärt wurde.
Ziel dieses Beitrages ist es zu zeigen, dass das Bild Winckelmanns von Anfang an zwischen den beiden Polen Deutschland und Europa bzw. der Welt aufgespannt war. Natürlich, das lässt sich nicht leugnen, liegt der Schwerpunkt der Rezeption Winckelmanns bis heute in den deutschsprachigen Ländern, aber eben nicht nur und schon gar nicht von Anfang an. Erinnert sei daran, dass der erste Versuch einer Ausgabe von Winckelmanns Werken im Frankreich der 1790er Jahre unternommen wurde und dass die ersten Winckelmann-Denkmäler im römischen Pantheon (1782) und in Triest (1822) errichtet wurden.53 Wichtige Beiträge der Winckelmann-Forschung sind ebenfalls nicht allein in den deutschsprachigen Ländern, sondern ebenso in Italien, Frankreich, England und den USA entstanden.
Der Beitrag richtet den Fokus auf die normalerweise alle 50 bzw. 100 Jahre gefeierten Winckelmann-Jubiläen, das heißt auf die Jahre 1777/78, 1817/18, 1867/68, 1917/18, 1967/68 und 2017/18; hinzu kommt das Jubiläumsjahr 1942/43, in dem außerhalb der üblichen Reihe des 225. Geburtstags bzw. 175. Todestags Winckelmanns gedacht wurde.54 Eine solche Fokussierung hat natürlich etwas Willkürliches an sich, denn tatsächlich sind einige der wichtigsten Beiträge zu Winckelmann gerade in den Jahren zwischen den Jubiläen erschienen, so etwa der von Goethe 1805 herausgegebene Band Winckelmann und sein Jahrhundert oder Alex Potts’ einflussreiches Buch Flesh and the Ideal von 1994. Dennoch: Die genannten Jubiläumsjahre sind Kulminationspunkte der Winckelmann-Rezeption – und zwar in dem Sinne, dass sie den jeweiligen Festrednern und -schreibern den Anlass und die Möglichkeit boten und bieten, im Blick zurück und nach vorn programmatische Aussagen zu formulieren.55 In den Praktiken, Motiven und Medien des Winckelmann-Gedenkens spiegelt sich dadurch auch die politische Geschichte der vergangenen 250 Jahre.
I.Das Jubiläum vor den Jubiläen: 1777/78
Noch ohne expliziten Bezug auf ein Jubiläum – in diesem Fall der 60. Geburtstag Winckelmanns – erschien 1777 in Dresden der erste Band von Karl Wilhelm Daßdorfs (1750–1812) Sammlung der Briefe Winckelmanns an seine Freunde, dem 1780 ein zweiter Band folgen sollte. Vor dem Hintergrund der „traurige[n] Zurückerinnerung seines frühen und grausamen Todes“ ist es das vordringliche Anliegen von Daßdorfs Ausgabe, das „Andenken eines großen Mannes zu erhalten“.56
Schon im folgenden Jahr 1778 – zum zehnten Todesjahr Winckelmanns – wurde diese erste Sammlung von Briefen Winckelmanns durch die von Leonhard Usteri (1741–1789) herausgegebenen Briefe Winckelmanns an seine Freunde in der Schweiz ergänzt, auch hier freilich noch ohne expliziten Bezug auf das Jubiläum.57 Gleiches gilt für die 1777 von der Kasseler Societé des Antiquités ausgeschriebene und 1778 publizierte Lobschrift auf Winckelmann, bei der Christian Gottlob Heyne (1729–1812) den Sieg über Herder davontrug.58 Schon die Fragestellung – „où il [Winckelmann, M. D.] a trouvé la Science des Antiquités, et à quel point il l’a laissée“ (in der damaligen Übersetzung: „wo, auf welcher Stufe Winckelmann das Studium des Altertums fand, und wo er das Studium des Alterthums ließ“) – macht allerdings deutlich, dass zehn Jahre nach Winckelmanns Tod der Zeitpunkt gekommen war, seine Leistung zu historisieren.59
II.Wanderer zwischen den Welten: Das Jubiläum 1817/18
Das erste reguläre, weil ‚runde‘ Doppeljubiläum fällt in die Jahre 1817/18. Anlässlich von Winckelmanns 100. Geburtstag und 50. Todestag ist die Ausbeute jedoch auffallend gering. Es drängt sich der Eindruck auf, dass Goethe mit dem von ihm 1805 vorgelegten Band zu Winckelmann und seinem Jahrhundert das Thema bereits vorzeitig erschöpft hatte. So findet sich beispielsweise in dem 1817 erschienenen siebten Band der Weimarer Winckelmann-Ausgabe kein Hinweis auf dessen 100. Geburtstag, obwohl dies durchaus nahegelegen hätte.60 Für Deutschland gibt es darüber hinaus noch zwei Beiträge von eher lokaler Bedeutung,61 ein weitaus bedeutenderer Beitrag stammt jedoch aus Italien, obwohl er in Dresden publiziert wurde. Gemeint ist der von Karl August Böttiger (1760–1835) herausgegebene Bericht Domenico Rossettis (1774–1842) über Joh.[ann] Winckelmann’s letzte Lebenswoche, laut Untertitel ein „[a]us den gerichtlichen Originalacten des Criminalprocesses seines Mörders Arcangeli“ gezogener „Beitrag zu dessen Biographie“. Es ist bezeichnend für diese italienisch-deutsche ‚Koproduktion‘, dass sowohl Rossetti als auch Böttiger wie selbstverständlich von Italien und Deutschland als den zwei „Vaterländern“ Winckelmanns sprechen: „Triest“, so heißt es in der Vorrede Böttigers, in der er Bezug nimmt auf das dort geplante Winckelmann-Denkmal,
ist eine deutsche Stadt von italischen Lüften angeweht und von den weichen Tönen italischer Sprache und Zauberklängen italischer Beredtsamkeit liebkosend umfangen. So gehörte auch Winckelmann beiden Ländern und Zungen an. Deutsch sey die eine, italisch die andere Inschrift auf dem Cippus oder der Gedächtnißsäule.62
Ganz in diesem Sinne und dabei nur scheinbar paradox ist bei Rossetti im selben Atemzug von Rom als dem „neuen Vaterlande“ Winckelmanns und zugleich von dessen „Sehnsucht“ nach dem alten „Vaterlande“, das heißt Deutschland, die Rede.63 Von dieser kosmopolitischen Sicht auf Winckelmann, die etwa auch die ab 1829 in Rom am Instituto di corrispondenza archeologica begangenen Winckelmann-Feiern prägt, sollte im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weniger übrigbleiben.64 Aus dem Europäer Winckelmann wurde im Zuge des deutschen ‚nationbuilding‘ immer mehr ein reiner, unverfälschter Deutscher.
III.Deutscher Genius und europäischer Renaissancemensch: Das Jubiläum 1867/68
Das Winckelmann-Jubiläumsjahr 1867/68 begann, gewissermaßen verfrüht, mit der Wiederauflage von Otto Jahns (1813–1869) erstmals 1844 publiziertem biographischen Winckelmann-Aufsatz und der Veröffentlichung des ersten Bandes von Carl Justis (1832–1912) monumentaler Biographie, die beide bereits 1866 erschienen waren.65 Doch zumindest Justis Biographie war tatsächlich schon mit Blick auf das Jubiläum geschrieben, wie ein Blick in das Vorwort deutlich macht, wo es heißt:
Hundert Jahre sind nun bald dahin, seit Winckelmann aus den Lebenden weggerissen ward; und noch immer fehlt ihm die Erzählung seines Lebens, die Abrechnung seiner geistigen Hinterlassenschaft: noch immer steht seine Nische in dem biographischen Pantheon leer, während seine Büste schon lange im Pantheon des Agrippa aufgestellt ist.66
Für beide, den Archäologen Jahn wie auch den Kunsthistoriker Justi gilt, dass sie versuchen, Winckelmann, wohl nicht zuletzt im Kontext der Reichsgründung, dezidiert als einen Deutschen zu profilieren.67 So heißt es bei Jahn:
Sein Andenken unter uns zu erhalten geziemt uns um so mehr, als Winckelmann ein Deutscher war, ein Deutscher an Sinn und Geist, und wie er sein Volk in seinen schönen Bestrebungen geweckt, gefördert und gehoben hat, so errang er, wie vor ihm Keiner, nach ihm nicht Viele, der Tiefe und Klarheit, der Kraft und Gediegenheit des deutschen Geistes durch ganz Europa hin bewundernde Anerkennung. Mit Recht feiern wir daher seinen Geburtstag, und nicht wir allein. Schon seit einer Reihe von Jahren begeht das Institut für archäologische Correspondenz in Rom, an dem Orte seines Wirkens, in festlicher Zusammenkunft auf dem Capitol den Geburtstag des Stifters der Archäologie, und bereits sind mehrere deutsche Universitäten diesem Beispiel gefolgt.68
Ganz ähnlich argumentiert Justi in der Einleitung zu seiner WinckelmannBiographie:
Die Erscheinung Winckelmanns steht gleichsam an der Pforte, die aus der Verknöcherung und Geschmacklosigkeit der vorhergegangenen Zeiten hinüberführt in den unserer Erinnerung so theuern Bezirk, wo die bei den neuern Völkern herumgehende Leitung der geistigen Bewegung an Deutschland kam: seine Werke gehören zu den Erstlingen des deutschen Genius, aber es sind Erstlinge, nach welchen uns selbst das Höchste nicht mehr sehr überraschen kann, was die Folgezeit bringen sollte.
Der Eintritt der bildenden Kunst in den Kreis unserer Nationalbildung, die Oeffnung des griechischen Alterthums, die Anfänge der deutschen Prosa und der deutschen Geschichtsschreibung, die Erhebung der deutschen Literatur zur Weltliteratur: dieser und noch anderer Dinge ist man gewohnt sich zu erinnern, wenn der Name Winckelmanns genannt wird.69
Auch wenn gerade Justis Monumentalbiographie Winckelmanns Wirken dezidiert in einen internationalen Kontext stellt,70 kann für ihn wie auch im Allgemeinen gelten: Aus dem Europäer Winckelmann wird gegen Ende des 19. Jahrhundert immer mehr ein Deutscher, ja der Deutsche schlechthin. Und doch ist es die Winckelmanns Deutschtum herausstreichende Biographie Jahns gewesen, die einem Engländer den Anlass für die Niederschrift eines Textes bot, dessen Bedeutung f...