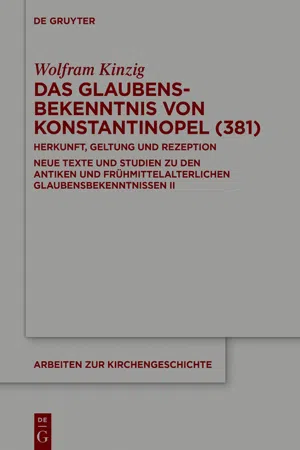
Das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel (381)
Herkunft, Geltung und Rezeption. Neue Texte und Studien zu den antiken und frühmittelalterlichen Glaubensbekenntnissen II
- 237 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel (381)
Herkunft, Geltung und Rezeption. Neue Texte und Studien zu den antiken und frühmittelalterlichen Glaubensbekenntnissen II
Über dieses Buch
Dieses Buch bietet eine umfassende neue Untersuchung zur Entstehung, Verabschiedung und Rezeption jenes Glaubensbekenntnisses, welches die kirchliche Tradition dem II. Ökumenischen Konzil (Konstantinopel, 381), zugeschrieben hat (sog. Nicaeno-Constantinopolitanum, C). Es ist das ökumenisch am weitesten verbreitete Bekenntnis der Christenheit und der mutmaßlich einflussreichste nichtbiblische Text innerhalb der Kirche.
Eine sorgfältige Durchmusterung der Quellen unter Einbeziehung soeben entdeckter Zeugen ergibt, dass das auf dem I. Ökumenischen Konzil (Nizäa, 325) verabschiedete Credo in den späten 370er Jahren in Rom und Antiochien überarbeitet wurde und dann in Konstantinopel eine weitere Revision erfahren hat. Sie führte zu zwei Rezensionen: einer Langversion und einer Kurzversion. Die Langversion (das heutige C) wurde in Konstantinopel nicht verabschiedet, sondern erst auf dem IV. Ökumenischen Konzil (Chalkedon, 451) als Interpretation des Nizänums in die dogmatischen Beschlüsse integriert.
Sie verdrängte so die Kurzversion, die nach 381 vor allem in Konstantinopel verwendet worden war. Das Buch zeichnet diesen Prozess nach und beleuchtet außerdem auch die Stationen der späteren Rezeption von C bis in das Mittelalter hinein.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1 Einleitung
- 1.
-
der Herkunft des Textes von C2,
- 2.
-
der damit eng verknüpften, aber nicht identischen Frage des Zusammenhangs zwischen C2 und dem II. Ökumenischen Konzil von 381,
- 3.
-
der Aufnahme von C2 unter die dogmatischen Referenztexte auf dem Konzil von Chalkedon (451),
- 4.
-
dem Problem des Symboltextes auf der 5./6. Sitzung von Chalkedon
- 5.
-
und der Nachgeschichte mit der allmählichen Verdrängung des Symbols von Nizäa durch das von Konstantinopel.
2 Das Bekenntnis von Konstantinopel: Bemerkungen zur Forschungslage
Kein Einsichtiger wird bei diesem Thatbestande mehr behaupten können, das C[onstantino]p[olit]anum sei lediglich eine leicht modifizierte Rezension des Nicänums, sondern der Schluß ist unabweislich, daß es entweder ein ganz selbstständiges neues Symbol ist mit gewissen nicänischen Einschiebseln oder daß ihm irgend ein anderes älteres Taufsymbol zu Grunde liegt, welches nur nicänisch redigiert ist.
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Liste der Sigla für Glaubenssymbole
- Bibliographische Abkürzungen
- Schreibweise antiker Namen
- 1 Einleitung
- 2 Das Bekenntnis von Konstantinopel: Bemerkungen zur Forschungslage
- 3 Methodologische Überlegungen und Thesenskizze
- 4 Die Herkunft des Symbols von Konstantinopel: Die Bekenntnisse von Nizäa, Antiochien und Konstantinopel im Vergleich
- 5 Debatten um die Suffizienz von N unter den Nizänern
- 6 Die römische Synode von 377/78
- 7 Die Meletianersynode in Antiochien (379)
- 8 Das Konzil von Konstantinopel (381) und sein Bekenntnis
- 9 Die Rezeption der Bearbeitungen von N bis zum Konzil von Chalkedon (451)
- 10 Die Approbation von N und C2 als Normbekenntnissen auf dem Konzil von Chalkedon (451)
- 11 Der Text von N und C2 auf der 5./6. Sitzung des Konzils von Chalkedon
- 12 Die Rezeption von C2 in der Zeit nach Chalkedon
- Register der Bibelstellen
- Register der sonstigen antiken Quellen
- Register der Paragraphen in FaFo
- Register der Handschriften
- Stichwortverzeichnis
- Personenregister