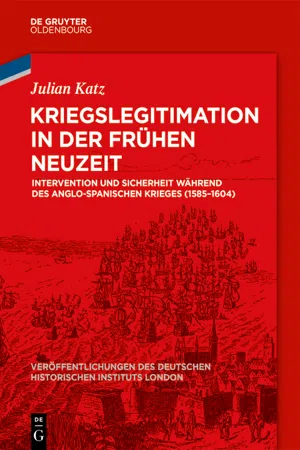1.1 Schutzverantwortung als Kriegslegitimation:
Historische Perspektiven auf ein aktuelles Problem
Im April 2018 veröffentlichte die britische Regierung ein sogenanntes policy paper, in dem sie ihre Teilnahme an Militäraktionen gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad damit rechtfertigte, dass sein Regime schwerwiegende Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung begehe.1 Als Leser des Papiers fühlt man sich erinnert an die Begründung für die Beteiligung Deutschlands am NATO-Einsatz gegen Serbien, der 1999 im Rahmen des Kosovokrieges stattfand. Die Bundesregierung argumentierte damals, man müsse die Bevölkerung des Kosovos vor einer humanitären Katastrophe infolge des Krieges bewahren. Javier Solana, der Generalsekretär des Bündnisses, bemerkte gegenüber der Presse, dass es der NATO nicht um einen Krieg gegen Serbien gehe, sondern lediglich darum, menschliches Leid, Repressionen und Gewalt zu verhindern.2 Wenige Jahre später begründeten der US-Präsident George W. Bush und sein britischer Partner, Premierminister Tony Blair, den Einmarsch amerikanischer und britischer Truppen im Irak mit der Befreiung des irakischen Volkes von brutaler Unterdrückung.3 Und Bushs Amtsnachfolger Barack Obama betonte anlässlich der Entgegennahme des Friedensnobelpreises 2009 die wachsende Bedeutung von Militärinterventionen zum Schutz von Zivilisten vor Gräueltaten in einer von asymmetrischen Kriegen heimgesuchten Welt.4
All diese Beispiele stützen die Annahme, dass seit den 1990er-Jahren eine Aufwertung des humanitären Schutzes von Menschen als politischer Interventions- und Kriegsbegründung stattgefunden hat.5 Einen nicht unerheblichen Beitrag dazu leistete die Arbeit der International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). Die Kommission machte es sich ab 2001 zur Aufgabe, ein definitives Konzept der international umstrittenen ‚humanitären Intervention‘ auszuarbeiten. Am Ende des Prozesses stand die Idee der responsibility to protect (R2P) als einer internationalen Schutzverantwortung, die nicht länger primär von dem Verhältnis souveräner Staaten zueinander, sondern von der Schutzbedürftigkeit der in diesen Staaten lebenden Menschen ausgehend gedacht wird.6 Gemäß der responsibility to protect gilt „[i]m Falle schwerster Menschenrechtsverletzungen […] nicht mehr eine Intervention [als] begründungspflichtig, sondern der Verzicht darauf.“ 7 Die Grundlage dafür ist, dass die Souveränität eines Staates in der R2P-Diskussion nicht mehr an seiner Fähigkeit zur Kontrolle des Staatsterritoriums, sondern an seiner Verantwortlichkeit für die Sicherheit der Bevölkerung auf seinem Gebiet gemessen wird. Kommt ein Staat dieser Verantwortung nicht nach, steht die Souveränität zur Disposition und die internationale Schutzverantwortung kommt ins Spiel. Staatssouveränität und die Sicherheit der Menschen innerhalb eines Staatsterritoriums sind somit die Eckpfeiler, zwischen denen sich im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert die Debatte über die Legitimität militärischer Eingriffe in fremde Hoheitsgebiete aufspannt.8
Von dieser Feststellung aus lässt sich der Bogen zur europäischen Frühen Neuzeit schlagen, der Epoche, die im Fokus der vorliegenden Arbeit steht. Frühmoderne Staatlichkeit, ein etatistisches Souveränitätsverständnis und ein internationales Staatensystem bildeten sich in dieser Epoche erst allmählich heraus, der Mensch als per se schützenswertes Individuum war noch keine etablierte politische Kategorie.9
Zentrale Bedingungen, unter denen die heutigen Ideen der humanitären Schutzintervention bzw. R2P ihren Sinn erlangen,10 waren somit ehestens gegen Ende der Frühen Neuzeit gegeben. Eventuell deswegen hat die wissenschaftliche Historiografie dem Thema der Schutzverantwortung und -intervention lange keine Beachtung geschenkt. Mittlerweile wird allerdings vermehrt zu der Frage geforscht, welche vormodernen Wurzeln oder Vorläufer die (post-)moderne politische Idee der humanitären Intervention hat.11
Die Frühe Neuzeit ist dabei besonders in den Blick geraten: Einerseits handelt es sich um die Epoche, die den allmählichen Aufstieg einer Souveränitätsvorstellung erlebte, welche die auswärtige Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates zurückwies oder zumindest problematisierte.12 Andererseits begründeten die Herrschenden Europas nachweislich schon im 16. Jahrhundert ihre Kriege gegen andere Fürsten damit, deren Untertanen vor ungerechter Regierung und Unterdrückung zu schützen.13
Im Jahr 1585 publizierte etwa die englische Königin Elisabeth I. ein Manifest mit dem vielsagenden Titel A Declaration of the Cavses mooving the Queene of England to giue aide to the Defence of the People afflicted and oppressed in the lowe Countries. Elisabeths Manifest bezog sich auf die Situation in den benachbarten Niederlanden, die damals zum Weltreich Philipps II. von Spanien gehörten. Hier fand seit 1568 ein erbitterter Kampf gegen die spanische Bevormundung in politischer wie konfessioneller Hinsicht statt, der mit einer intensiven Suche nach auswärtigen Schutzmächten einherging. 1581 hatte sich der reformierte Teil der Provinzen von Philipp II. losgesagt und ein eigenständiges Gemeinwesen formiert.14 Als Elisabeth I. 1585 eine englische Armee in die Niederlande entsandte, um die autonom gewordenen Provinzen militärisch zu unterstützen, legitimierte sie diese Aktion mit der Schutzbedürftigkeit der Niederländer angesichts der spanischen Tyrannei.15
Die englische Intervention markierte den Anfang des anglo-spanischen Krieges, der die Geschicke Westeuropas in den kommenden rund 19 Jahren mitprägen sollte. Am 18. August 1604 wurde dieser Krieg durch einen mühsam verhandelten Frieden beendet.16 Bezeichnenderweise verpflichteten sich die ehemaligen Kriegsparteien in dem Friedensvertrag, in Zukunft von jeder direkten oder indirekten Hilfe für rebellierende Untertanen der jeweils anderen Partei abzusehen.17 Die Wechselseitigkeit dieser Klausel hatte gute Gründe: Ab 1588 griffen die Apologeten der Politik Philipps II. das Grundmuster der englischen Rechtfertigung von 1585 auf und begründeten spanische Invasionsvorhaben in England mit dem Schutz der dort lebenden Katholiken. Die vermutlich bekannteste derartige Kriegsrechtfertigung ist die in Antwerpen gedruckte Admonition to the Nobility and People of England and Ireland Concerning the Present VVarres made for the execution of his Holines Sentence, by the Highe and mightie King Catholike of Spaine des im römischen Exil lebenden Kardinals William Allen.18 Ihm wird außerdem ein Flugblatt zugeschrieben, das die wesentlichen Argumente der sechzigseitigen Admonition unter dem Titel A Declaration of the Sentence and deposition of Elizabeth, the vsurper and pretensed Quene of Englande auf einer Druckseite zusammenfasste.19
Beide Schriften sollten 1588 nach der Landung der Spanischen Armada in England verbreitet werden und die gerechten Gründe erläutern, die den spanischen König zu der Invasion bewogen hatten. Vor allem die Admonition erfüllte dabei mehrere Funktionen: Zum einen (1.) gab sie die Erneuerung des Exkommunikationsurteils gegen Elisabeth I. bekannt. Darüber hinaus (2.) rief der Kardinal in ihr seine englischen Landsleute zum Bündnis mit Spanien und Widerstand gegen die protestantische Machthaberin auf. Dieser Widerstand bedeutete in der Lesart der Admonition keine Rebellion, denn er war aus denselben Gründen legitim, welche auch die spanische Invasion in England rechtfertigten. Außerdem stellte die Schrift (3.) eine Apologie der Entscheidung Philipps II. zu dieser Invasion dar. Die Admonition verknüpfte die Rechtfertigung der spanischen Kriegsunternehmung mit einer erbitterten Anklage der elisabethanischen Tyrannei, unter welcher vor allem die englischen Katholiken leiden würden. Auf diese Weise verlieh Allens Schrift dem spanischen Feldzug das Gepräge einer uneigennützigen Schutzintervention.20
Aber nicht nur Kardinal Allen rechtfertigte das Invasionsprojekt als eine militärische Protektion von unrechtmäßig unterdrückten Katholiken. Auch der spanische Jesuitenpater Pedro de Ribadeneira verfasste 1588 unter dem Titel Exhortación para los Soldados y Capitanes, que van a esta Jornada de Inglaterra en nõ[m]bre de su Cap[itá]n General einen furiosen Aufruf, in dem er die bevorstehende Invasion als Verteidigung der bedrängten englischen Glaubensgenossen abbildete. Nebenbei stilisierte er Spanien zu einer Art weltlichen ‚Universal-Schutzmacht‘ der katholischen Kirche und Gläubigen.21
Spaniens Armada-Expedition von 1588 ist heute wohl vor allem für ihr Scheitern bekannt, das vor der Folie der allzu verfrühten spanischen Siegesgewissheit22 einen fast ‚tragisch‘ anmutenden Zug besitzt. Die Niederlage bedeutete zwar einen enormen Rückschlag für Philipp II., dennoch gab er seine Pläne einer kriegsentscheidenden Invasion in England nicht auf. Stattdessen entwickelten der Rey Católico und seine Berater, wie Edward Tenace feststellt, eine neue „grand strategy, whose centrepiece consisted of a renewed offensive against England. The effort culminanted in the formation of two large Armadas in 1596 and 1597, and plans for a new invasion.“23
Die ‚Reaktivierung‘ der Invasionspläne bedingte auch erneute Überlegungen zur Rechtfertigung des spanischen Feldzuges gegen die protestantische Königin von England. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang mehrere spanischsprachige Kriegsmanifeste, die als handschriftliche Entwürfe im Archivo General de Simancas (bei Valladolid) überliefert sind und anders als Kardinal Allens Rechtfertigungsschriften aus dem Jahr 1588 wohl nicht gedruckt wurden.24 Allerdings reproduzierten sie die in Kardinal Allens Admonition und Declaration of the Sentence präsentierte Legitimation der England-Invasion als Intervention zur Befreiung der Katholiken und sind deshalb von größtem Interesse für diese Untersuchung. Zusammen mit Königin Elisabeths Declaration aus dem Jahr 1585 sowie Kardinal Allens Kriegsrechtfertigungen und Ribadeneiras (ebenfalls ungedrucktem) Aufruf von 1588 dienen diese Entwürfe aus dem Archiv in Simancas als zentrale Quellengrundlage der vorliegenden Arbeit.
Dieses Quellenkorpus ist bisher nicht in komparativer Perspektive untersucht worden, sodass die vorliegende Studie mit ihrem Untersuchungsansatz Neuland betritt. Es ist das Ziel der Arbeit, die zwischen 1585 und 1604 auf englischer wie auf spanischer Seite zur Begründung des Krieges verwendeten Argumente anhand der soeben vorgestellten Quellen im Detail zu analysieren und vergleichend gegeneinanderzuhalten. Der Fokus des Erkenntnisinteresses liegt auf den Rechtfertigungen der Kriegsführung als Erfüllung einer fürstlichen Schutzverantwortung gegenüber ungerecht regierten Untertanen. Schlussendlich sollen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Legitimationsstrategien herausgearbeitet und im historischen Kontext bewertet werden. Dadurch soll ein Beitrag zur Erforschung des politischen Denkens im Europa der Frühen Neuzeit geleistet werden, in dessen Mittelpunkt die Frage nach der Formierung einer speziell frühneuzeitlichen Version der ‚humanitären Intervention‘ steht. Der Fokus der vorliegenden Studie soll auf der politischen Praxis liegen, das heißt, auf der Anwendung und argumentativen Gestaltung derartigen Ideenguts im ‚zwischenstaatlichen‘ Konfliktfall. Das Interesse gilt der Entwicklung eines legitimatorischen Modus der Kriegsbegründung unter Zugrundelegung der Schutzbedürftigkeit fremder Untertanen. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich parallel zu Politikern und Geistlichen an den frühneuzeitlichen Fürstenhöfen auch bedeutende Gelehrte mit dem Problem der Intervention beschäftigten.25
Nicht selten sprachen sich Letztere zugunsten einer grenzüberschreitenden Schutzverantwortung aus, die sie in den Händen der Träger politischer Autorität und m...