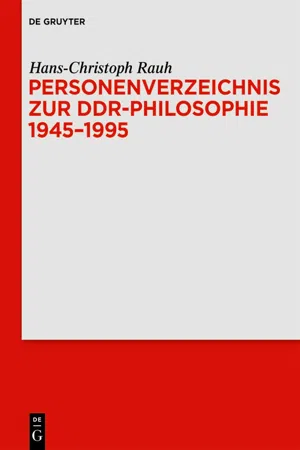
- 670 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Personenverzeichnis zur DDR-Philosophie 1945–1995
Über dieses Buch
Mit über 700 Einträgen präsentiert dieser Band das erste bio-bibliographische Personenverzeichnis zur DDR-Philosophie in den Jahren 1945 bis 1995. Durch die Auswertung archivalischer Quellen leistet der personalgeschichtliche Zugriff einen umfassenden Beitrag zur kritischen Aufarbeitung einer realsozialistisch ein- und abgeschlossenen Entwicklung der Philosophie einschließlich ihrer inhaltlichen wie auch formalen Konsequenzen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Personenverzeichnis zur DDR-Philosophie 1945–1995 von Hans-Christoph Rauh im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Politische Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information

Personenverzeichnis
Abendroth, Wolfgang
2. Mai 1906–15. Sept. 1985
Geistiger Wegbereiter des universitären Marxismus in der BRD
Geb. als Sohn eines Mittelschullehrers in Eberfeld (Wuppertal); nach Gymnasialbesuch Studium der Rechtswiss. u. Volkswirschaftslehre in Tübingen, Münster u. Frankf./M.; 1930 erstes jurist. Staatsexamen und bis 1933 Gerichtsreferendar; frühzeitig linkssozialistisch organisiert, zeitweilig auch KPD-Mitgl., aber wegen Kritik an der Stalinschen „Sozial-Faschismusthese“ ausgeschlossen u. Anhänger der KP-Opposition; der NS-Staat untersagte ihm jede weitere jurist. Betätigung und abschl. Ausbildung; daher 1935 univ.-jurist. Diss. zu einem völkerrechtlichen Thema in der Schweiz (Bern publ. 1936, jedoch bald darauf von der deutschen Gestapo beschlagnahmt); kurzzeitig Volontärstelle in einer Bank, aber bereits 1937 verhaftet u. wegen Hochverrat verurteilt; danach 1941 als Wirtschaftsjurist bei einer Außenhandelsfirma in Berlin tätig; 1943 als „Bewährungssoldat“ ins Strafbattalion 999 eingezogen; im besetzten Griechenland 1944 übergelaufen zu griech. Partisanen, aber trotzdem britische Kriegsgefangenschaft in Ägypten; später überführt in ein antifasch. Umerziehungslager, in dem „geeignet erscheinende Kriegsgefangene auf ihre Rückkehr nach Dtl. zum Aufbau der Demokratie vorbereitet wurden“; nach der Entlassung Ende 1946 zunächst in Marburg, doch wegen des fehlenden 2. jurist. Staatsexamens zeitweilige Übersiedlung in die SBZ, zu den in Potsdam lebenden Eltern; bei vorlg. antifasch. Vergangenheit sofortige Anstellung als Richter am Brandenburger Landgericht; 1947/48 univ. rechts- u. staatswiss. Berufungen: für Völker- u. Kontrollrecht in Halle (nach dortiger Habilitation), Leipzig u. schließlich ein Ordinariat für öffentl. Recht in Jena. Jedoch wegen der sich politisch zuspitzenden Lage (Stalinisierung) in der SBZ bereits Ende 1948 Weggang aus Jena mit einem Protest-Brief an die thüringische Volksbildungsministerin Marie Torhorst, die gerade auch Hans *Leisegang fristlos entlassen hatte, der daraufhin ebenfalls flüchtete und an die FU in West-Berlin ging. – Damit erfolgte bereits im ersten ostdt. „Kriesenjahr“ 1948 ein allgemeiner Weggang aus der SBZ (ebenso wie aus Leipzig Theodor *Litt u. Hans-Georg *Gadamer) noch vor nachfolgender Gründung der DDR, die jedoch für W. A. niemals ein demokratischsozialist. Rechtsstaat zu werden vermochte. Wie pol. gefährlich die Lage für A. bereits geworden war, belegt ein interner Personalbericht der SED (in die er sich „nicht entsscheiden konnte“, einzutreten) eines früheren NS-Mitgefangenen u. späteren ML-Prof. (Peter Hanke, ABF-Direktor in Berlin) vom 25. 9. 1947: „Es gab keine Einschätzung der pol. Lage, in der wir eine gemeinsame Auffassung hatten. So vertrat er die Meinung, dass der Faschismus eine sozialistische Planwirtschaft einleite, (und) schätzte die Entw. des Sozialismus in der Sowjetunion ausserordentlich negativ ein“; persönlich sei A. aber „ein sehr angenehmer u. anständiger Charakter“ u. „außerordentlich intelligent“; dazu ist parteiamtlich weiterhin handschriftlich notiert: „wird so beschäftigt, daß er polit. nicht schaden kann.“ Auf Grund seiner komm. Opposition vor 1933 (Parteiausschluß wegen fraktioneller Tätigkeit), der westlichen (brit.) antifaschistisch-demokratischen Umschulung um 1945 sowie seiner nie aufgekündigten Westberliner SPD-Mitgliedschaft wäre er 1948/51 sowieso von den gerade einsetzenden ersten stalinistischen Säuberungen der SED erfaßt u. „ausgeschaltet“ worden (allein schon wegen der Weigerung, in diese einzutreten). Wieder zurück in der Westzone, zunächst nach Bremen (zu seinen Schwiegereltern), erfolgte dennoch keine Absage an den „demokratischen Sozialismus“ bzw. Marxismus, der aber für ihn nur als methodologisches Denkwerkzeug (also nicht als dogm. Partei-Ideologie) bzw. jener nur als sozialdemokratischer Rechtsstaat (und nicht als stalinistische Parteidiktatur) vorstell- u. realisierbar sein konnte. Daraufhin 1949 ordtl. Prof. für öffentl. Recht und Politik an der HS für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven (Gründungsdirektor) sowie 1950 endliche Berufung durch die dortige Phil. Fak. als ordtl. Prof. für „wissenschaftliche Politik“ in Marburg bis zu seiner Emeritierung 1972 u. Begründer der sog. „Marburger marxistischen Schule“; weiterhin keine Absage an den Marxismus, wie bei der SPD nach dem Godesberger Parteitag 1959; – jedoch anerkannt nur als hist.-krit. Forschungsmethode, nicht aber als allein herrschende parteiamtl. Weltanschauung/Ideologie wie inzwischen in der SED-DDR praktiziert; daher in den 60er Jahren auch weiterhin Kontakte zur, von der SPD da schon politisch ausgegrenzten sozialistischen Studentenorg. (SDS) während derer außerparlamentarischen oppotionellen univ. Aktivitäten 1967/68; dafür bereits Ende 1961 frühzeitiger Ausschluß aus der SPD; setzte sich auch für die baldige Aufhebung des Verbots der KPD bzw. für deren westdt. Wiederzulassung ein; daher auch Mitgl. des DKP-eigenen Instituts für Marxistische Studien u. Forschungen (IMSF) in Frankf./M. – Der von Max Horkheimer (da neomarxistisch wie linkspolitisch orientiert) abgewiesene Mitarbeiter des Frankfurter Instituts für Sozialwissenschaften (Inst.-Leiter ist Theodor W. Adorno) Jürgen *Habermas konnte sich daraufhin 1961 nur bei A. in Marburg ungehindert und erfolgreich habil., ebenso wie andere, linkspolitische westdt. Intellektuelle danach; seit seiner univ. Emeritierung 1972 (Nachfolger Frank Deppe) Lehrer für Geschichte der dt. Arbeiterbewegung an der gewerkschaftl. Akademie der Arbeit in Frankf./M.; vertrat ungebrochen und öffentlich einen unorthodoxen wie kritischen Marxismus allein als wiss. Forschungsmethode, der aber für ihn fortlaufend einer Fundierung durch eine sozialwiss. Realanalyse bedürfe. Festschrift z. 70. Geb. Ein Leben in der Arbeiterbewegung. Gespräche (Frankf./M. 1976) u. 75. Geb. Arbeiterbewegung u. Wissenschaftsentwicklung, (Studien zur Dialektik, Bd. 3. Köln 1981); verst. 1985 in Frankf./M.; – am 2. Mai 2006 noch ein ehrendes Gedenken zum 100. Geb. mit einem Symp. zum Thema Politische Wissenschaft – Arbeiterbewegung – Demokratie.
Publ.: Gesammelte Schriften in 8 Bdn (Hrsg. M. Buckmiller u. a.): Bd. 1 (1926–1948, enthalten auch seine Beiträge aus der SBZ-Zeit). Hannover 2006, Bd. 2 (1949–1955) 2008 u. Bd. 3 (1956–1963) 2013; Aufstieg und Krise der Sozialdemokratie. Frankf./M. 1964; Sozialgesch. der europäischen Arbeiterbewe. Frankf./M. 1965 (14. A. 1986); Wirtschaft, Gesell. und Demokratie in der Bundesrep. Frankf./M. 1965; Antagonistische Gesellschaft u. pol. Demokratie. Aufsätze zur pol. Soziologie. Neuwied 1967 (2. A. 1972); T. Pinkus (Hrsg.): Gespräche mit G. Lukacs, H. H. Holz, L. Kofler, W. Abendroth. Hbg. 1967; (Mitautor): Die Linke antwortet Jürgen Habermas. Frankf./M. 1968; (Mithrsg. K. Lenk): Einführung in die pol. Wissenschaft. Mün. 1968 (6. A. 1982); Gegen den Strom. KPD-Opposition (1928–1945). Frankf./M. 1984; Einführung in die Gesch. der Arbeiterbewegung. Bd. 1: Von den Anfängen bis 1933. Heilbron 1985; Die Aktualität der Arbeiterbewegung. Beitrag zu ihrer Theorie u. Geschichte. Frankf./M. 1985.
Lite.: F.-M. Balzer u. a. (Hrsg.): W. A. Wissenschaftlicher Politiker. Biobibliograph. Beiträge. Opladen 2001; ders. (Hrsg.): W. A. für Einsteiger u. Fortgeschrittene (sowie) Gesamtbibliographie. 2. A. Bonn 2006; H.-J. Urban u. a. (Hrsg.): Antagonistische Gesell. u. pol. Demokratie. Zur Aktualität von W. A. Hamburg 2006; A. Diers: Arbeiterbewegung–Demokratie–Staat. W. A.–Leben u. Werk 1906–1948. Hbg. 2006; U. Schöler: Die DDR u. W. A. Kritik einer Kampagne. Hannover 2008; ders.: W. A. u. der „reale Sozialismus“. Ein Balanceakt. Berlin 2012; J. Hermand: Vorbilder. „Partisanenprofessoren“ im geteilten Dtl. (enthält neben W. A. auch noch W. Kraus, J. Kuczynski, H. Mayer, H. H. Holz u. W. Mittenzwei). Köln, Weimar 2014; L. Peter: Marx an die Universität. Die „Marburger Schule“. Geschichte, Probleme, Akteure. Köln 2014; G. Kriditis (Hrsg.): W. A. oder „Rote Blüte“ im kpl. Sumpf. Berlin 2015.
Abermann, Xenia
9. Aug. 1924
Erste weibl. Aspirantin und phil. Prom. am Ley-Lehrstuhl “Phil.-Naturwiss.“ der HUB
Geb. in Priluki/UdSSR; 1933–41 Besuch einer dortigen Mittelschule, jedoch nach der deutsch-fasch. Besetzung 1943 als „sowjetukrainische Ostfremdarbeiterin“ zur Zwangsarbeit nach Dtl. verschleppt, wo sie nach Kriegsende verblieb, heiratete und dadurch später in der SBZ/DDR eingebürgert wurde; 1945–49 zunächst als Dolmetscherin bei der Sowjetarmee in Berlin-Karlshorst (SMAD) dienstverpflichtet u. sofortiger KPD-Eintritt; 1949/51 Studienzulassung (Abitur) an der ABF der Ost-Berliner Universität sowie anschl. Studium an deren neu gegr. Landwirtschafts-Gärtnerischen Fak. (Dipl.-Landwirtin); anschl. 1956–61 red. Übers.-Arbeiten für slawische Sprachen an der Landwirtschafts-Akademie der DDR; seit 1961 erste weibliche Aspirantin am Hermann *Ley-Lehrstuhl für die phil. Fragen der Naturwiss. (Institut für Phil.) der HU zu Berlin und 1964 ebenso erste „naturphil.“ Prom. einer Frau an diesem gerade erst gegründeten wiss.-phil. Lehrstuhl mit einer Arbeit Zum Erkenntniswert des Experiments und der Beobachtung in der Biologie und Landwirtschaft (Gutachter: H. *Ley und J. *Segal, mit entspr. Fachprüfungen in Phil. u. Biologie, publ. Jena 1972); späterer Lehreinsatz im gesell.-wiss. (also marx.-len.) Grundstudium in Berlin sowie Mitarbeit am Projekt „Biographien bedeutsamer Biologen“, hrsg. von W. Plesse, Berlin 1979 (3. A. 1986).
Lite: Zur Gesamtheit aller A- u. B-Aspiranturen des Ley-Wessel-Lehrstuhl am Inst./Sekt. für Phil. der HUB vergl. die vollstg. Aufstellung ders. für die Jahre 1958–2004 (es waren schließlich insgesamt 325 A- und B-Promotionen nachweisbar, zusammengestellt von H.-C. Rauh). In: H. Laitko u. a. (Hrsg.): Hermann Ley – Denker einer offenen Welt. Berliner Studien zur Wiss.-phil. und Humanontogenetik. Bd. 29. Berlin 2012.
Abusch, Alexander
14. Febr. 1902–27. Jan. 1982
Kulturpolitischer Funktionsträger der DDR-Philosophie in den 60er Jahren
Geb. in Krakau/Polen in einer jüd. Händlerfamilie u. 1916–19 kaufmänische Lehre; in den 20er Jahren vielfältige pressered. Tätigkeit u. 1935–39 Chefred. des KPD-Auslandsorgans (Prag und Paris) Die Rote Fahne; in Frankreich interniert und 1941–1946 Emigration nach Mexiko; Juli 1946 Rückkehr nach Dtl. u. mehrjährige Wirksamkeit im ostdt. Kulturbund; ab 1953 pol. Mitarbeiter in der ZK-Abt. für Kultur, zuständig für das Verlagswesen der DDR sowie im Ministerium für Kultur 1954–61 Staatssekretär, 1. Stellvertreter und Minister für Kultur 1958/61 (in Nachfolge von Johannes R. Becher) sowie 1961/71 im DDR-Ministerrat als 1. Stellv. Min.-präsident verantwortlich für Kultur und Erziehung; insofern unmittelbar wirksam bei den ersten offiziellen Staatsparteijubiläen (nach Goethe 1949 sowie Schiller 1955), nun auch zu Fichte (1962) sowie Hegel (1970); danach verlagerte sich diese phil. Jubiläumskultur u. pol. Beaufsichtigung der marx.-len. DDR-Philosophie weitgehend in den Verantwortungsbereich der SED-ZK-Abteilung Wissenschaft u. Kultur unter der langjh. Ltg. von Kurt *Hager, dem sog. „DDR-Philosoph Nr. 1“ (Hegel-Jubiläum 1981, Marx-Jubiläum 1983); A. wirkte daraufhin wieder im Kulturbund der DDR als dessen „Ehrenpräsident“. Festschrift z. 70. Geb. Berlin 1972; verstarb fast achtzigjährig 1982 in Berlin; 2 autobiogr. Memoirenbände 1981 u. 1986. Zugleich wurde 1986 eine Straße in Berlin-Hellerdorf nach ihm benannt, seit 1992 sinnigerweise jedoch wieder umbenannt in Peter-Huchel-Straße.
DDR-Personen-Lexikon 2010 (K. Hartewig/B.-R. Barth).
Publ.: (Mithrsg.): Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror. Paris 1933; Irrweg einer Nation. Mexiko 1945 u. Berlin 1946 (8. erw. A. 1960); Stalin und die Schicksalsfragen der deutschen Nation. Berlin 1949 (3. erw. A. 1952); Sieg der Zukunft. Die Sowjetunion im Werk dt. Schriftsteller. Berlin 1952/53; Von der Wiss. und Kunst der Sowjetunion schöpferisch lernen. Vortrag. Berlin 1953; Hrsg. von Friedrich Schillers Gesammelte Werke, Bd. 8 enthält dessen Philosophische Schriften. Berlin 1955; Schiller. Größe und Tragik eines dt. Genius. Berlin u. Weimar 1955 (8. A. 1984); Im ideolog. Kampf für eine sozialistische Kultur (SED-Kulturkonferenz, Oktober 1957 in Ost-Berlin); Schillers Menschenbild und der sozialistische Humanismus. Rede zur Nationalen Schiller-Ehrung am 10. Nov. 1959 in Weimar. Berlin 1960; Wissenschaft und Technik dienen in unserer Gesell. dem Menschen, Festrede am 10. Mai 1961 zur Gründung der TH Otto von Guericke Magdeburg. Hochschulreden Nr. 1; Unsere Epoche erfordert Humanisten der Tat. Rede zur 300-Jahrfeier der Dt. Staatsbibl. zu Berlin am 24. Okt. 1961 (Sonderdruck); Johann Gottlieb Fichte u. die Zukunft der Nation. Rede zur nationalen Fichte-Ehrung am 17. Mai 1962 in Berlin; Die hohe Aufgabe der Dt. Nationalbibl. Rede zur 50-Jahrfeier der Dt. Bücherei Leipzig am 3. Okt. 1962 (Sonderdruck); (Mithrsg.): Walter Ulbricht. – Schriftsteller, Künstler, Architekten, Wissenschaftler u. Pädagogen zu einem 70. Geb. (283 S.) sowie z. 75. Geb. (389 S.). Berlin u. Weimar 1963 bzw. 1968 (darin jeweils als einziger DDR-Phil. G. Klaus zum Thema: „Angewandte Dialektik“); Zwanzig Jahre Kulturbund im Kampf für die geistige Wiedergeburt der dt. Nation. Rede am 26. Juni 1965 in Leipzig. Berlin 1965; Jena, eine meiner Universitäten. Erkenntnis und Gestaltung im künstlerischen Schaffen. Ehrenpromotion der Phil. Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena am 31. Jan. 1967. Jenaer Reden u. Schriften, H. 8/1967; Lenin – Hirn und Herz der sozialistischen Revolution. Rede auf der Lenin-Tagung der Kulturschaffenden unserer Republik am 27. Febr. 1970 in Berlin (Kongresshalle); Hegels Werk in unserer Zeit. Rede des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR auf dem Festakt des Hegel-Komitees der DDR zum 200.
Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, gehalten am 26. August 1970 in der Humboldt-Universität zu Berlin; Tradition u. Gegenwart des sozialistischen Humanismus (Buhrsche Kritik-Reihe, Nr. 2). Berlin 1971; Entscheidung unseres Jhd. Beiträge zur Zeitgesch. 1921–76. Berlin 1977; Die Welt Johannes R. Bechers. Arbeiten aus den Jahren 1926–1980. Berlin 1981; Der Deckname. Memoiren. Berlin 1981; Mit offenem Visier. Memoiren 1941–1971. Berlin 1986.
Ackermann, Anton
25. Dez. 1905–4. Mai 1973
Parteipol. Funktionsträger in den Anfangsjahren der ostdt. Kulturentwicklung
Geb. in einer Textilarbeiterfamilie in Thalheim (Erzgeb.); 1920 KJVD und 1926 KPD-Mitgl.; 1929–31 Besuch der Internationalen Lenin-Schule in Moskau und 1931–33 daselbst Aspirant; 1933 zur illegalen Arbeit nach Berlin geschickt u. 1935 über Prag nach Paris (1937–40) emgr.; ab 1940 wieder zurück in Moskau und 1943 im NKFD eingesetzt; 1944/45 Mitwirkung an der Ausarbeitung von progm. Dokumenten der KPD für die (ostdt.) Nachkriegszeit; 1945 sowjet. Kampf-„Orden des Roten Sterns“; wichtigster SED-Kulturpolitiker der Ersten Stunde; in der Gruppe *Ulbricht zurückgekehrt nach Dtl. am 1. Mai 1945 und Mitglied der ersten zentralen Leitungsgremien (PV bzw. ZS) der SED ab 1946; von komm. Vorstandsseite verantwortlich für die Partei-Schulung, Kultur, Volksbildung, Hochschulen, Presse und Rundfunk; damit der erste Kultur- und Ideologiechef der SED, vorbereitend die später allmächtige ZK-Abt. Wiss. und Kultur, danach angeführt von Fred *Oelßner u. schließlich von Kurt *Hager; zugleich auch noch (neben anderen staatlichen und Parteifunktionen) kurzzeitig bis Aug. 1953 Direktor des Marx-Engels-Lenin-*Stalin-Institut (späteres IML), an dem zu dieser Zeit gerade mit der massenhaften Herausgabe aller 4 ML-Klassiker-Werke von *Stalin, Lenin, Engels u. Marx (genau in dieser Reihenfolge!) begonnen wurde, wofür im einzelnen und zu dieser Zeit aber auch noch andere, ebenso russifizierte u. stalinistische Sowjet-Emigranten in der Parteiebene (Hanna *Wolf und Helene *Berg) wie in der (Ostberliner) Deutschen ZW für Volksbildung (Paul *Wandel) – als damals noch verh. Ehepaar – verantwortlich waren; 1946/47 zahlreiche Lektionen an der PHS Karl Marx u. kulturpol. Grundsatzreden, sowie mit Hermann *Dunker u. Klaus *Zweiling auch Parteischullehrer beim 1. Philosophie-Doz.-Lehrgang 1948 ebenda; nach dem pol. Abfall Titos von *Stalin 1948 erzwungene „selbstkritische“ Zurücknahme u. Absage an jeden eigenen bzw. „besonderen dt. Weg zum Sozialismus“; 1953/54 deswegen schließlich Ausschluß aus dem ZK der SED u. Enthebung aller parteistaatl. Funktionen im Zusammenhang mit der parteiamtl. Ausschaltung von Rudolf Herrnstadt u. Wilhelm Zaisser, die er gegen *Ulbricht „parteifeindlich“ unterstützt hatte; 1954–58 Leiter der HV Film im Min. für Kultur (Minister ist in dieser Zeit Johannes R. Becher); 1956 wieder parteiintern rehabilitiert, aber bereits 1961 krankheitsbedingt invalidisiert; 1970 letzte hohe Auszeichg. u. im Mai 1973 Suizid, weil unheilbar krebserkrankt. 1979 wird in seiner Geburtsstadt eine Polytechn. OS nach ihm benannt, nach 1990 wieder abgelegt, u. 1985 noch mit einer DDR-Briefmarke geehrt, doch erst 1988 in einer letzten marx.-len. DDR-Philosophiegesch. der Partei-Aka. für Gesell.-wiss. beim ZK der SED erstmalig wieder sachgerecht erwähnt.
DDR-Personen-Lexikon 2010 (B.-R. Barth).
Publ.: Der Kampf der KPD u. die junge Generation. Moskau 1936; An die lernende und suchende dt. Jugend. Dtl. Weg zum Wiederaufstieg und zur Einheit. Berlin 1946; Gibt es ei...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Einführung
- Personenverzeichnis
- Statistische Gesamtübersicht
- Abkürzungsverzeichnis
- Quellen-Verzeichnis
- Namensregister