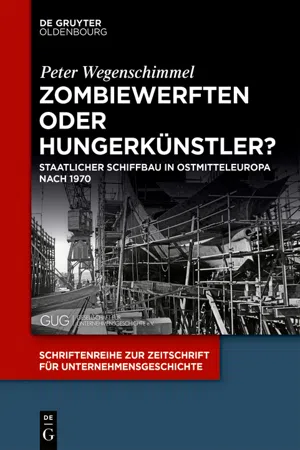Unternehmen, die öffentliche Gelder erhalten, stehen unter Generalverdacht und damit besonderer Beobachtung durch die Öffentlichkeit. Das musste auch ein Gewerkschaftsfunktionär erfahren, der kurz vor der Abwicklung der Werft Gdynia im Jahr 2009 versuchte, den polnischen Medien den Subventionsbegriff zu erklären:
„Wir haben lange einen Kampf mit den Medien geführt. Ohne Fragen zu stellen oder irgendeine Ahnung zu haben, informierten Journalisten die Öffentlichkeit darüber, in welcher Höhe die Werften subventioniert worden wären: So und so viele Subvention hätten sie bekommen! Ich aber spreche von Garantien. Sie [die Journalistinnen und Journalisten; P. W.] verwechseln das mit Subventionen und kommen zu einer Rechnung, derzufolge jeder Pole, vom Säugling bis zum Rentner, zwei Millionen oder so etwas jährlich zum Betrieb der Werften beisteuerte.“ (GD-T-1)
Den hier angesprochenen abweichenden Auffassungen liegt die Unterbestimmtheit des Begriffs „Subvention“ zugrunde. Wissenschaftliche Subventionsberichte unterscheiden etwa den „Subventionskern“ von „Transfers mit Subventionscharakter“1 oder arbeiten mit einem „erweiterten Subventionsbegriff“, der auch „Subventionsäquivalente“ berücksichtigt.2 Den kleinsten gemeinsamen Nenner bilden Finanzhilfen, die die Staatsausgaben erhöhen, und Steuervergünstigungen, die das Steueraufkommen vermindern. Beide Teilmengen bilden einen Kern des Subventionsbegriffes, der eine breite Grauzone zurücklässt. Indem ich einen Subventionsbegriff verwende, der sich aus den jeweiligen Unternehmensgeschichten ergibt, kann ich diese Randzonen berücksichtigen und verliere mich nicht in umständlichen Definitionsfragen. Mit einer induktiven Verwendung des Begriffs gelingt es mir, Verschränkungen zwischen Unternehmen und staatlichen Akteuren herauszuarbeiten.
Angesichts des sich ankündigenden Strukturwandels entwickelten sich Subventionen östlich wie westlich des Eisernen Vorhangs zu einem Kernbereich der Industriepolitik. Mit ihrer Hilfe wollten Politikerinnen und Politiker unrentable Unternehmen aus politischen Erwägungen am Leben erhalten. Die Zugänge zu diesem Politikfeld unterschieden sich je nach Region und historischer Periode. Zu den Variationen ist allerdings wenig bekannt, denn die Subventionspolitik ist ein historisch kaum untersuchtes Feld.3 In diesem Kapitel werden die Subventionsregime Polens und Jugoslawiens in der Folge des Einbruchs des Schiffbaumarktes in den 1970er-Jahren und ihre anschließende Transformation anhand der beiden Werften Gdynia und Uljanik untersucht. Die zentrale Frage lautet: Mit welchen Mitteln hielten staatliche Akteure die beiden unrentablen Unternehmen am Leben und wie veränderte sich die Palette der angewandten Instrumente?
1.1 Die Werft Uljanik als Hungerkünstler
So schwer die Schiffbauindustrie auch sein mag, sie hat doch eine besonders empfindliche Sensorik für globale Veränderungen. Feinfühlig reagiert sie auf Schwankungen des Ölpreises und Verschiebungen maritimer Transportrouten und „überreagiert auf fast manisch-depressive Art auf Wirtschaftszyklen“.4 Bisweilen können Störungen der Konjunktur positive Auswirkungen auf die Branche haben. So befeuerte etwa die erneute Schließung des Suezkanals im Zuge des Sechstagekrieges 1967 die Dimensionen der neu in Auftrag gegebenen Schiffe. Die Blockade des Kanals verlängerte die Transportwege und machte noch größere Frachtschiffe profitabel.
Auch die kroatische Werft Uljanik wollte an der damit ausgelösten globalen Hochkonjunktur für die Schiffindustrie teilhaben. „Wir bauen Schiffe, wie sie der Markt will“, legte der Generaldirektor Karlo Bilić seine Devise dar.5 Um den neuen Marktanforderungen gerecht zu werden, baute die Werft die Slipanlagen auf der Insel gegenüber dem antiken Augustus-Tempel aus und profilierte sich mit einer Technik, bei der zwei Rumpfhälften unter Wasser zusammengeschweißt werden. Im Jahr 1974 stellte Uljanik drei Tanker für skandinavische Reedereien mit einer Tragfähigkeit von insgesamt 776.560 Tonnen fertig und erreichte damit einen bis zum Konkurs gültigen Produktionshöchststand. Zum ersten Mal produzierte die kroatische Werft Mammutschiffe mit einer Tragfähigkeit von mehr als 85.000 Tonnen. Die hochgesteckten Erwartungen der Schiffbauer – „Große Schiffe – großer Gewinn“6 – wurden allerdings schon bald enttäuscht. Auch in diesem Jahr verbuchte das Unternehmen einen Verlust und setzte damit eine verheerende Serie der späten 1960er-Jahre fort, die durch Liquiditätsprobleme und einen Streik gekennzeichnet war.7 Ein Journalist fasste die Situation in der Unternehmenszeitung Vjesnik Uljanika zusammen: „Das größte Problem der Finanzgeschäfte der letzten Jahre war das Problem der mehr oder weniger kontinuierlichen Illiquidität, und wir erwarten, dass wir auch dieses Jahr mit demselben Problem kämpfen werden.“8
Der Politikwissenschaftler Besnik Pula bezeichnete die 1970er-Jahre als „die einschneidende Transformationsdekade für sozialistische Volkswirtschaften“.9 Allen voran Jugoslawien öffneten sich die sozialistischen Länder für den globalen Markt. Während bis dahin jugoslawische Reedereien und die sowjetische Außenhandelsorganisation Sudoimport die Verkaufsportfolios Uljaniks dominiert hatten, bekam die Werft nun die Zähne des freien Wettbewerbs zu spüren. Mit dem Eintritt in das Segment der hart umkämpften Mammutschiffe war Uljanik in eine chronische Illiquiditätsspirale geschlittert. Die Ausrichtung auf internationale Reedereien und den globalen Markt stärkte das Ansehen der Werft als jugoslawischer Devisenbringer. Gleichzeitig aber machte die Globalisierung die Werft verwundbar, denn Störungen der Globalwirtschaft hinterließen prompt Dellen auf dem Schiffbaumarkt. Die langen Produktionszyklen im Schiffbau verstärkten die sektoralen Auswirkungen von solchen Krisen.
Der Ölpreisschock von 1973, die Wiederöffnung des Suezkanals ein Jahr später und die Erschließung neuer Ölfelder in der Nähe industrieller Zentren in der Nordsee, in Indonesien und Algerien hatten den Schiffbaumarkt in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre in sich zusammenbrechen lassen.10 Der Dollarkurs stürzte ab und der Stahlpreis zog an. Während 1971 in allen Werften der Welt in Summe Schiffe mit mehr als 66 Mio. dwt11 geordert wurden, waren es 1978 nur noch rund 22 Mio. dwt.12 Die Rezession hatte andere Länder härter als Jugoslawien getroffen. Nicht zuletzt aufgrund der verheerenden Auftragslage bei den britischen, deutschen und schwedischen Werften konnte Jugoslawien seine Marktposition im internationalen Vergleich sogar ausbauen. 1978 besetzte Jugoslawien 2,9 % der globalen Schiffbauproduktion und lag damit in den Rankings der Lloyd’s List auf dem dritten Platz hinter Japan und Südkorea.
In ganz Europa setzten die Regierungen auf Subventionen, um den Einbruch des Marktes zu kompensieren und die befürchteten sozialen Folgen zu lindern.13 Die britische Regierung umgarnte die Reedereien mit dem sogenannten „home credit scheme“.14 Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft versuchte, durch ein Abwrackprogramm und weitere Anreize für Neubauten mit hohen Umweltauflagen die Konjunktur wieder anzuregen.15 Auch in Jugoslawien führte die Krise des Schiffbaus zu protektionistischen Maßnahmen und damit zu einer temporären Rücknahme des neu eingeleiteten Globalisierungsprojekts. Symptomatisch in dieser Hinsicht ist der erste Beschluss des Arbeiterrates nach der Neukonstitution des Geschäftsverbands Jadranbrod:
„Die Mitglieder des neuen Arbeiterrates beschlossen, die zuständigen Behörden und die Republikbehörden dringend zu ersuchen, endlich das genaue Datum festzulegen, an dem sie [die heimischen Werften; P. W.] systematisch Schiffe für ihre Flotte bauen dürfen, während in der Zwischenzeit jeder Import von Schiffen verboten wird.“16
Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Werften entschieden sich bewusst dafür, in dieser Krisensituation staatliche Akteure ins Boot zu holen. Dem Arbeiterrat Jadranbrods lag ein protektionistischer Lösungsansatz näher als etwa Produktivitätserhöhungen und damit verbundene Rationalisierungen oder gar Kontraktionen, wie sie zur glei...