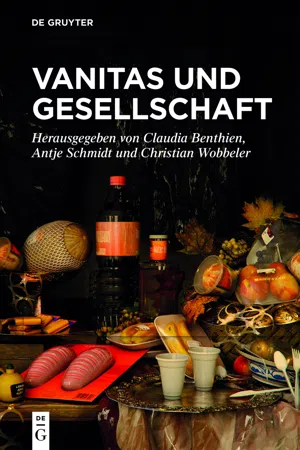Finalität und Frist – in Barock und Gegenwart
In der Zeitanthropologie der späten Moderne, so der Philosoph Odo Marquard, wird Zeit „wie nie zuvor radikal zur Frist: als endliche Lebenszeit des einzelnen Menschen“1. Dieser Fristgedanke lässt sich unmittelbar mit dem frühneuzeitlichen Konzept der Vanitas in Verbindung bringen, denn auch dieses beruht auf einem solchen Zeitkonzept.2 Sein zentrales literarisches Merkmal ist die Antizipation des Todes in der Jetztzeit, wie es besonders die Lyrik des Barock performativ gestaltet.3 Die Temporalität der Vanitas ist paradox, weil Linearität und Dauer durch eine Überblendung von gegenwärtigem Leben und zukünftigem Tod in Frage gestellt werden. Denn der Denkfigur der Vanitas zufolge ist das irdische Leben eine bloße ‚Frist‘: eine äußerst kurze Zeitspanne, die wie der Sand in einem Stundenglas unaufhaltsam verrinnt und zu einem unbestimmten, immer als nah gedachten Zeitpunkt unvermittelt endet. Im Barock war diese Unvorhersehbarkeit und Plötzlichkeit des Todes aufgrund von Krankheiten, Seuchen, mangelnder Gesundheitsversorgung, Kindersterblichkeit, Krieg und Gewalt sehr real. Sie war zugleich Teil einer christlichen Rhetorik, wonach sich die Gläubigen einerseits stoisch gegen Verlusterfahrungen und Todesängste wappnen sollten – unter anderem durch den Gestus der Weltverachtung (contemptus mundi) –, die andererseits aber das Jenseits als utopische Gegenwelt zur Kürze und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens idealisiert hat. Die himmlische ‚Ewigkeit‘ wurde als „Zeit=befreyte Zeit“4 imaginiert, wie es die Barockmystikerin Catharina Regina von Greiffenberg formuliert hat. In Anknüpfung an das alttestamentliche Buch Kohelet, dem der Vanitas-Gedanke ursprünglich entstammt,5 wurde der flüchtigen Lebenszeit des Menschen im Barock die zeitenthobene ‚Ewigkeit‘ kontrastiert, wie es zum Beispiel Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau in seinem Gedicht „Vergänglichkeit“ gestaltet hat.6 Vanitas wird hier mit Attributen der Scheinhaftigkeit, Schnelligkeit und Flüchtigkeit (von Affekten) besetzt; demgegenüber werden der Ewigkeit Attribute der Beständigkeit und Festigkeit zugeschrieben. In manchen literarischen Texten wird die im Gegensatz zur kurzen Lebenszeit als unendlich gedachte Dauer sogar sprachlich erfahrbar gemacht, etwa in den Versen „Ach ich meyn die Ewig=Ewig=Ewig=Ewig=Ewigkeit/ | in die der belebend Tod wird entleibend einverleiben“7, wie es Greiffenberg recht paradox in ihrem Sonett „Verlangen/ nach der herrlichen Ewigkeit“ gefasst hat. Ein weit bekannteres Beispiel ist der Prolog der ‚Ewigkeit‘ aus Andreas Gryphius’ Trauerspiel Catharina von Georgien, in dem eine Personifikation der aeternitas auf den Schauplatz tritt und alle menschlichen Anstrengungen, sich dem Vergehen von Zeit entgegenzustellen, als vergeblich entlarvt.8
Vor dieser frühneuzeitlichen Folie eines dualen Zeitkonzepts aus flüchtiger irdischer Lebenszeit und ewiger himmlischer Zeit lässt sich die ‚Trostlosigkeit‘ heutiger säkularer Vorstellungen ermessen. Nach Marquard, der sich zwar nicht auf das Barock, aber mittelbar auf christliche Zeitvorstellungen bezieht, existieren heute zwei grundlegend verschiedene Formen des Denkens über das Lebensende, das entweder als ‚Ziel‘ oder als ‚Tod‘ verstanden wird – anders gesagt: „[E]s gibt das Ende als Vollendung und das Ende als Endlichkeit, es gibt die Finalität und die Mortalität.“9 Das erste Konzept – das Ende als Ziel, Vollendung, Finalität – ist religiös konnotiert und lässt sich mit den skizzierten christlichen Vorstellungen des Barock verbinden, das zweite Konzept – das Ende als Tod, Endlichkeit, Mortalität – ist demgegenüber säkular. Vergänglichkeit und Tod werden heute zumeist, anders als im religiösen Verständnis vergangener Epochen, nicht mehr als teleologische Vollendung oder als erfüllte Finalität, sondern als bloße Endlichkeit, als erlittene Mortalität begriffen, als ein beständig über dem Leben schwebendes „dunkles und fremdes Verhängnis“10.
Marquard bezieht sich bei seinen Ausführungen auch auf die Unterscheidung des Philosophen Hans Blumenberg zwischen der unfasslich langen, objektiven „Weltzeit“ und der subjektiven „Lebenszeit“ als „ultrakurze[r] ‚Episode‘ […] limitiert durch den Tod, der unerbittlichen Grenze“.11 Blumenberg habe „die Endlichkeit der menschlichen Lebenszeit […] zum zentralen Zeitproblem“12 erhoben. Marquard verweist ferner auf den Fundamentaltheologen Johann Baptist Metz, der die „Entfristung“ der Weltzeit theologisch reflektiert hat, und bemerkt:
Erst wo sie ihre eschatologische Finalität als Heilszeit – als befristeter Weg zum erlösenden Ende, zur ‚Erfüllung der Zeit‘, als Frist zum Heil – verliert, kann die Weltzeit zu jener (wie Metz sagt) ziellos ‚offenen‘ und ‚evolutionär entfristeten Zeit‘ werden, die die moderne – physikalisch orientierte – Kosmologie geltend macht […].13
Metz selbst stellt dar, dass christlich gesehen „zwei Zeitbotschaften einander gegenüber“ stehen: „zum einen die aus den biblischen Traditionen herkünftige, in die Moderne hineinwirkende und auch die Moderne hintergründig strukturierende Botschaft von der befristeten Zeit und zum anderen die Botschaft von der fristlosen Zeit, kurzum von der Ewigkeit der Zeit“.14 Dies lässt sich anhand der Barockgedichte gut nachvollziehen. Marquard bezieht sich jedoch nicht auf das hier zitierte, 2006 erschienene Buch von Metz, sondern auf einen Vortrag von 1987.15 Außerdem ist hervorzuheben, dass Metz die Begriffe ‚Finalität‘ und ‚Frist‘ in seiner späteren Publikation anders als bei Marquard zitiert versteht. Somit ergibt sich folgender Unterschied: Bei Marquard gilt (erfüllte) Finalität für Menschen als unerreichbar, bei Metz bleibt sie in heilsgeschichtlicher Hinsicht möglich, allerdings bezeichnet er diese „Zeit mit Finale“ zugleich als „Zeit mit Frist, als befristete Zeit“,16 während Marquard den Fristgedanken eher negativ deutet – im Sinne eines über dem Leben schwebenden Damoklesschwerts. Genau genommen werden also von den Philosophen Marquard und Blumenberg sowie dem Theologen Metz drei Zeitbegriffe verhandelt: der traditionell christlich-theologische (Finalität, Vollendung), der naturwissenschaftlich-moderne (entfristete/fristlose Zeit; bei Metz verwirrenderweise auch ‚Ewigkeit‘ genannt) sowie der anthropologisch-philosophische (Frist, Endlichkeit, Mortalität). Diese Differenzierung ist, wie schon angedeutet, neuzeitlich, denn in der Frühen Neuzeit galt die christliche Vorstellung von Finalität als Eingehen in die (göttliche) Ewigkeit. Sowohl in der Frühen Neuzeit als auch in der Gegenwart gab und gibt es mithin zwei dominante Denkweisen von Zeit, eine der unendlichen Dauer und konträr dazu eine der radikalen Kürze.
Marquard geht im Anschluss an Blumenberg davon aus, dass die „moderne Entdeckung der ‚entfristeten‘, der ‚offenen‘ Weltzeit den Fristcharakter der Zeit nicht etwa zum Verschwinden [bringt]“, sondern ihn im Gegenteil radikalisiert, „indem sie ihn nun ganz und gar in jene Zeit verlagert und konzentriert, die für uns Menschen am unvermeidlichsten Frist ist: in die endliche Lebenszeit unseres eigenen Lebens, in das also, was Hans Blumenberg als jene ‚Episode‘ charakterisiert, die jeder von uns ist“.17 Recht ähnlich hat auch der Philosoph Jean-François Lyotard dies formuliert: „Das Leiden am Fehlen der Finalität ist der postmoderne Zustand des Denkens, also das, was man heute gemeinhin seine Krise, sein Unbehagen oder seine Melancholie nennt.“18 Die philosophisc...