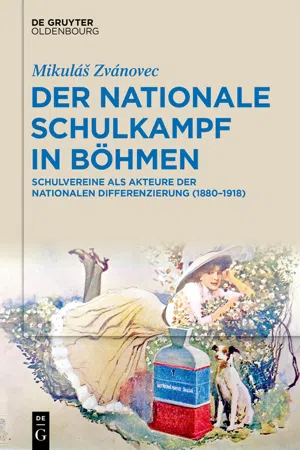1.1 Identitätskrise und Bedeutung des Schulwesens im 19. Jahrhundert
Der Anfang des Prozesses des Verschwindens alter Loyalitäten und ihr Ersatz durch den nationalen Gedanken2 ist eng mit der Ära des aufgeklärten Josephinismus verbunden, der auf der allmählichen Befreiung des Menschen aus den ständischen Gesellschaftsstrukturen basierte. Der von der Kaiserin Maria Theresia 1774 eingeführten allgemeinen Schulpflicht wurde durch das josephinische Toleranzpatent und die Aufhebung der Leibeigenschaft die Funktion eines allgemeinen intellektuellen Befreiers vom weltlichen Herrscher ebenso wie von der Kirche zuteil. Die pragmatische Zentralisierung des Staats- und Schulwesens durch eine gemeinsame Staats- und Unterrichtssprache unter Joseph II. gab jedoch dem österreichischen Schulwesen – trotz des Unmuts einiger Kronländer – bereits vor der Französischen Revolution von 1789 einen formal deutschen Charakter.3 Die normierende und vereinheitlichende Wirkung des staatlichen Schulwesens folgte allein politischen Zielen des Herrschers.
An den Werken bedeutender deutscher Philosophen jener Zeit, vor allem Johann Gottfried Herder4 und Johann Gottlieb Fichte5, ist ersichtlich, dass sich der Kern des aufklärerischen Interesses am Konzept des „Volksgeistes“ ansiedelte, für den die eigene Muttersprache „das Allerheiligste“ darstellte. Damit ging die starke Bildungsorientierung mit der Forderung nach „nationaler Erziehung“ einher. Dies führte zur schrittweisen Herausbildung des Konzeptes einer Sprachnation, die die eigene Volkssprache zum entscheidenden Identifikationskriterium machte. Dieses Konzept unterschied sich daher vom konservativ-feudalen landesbezogenen Patriotismus, bei dem Sprachen keine Rolle spielten. In Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ (1808) findet sich bereits eine entschiedene Ablehnung des Bilingualismus, die durch die prägnante Formel: „allenthalben, wo eine besondere Sprache angetroffen wird, [ist] auch eine besondere Nation vorhanden“ ausgedrückt wird.6 Diese Gedanken erhielten an der Schwelle zur Moderne ihre Begründung bei den zahlreichen Völkern bzw. Sprachgemeinschaften des am Abgrund stehenden und 1806 definitiv aufgelösten Heiligen Römischen Reiches. In dessen Ländern wird 1815 nach den Napoleonischen Kriegen der Deutsche Bund geschaffen, der allerdings als eine relativ lose Gruppierung von Staaten nicht im Stande war, auf die Identitätskrise nach dem Zerfall des einstigen Reiches effektiv zu reagieren.7 In jener Zeit wird bereits für eine moderne Sprach- und Kulturnation seitens jener intellektuellen Kreise, Bildungsbürger wie auch Studenten plädiert und auch demonstriert, wie sich während des Vormärz und vor allem der Revolutionszeit von 1848/1849 zeigte.
Worin bestand jedoch die enorme „Obsession mit dem Schulwesen und dessen physicher Verkörperung – der Schule?“8 Die Pflege des eigenen säkularisierten einsprachigen Schulwesens ist 1848 und endgültig 1867 zu einem allgemein garantierten Grundsatz geworden und die daraus entstandene Frage des nationalen Schulwesens wurde zu einem zentralen Politikum in den böhmischen Ländern. Diese Affinität der nationalen Bewegungen zum Bildungswesen war somit nicht allein durch die ökonomischen Ansprüche der neuen Zeit bestimmt, sondern hing sehr eng mit dem kulturell orientierten Volksbegriff zusammen, der für das deutsche wie auch tschechische „nation building“ so prägend werden sollte.9 Die konkrete Ausprägung des nationalen Selbstverständnisses sollte vor allem auf der Ebene von Deutungs- und Vermittlungsinstitutionen erfolgen, denen wichtigster Vertreter jedenfalls das Schulgebäude war, aber auch die Wissenschaft und die modernen Medien sowie Visualisierungs- und Musealisierungstechniken beinhaltete.10
Eine besondere Pflege dem Ausbau des nationalen Schulwesens widmeten die sich nach 1867 konstituierten nationalen Schutzvereine, die in ihren Propagandablättern, Zeitungsartikeln wie auch in der Korrespondenz zwischen der Hauptleitung und den Ortsgruppen die enorme Bedeutung des Schulwesens akzentuierten, was mit der politischen Rolle der Schulen bei der Durchsetzung sprachlich-nationaler Forderungen übereinstimmte. Berichte wie z. B. „In der Gemeinde Pschiwosten (Přívozec u Blížejova) wurde durch die gemeinsame Subvention der ÚMŠ und der Národní jednota pošumavská die Gefahr einer deutschen Schule abgewandt“11 wurden regelmäßig veröffentlicht, wobei sich diese oft auf die Meldungen der Vereinsortsgruppen stützten. So referierte z. B. die Ortsgruppe des DSV in Mies (Stříbro) der DSV-Hauptleitung in Wien über die erfolgreiche Erbauung von Schulhäusern im Gerichtsbezirk Mies (Stříbro) folgendermaßen: „Nur anhaltender und umsichtiger Arbeit ist es zu danken, alle die Angriffe, welche teils versteckt auf Umwegen, teils ganz offen erfolgten, abzuwehren und durch die Erbauung von schönen deutschen Schulen in Wranowa, Hermannshütte, Wrbitz, Piwana u.[nd] Sittna der tschechischen Eroberungslust einen Damm entgegenzustellen.“12 Schulerrichtungen in national umstrittenen Gebieten enthielten einen erheblichen Konfliktstoff und die Minoritätsschulgebäude wurden zum wahren Symbol des nationalen territorialen Anspruchs. Während das Schulgebäude für die Einen ein „Bollwerk der [eigenen] Kultur“13 oder etwa ein „Palladium [des] Volkstums“14 bedeutete, war sie den Anderen etwa eine „feindliche Zitadelle“15 oder gar ein „Pfahl im Fleische“.16 Durch die nahezu religiöse Affinität zu Schulen wurde jedweder tatsächlicher oder vermeintlicher national-motivierter Angriff auf ein Schulgebäude dementsprechend emotional hochgespielt.17
Die Schutzvereine wollten die historisch gewachsene Bedeutung ihres Schaffens bestätigt wissen: „Die Schule und das Schulhaus ist für die nationalen Parteien von heute dasselbe, was die Kirche und das Kirchengebäude für die religiösen Parteien vor Ausbruch des 30jährigen Krieges.“18 Dieses Selbstbewusstsein geht jedenfalls nicht nur aus den zeitgenössischen Quellen klar hervor, auch die Geschichtswissenschaft sieht klar die Bedeutung der Bildung für die nationale Bewegung. Wiederholt wurde auf den interessanten Nebenaspekt hingewiesen, dass der deutsch-tschechische nationale Wettbewerb im Bildungssektor einen erheblichen Beitrag dazu leistete, dass insbesondere die Sprachgrenzregionen der böhmischen Länder zu denjenigen Regionen der Habsburgermonarchie wurden, in denen die Bevölkerung den besten Zugang zur Bildung hatte und wo die Analphabetenquote eine der geringsten im Habsburgerreich wurde.19
1.2 Entwicklung des bürgerlichen Vereinswesens
Die Anfänge des modernen völkischen Vereinslebens sind in der preußischen Turnbewegung im Rahmen der sog. „Befreiungskriege“ zu sehen. Nach dem Krieg bei Jena 1806 und nach der Besetzung Preußens durch französische Truppen baute der „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn in Berlin die erste Organisation der Deutschen Turnerschaft auf, die als einer der ersten nationalen Schutzvereine im modernen Sinne gedeutet werden kann, der auch den Begriff des „Volkstums“ erfüllen wollte und seine Tätigkeit kontinuierlich auf dessen Implementierung ausrichtete. Zwar wurde zur Zeit der Restauration das Turnen eingeschränkt, doch nahmen die deutschen Turner an den revolutionären Geschehnissen von 1848/1849 aktiv teil.20 Sie förderten die deutsche Einigung, wenngleich sie an der Einbindung Österreichs zweifelten, wovon die Erklärung Jahns zeugt: „… allerzeit wird es den Österreichern misslingen, ihre Staatsbrüder zu verdeutschen, ein so herrlicher Kraftstamm auch der Deutsch-Österreicher ist, ein so ausgezeichnetes in Glück und Unglück gewiegtes Fürstenhaus auch die Länder und Staaten zusammenhält.“21 Damit deutete Jahn die als deutlich schwerer empfundene Position der deutschen Nationalbewegung in der Habsburgermonarchie an, die sich von Machtaspirationen nichtdeutscher Sprachgruppen beschränkt und schließlich auch bedroht sah. Neben Turnern waren es auch die deutschen Studentenverbindungen (Burschenschaften), die zu den aktivsten Trägern des deutschen Liberalisierungs- und Nationalisierungsforderungen wurden, was auch ihnen Konflikte mit der absolutistischen Staatsmacht bereitete. Dies zeigt sich deutlich an den im Deutschen Bund beschlossenen „Karlsbader Beschlüssen“, die nicht nur Beschränkung im akademischen Bereich (Berufsverbote für Professoren, Überwachung von Universitäten), sondern auch die Schließung der Turnplätze im Rahmen der sog. „Turnsperre“ in den Jahren 1820–1842 mit sich brachten.22
Wegen des Misstrauens der Staaten des Deutschen Bundes gegenüber den bürgerlichen Assoziationen wurden Vereinsgründungen wie etwa von Lesegesellschaften, Geselligkeitsklubs und Casinos im Habsburgerreich bis in die späten 1830er-Jahre verzögert, Mitte der 1840er-Jahre waren sie in den böhmischen Ländern aber schon stark verbreitet, insbesondere ging es um Wissenschafts-, Mäzen-, Industrie- und Gewerbevereine auf utraquistischer Grundlage. Die überhaupt älteste Gelehrtengesellschaft war die kurzlebige Societas incognitorum eruditorium in Olmütz (Olomouc) (1746). Später folgten die Königliche Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften (1784), die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Böhmen (1796), die Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen (1822) und die Gesellschaft zur Ermunterung der Industrie in Böhmen (1833), wobei diese Organisationen zwar einen sprachlich deutschen, aber noch keinen ausgeprägten nationalen Charakter hatten.23 Es entstanden auch die ersten Vereine zur Pflege der eigenen Sprache und Literatur wie vor allem die Matice Česká (1831), deren Gründung auf die Initiative von František Palacký, dem späteren tschechischen Revolutionsführer, zurückzuführen ist.24 Die sich anbahnende sprachlich-nationale Differenzierung, die in der Regel von der tschechischen Seite ausging,25 brachte in der Folgezeit weitere ausschließlich tschechische Vereinsgründungen, wozu vor allem die seit 1845 gegründeten Bürgerklubs (Měšťanská Beseda) gehörten, die als Zentren des sich formierenden tschechischen kulturellen Vereinslebens fungierten.
Als die tschechische Politik mit František Palacký an der Spitze sich 1848 weigerte, an der Wahl für das revolutionäre konstitutionelle deutsche Vorparlament in Frankfurt am Main und somit am deutschen Einigungsprozess teilzunehmen, zeigte sich am Vereinswesen sofort die Inkompatibilität der beiderseitigen national-politischen Forderungen. Sie kommt in der Entstehung einer Reihe politischer Vereine wie der Slawischen Linde (Slovanská Lípa), des St.-Wenzels-Ausschusses, des radikalen Repeal-Clubs, der Böhmisch-Mährischen Bruderschaft, des deutschen Konstitutionellen Vereins, des Vereins Markomannia oder des Vereins der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien zur Aufrechterhaltung ihrer Nationalität mit Sitz in Wien zum Audruck, wobei vor allem dem letzeren die Vorgängerschaft der künftigen nationalen Schutzvereine beigemessen wurde.26 Die tschechischen und deutschen Studenten manifestierten ihre nationalliberalen Forderungen auch im Rahmen von national getrennten Lesegesellschaften.27
Nach dem Scheitern der liberalen Revolution wurden mit den Silvesterpatenten von 1851 die Grundsätze der Gleichberechtigung und der Versammlungsfreiheit bald wieder aufgehoben. Sie wurden 1852 durch das Kaiserpatent ersetzt, das offiziell noch strenger als die allererste Vereinsregelung von 1843 gegen die Vereine vorging und eine stärkere Abhängigkeit des gesamten Vereinswesens von der Wiener Regierung mit sich brachte. Trotzdem kam es bereits in dieser Zeit zu einer „Hochflut von Vereinen“28, vor allem geselliger, religiöser und wirtschaftlicher Art, die ...