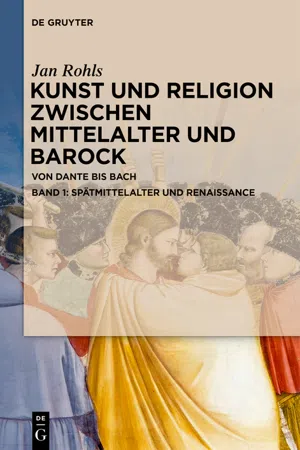Die „Göttliche Komödie“
Dante verfasste die „Divina Commedia“, nachdem er 1302 als Opfer der politischen Parteienkämpfe aus seiner Heimatstadt Florenz verbannt worden war. Die Stadt am Arno, damals zu einer der größten europäischen Städte angewachsen, war in der Vergangenheit vom Streit zwischen den kaisertreuen Ghibellinen und den papsttreuen Guelfen heimgesucht worden. Als die Guelfen schließlich die Oberhand behielten, rächten sie sich an ihren Gegnern, indem sie sie aus der Stadt vertrieben. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts brach der Konflikt jedoch erneut aus, dieses Mal als Konflikt zwischen den Weißen und den Schwarzen, den Bianchi und den Neri. Die Weißen, die sich um die Familie der Cerchi scharten und Verbindungen zu den exilierten Ghibellinen unterhielten, traten für ein Bündnis der oberitalienischen Städte ein, während die Schwarzen sich der Familie der Donati anschlossen und die Stadt der politischen Herrschaft des Papstes unterstellen wollten. Als ein von Bonifaz VIII. unterstützter Umsturz in Florenz die Schwarzen an die Macht brachte, wurden die Weißen, unter ihnen außer Dante auch der Vater Petrarcas, verbannt. Dante verbrachte fortan sein Leben als Exilierter zunächst bei den Scaligern in Verona und am Ende in Ravenna, wo er auch starb. Es blieb nicht bei seiner Verbannung, sondern 1315 verurteilte man ihn in Abwesenheit zum Tode und erklärte ihn für vogelfrei. Die „Divina Commedia“ wurde von Dante im Exil verfasst. Er begann mit dem „Inferno“ wahrscheinlich 1307/08, mit dem „Paradiso“ um 1316, und vollständig ediert wurde das Werk erst nach seinem Tod von seinen Söhnen. Dante hat um 1315/16 einen Brief an seinen Veroneser Mäzen Cangrande della Scala geschrieben, in dem er diesem nicht nur das „Paradiso“ widmet, vielmehr auch einen hermeneutischen Schlüssel nicht bloß zum dritten Teil, sondern zur „Divina Commedia“ insgesamt bietet. Zwar ist Dantes Verfasserschaft des Briefes immer wieder angezweifelt worden, doch Thomas Ricklin sieht in seiner kritischen Neuausgabe des Schreibens keinen Grund, sie in Abrede zu stellen und versteht den Text als methodische Einleitung in die „Commedia“. Dante gibt in ihm zu bedenken, dass das Werk nicht eine einfache Bedeutung habe, sondern „polisemos“ sei, also über einen mehrfachen Sinn verfüge. Damit stellt er es in dieser Hinsicht auf eine Stufe mit der Heiligen Schrift, für die man bereits in der Antike die Lehre vom mehrfachen Schriftsinn entwickelt hatte. Man konnte sich dabei auf das Neue Testament selbst berufen, da ja schon Paulus die von den Stoikern für die philosophische Interpretation des Mythos ausgebildete Allegorese auf die hebräische Bibel übertragen hatte. Dementsprechend unterscheidet Dante, was das Werk der „Commedia“ betrifft, grundsätzlich zwischen zwei Bedeutungen. „Denn die erste Bedeutung ist jene, die es durch den Buchstaben hat, die andere ist jene, die es durch das vom Buchstaben Bezeichnete hat. Und die erste wird die buchstäbliche genannt, die zweite aber die allegorische oder moralische.“31 Zwar lässt sich der nichtbuchstäbliche Sinn noch weiter differenzieren, indem man gemäß der Lehre vom vierfachen Sinn der Schrift die allegorische, moralische und anagogische Bedeutung unterscheidet. Doch diese drei nichtbuchstäblichen Bedeutungen können auch unter dem Oberbegriff der allegorischen Bedeutung zusammengefasst werden. Dante differenziert dementsprechend zwischen zwei Bedeutungen des Gegenstandes der „Commedia“. „Der Gegenstand des ganzen Werkes, nur buchstäblich aufgefaßt, ist also der Zustand der Seelen nach dem Tod, absolut genommen; denn von diesem handelt und um diesen [rankt sich] der Gang des ganzen Werkes.“32 Wird der Gegenstand hingegen allegorisch aufgefasst, „ist der Mensch Gegenstand, insofern er aufgrund der Willensfreiheit durch Verdienst und Schuld der belohnenden und bestrafenden Gerechtigkeit unterworfen ist“33. Die Begegnung sowohl mit den Verdammten in der Hölle als auch mit den Seelen auf dem Läuterungsberg und im Paradies dient also ebenso wie der geschilderte Weg Dantes dem mit Willensfreiheit ausgestatteten Leser als Orientierungsmaßstab für sein eigenes Leben, so dass der allegorische Gegenstand der Mensch ist, der sich entweder für die ewige Verdammnis oder das ewige Heil entscheiden kann. Dante gibt auch den Grund an, weshalb es sich bei seiner Dichtung um eine Komödie handelt. Die Komödie – etymologisch: „dörflicher Gesang“ – unterscheide sich von der Tragödie – etymologisch: „Bocksgesang“ – stofflich gesehen dadurch, dass sie anders als die Tragödie, die ruhig beginne und erschreckend ende, mit dem Abstoßenden beginne, aber glücklich schließe. Genau das treffe jedoch auf die „Commedia“ zu, an deren Anfang die Hölle und an deren Ende das Paradies stehe. Die Absicht und das Ziel der Dichtung ist es laut Dante, „die Lebenden in diesem Leben aus dem Zustand des Elendes herauszuholen und sie zum Zustand des Glücks hinzuführen“34. Der Zweck des Werkes ist somit praktischer Natur, so dass es selbst der Ethik zuzuordnen ist, letztlich einer theologischen Ethik, da das Ziel des Handelns ja die nur durch den Hinzutritt der theologischen Tugenden erreichbare Gottesschau ist. Daher kann Dante von der „Commedia“ auch als von einem „heiligen Gedicht“ – „sacrato poema“ – sprechen35. Mit der Mischung von hohem und niedrigem Stil greift er zudem zurück auf die Bibel36.
In der Zeit nach dem ersten Weltkrieg hat Benedetto Croce sich entschieden dagegen gewandt, die „Göttliche Komödie“ nur als theologischen Roman zu lesen37. Er legte stattdessen den Akzent auf ihre Poesie. Im Hintergrund stand dabei die laizistische Skepsis des modernen Italieners gegenüber Theologie und Mittelalter. Doch unleugbar ist die „Divina Commedia“ Ausdruck religiöser Überzeugung und mittelalterlicher Theologie. Mit Recht hat daher Karl Vossler betont, dass der konstruktive Gedanke des ganzen Gedichts einer großen theologischen Spekulation gleiche38. Man hat denn auch schon relativ früh versucht, Verbindungen aufzuzeigen zwischen Dante und verschiedenen theologischen Ansätzen des Hochmittelalters. Dabei stand zunächst ganz im Sinne des aufkommenden Neuthomismus die Beziehung Dantes zu Thomas von Aquin im Vordergrund. Die Verbindung zwischen dem Dichter und dem scholastischen Theologen wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt, und zwar von dem späteren König Johann von Sachsen, der unter dem Pseudonym „Philalethes“ eine kommentierte deutsche Übertragung der „Commedia“ herausgegeben hatte. Danach verfolgte der Graubündner reformierte Pfarrer Giovanni Andrea Scartazzini diese Verbindung, und Martin Grabmann versuchte, sie historisch zu spezifizieren, als er Dante mit dem Dominikaner Remigio di Girolami in Berührung brachte, der in Paris bei Thomas studiert hatte und zur Zeit des Dichters im Konvent von Santa Maria Novella in Florenz Theologie lehrte39. Die Überzeugung, dass Dante ein treuer Jünger des Aquinaten gewesen sei, fand schließlich ihren beredten Apologeten in Pierre Mandonnet40. Doch Mandonnet musste sich den Widerspruch Etienne Gilsons gefallen lassen, der mit Recht darauf hinwies, dass in der „Commedia“ nichts auf eine derart bevorzugte Stellung des Aquinaten hindeute. Zwar taucht Thomas an prominenter Stelle als Repräsentant des Dominikanerordens auf, doch ihm wird Bonaventura als Sprecher der Franziskaner zur Seite gestellt. Und damit nicht genug. Denn derjenige Theologe, der Dante zur höchsten Gottesschau leitet, ist nicht etwa Thomas von Aquin, sondern Bernhard von Clairvaux. Und im Himmel bringt Dante auch Siger von Brabant unter, einen Vertreter des von Thomas bekämpften radikalen Aristotelismus an der Pariser Artistenfakultät41. Das Verhältnis Dantes zur mittelalterlichen Theologie wird also verzeichnet, wenn man ihn zu einem glühenden Thomisten stempelt42.
Als Beatrice Dante in den Sonnenhimmel führt, nachdem sie den unteren Bereich des Paradieses hinter sich gelassen haben, stellt Thomas von Aquin dem Paar den ersten Kreis der Weisheitslehrer vor: Albertus Magnus, Gratian, Petrus Lombardus, Salomo, Dionysius Areopagita, Laktanz, Boethius, Isidor von Sevilla, Beda Venerabilis, Richard von St. Viktor und Siger von Brabant. Thomas selbst steht in diesem Kreis zwischen seinem Lehrer Albertus Magnus – wie er selbst ein Dominikaner – und seinem philosophischen Kollegen und Kontrahenten Siger von Brabant. Von Albertus führt der Kreis abwärts über Gratian, der das Kirchenrecht, und Petrus Lombardus, der das theologische Wissen systematisierte, zu Salomo, dem biblischen Ideal des Weisen. Von Salomo geht die Kreislinie dann wieder aufsteigend zu Siger von Brabant, beginnend mit Dionysius Areopagita, dessen Werk über die himmlischen Hierarchien Dantes eigene Darstellung der Engel im Paradies prägte, und Laktanz, der als Apologet des Christentums in eine enge Beziehung zu Augustin gerückt wird. Besondere Erwähnung erfährt Boethius, der die platonisch-aristotelische Philosophie dem Mittelalter weitergab. Nur genannt werden Isidor von Sevilla und Beda Venerabilis, die Enzyklopädisten zu Beginn des Mittelalters, auf die schließlich Richard von St.Viktor, der große Mystiker, folgt43. Thomas von Aquin, dem Dominikanertheologen an der Pariser Universität, wird Bonaventura gegenübergestellt, der dort zur selben Zeit den franziskanischen Lehrstuhl an der theologischen Fakultät innehatte. Er stellt die Weisheitslehrer des zweiten Kreises vor. Ihm zur Seite befinden sich Illuminat von Rieti und Augustinus, zwei der ersten Anhänger des Franziskus, gefolgt von Hugo von St. Viktor, dem wie dem Lombarden an einer Systematisierung des theologischen Stoffs gelegen war, Petrus Comestor, einem der ersten Glossatoren der Sentenzen des Petrus Lombardus, und Petrus Hispanus, der mit seinen „Summulae logicales“ ein weitverbreitetes Handbuch der Dialektik verfasste. Wie im ersten Kreis Salomo wird im zweiten Kreis der Prophet Nathan als Repräsentant der biblischen Weisheit erwähnt. Von ihm aus steigt die Kreislinie wieder auf, zunächst zu Johannes Chrysostomos als Vertreter der griechischen Theologie. Der nach ihm erwähnte Anselmus kann, da die beiden Kreise der Weisheitslehrer der historischen Ordnung folgen, nicht mit Anselm von Canterbury identisch sein. Einige denken an einen Abschreibfehler und nehmen an, dass es „Ambrosius“ statt „Anselmus“ heißen müsse. Wie mit Laktanz im ersten Kreis würde so mit Ambrosius der Schritt vom Osten in den Westen vollzogen. Der römische Grammatiker Donatus erscheint als Vertreter der artes liberales, gefolgt von Hrabanus Maurus als dem Repräsentanten der karolingischen Bildungsreform, und der Kreis schließt mit Joachim von Fiore, auf den sich die Franziskanerspiritualen berufen44.
Beide Kreise von Weisheitslehrern sind nach demselben Schema aufgebaut. Sie werden vorgestellt von zwei Theologen der Hochscholastik, die zwei unterschiedliche Richtungen repräsentieren. Auf der einen Seite Thomas von Aquin, der für eine umfassende Rezeption der aristotelischen Philosophie plädiert, und auf der anderen Seite Bonaventura, der vom Boden des augustinischen Platonismus aus sich zu Aristoteles eher kritisch verhält. Beide stehen in einer Weisheitstradition, die ihren Ursprung in Israel hat, und von diesem Ursprung führt eine Linie über das griechische Christentum hin zur westlichen Antike und zum Mittelalter. Wie im Paradies die Gegensätze versöhnt sind, so auch im Fall der Weisheit. Dem Aquinaten wird Bonaventura zur Seite gestellt, und beide haben neben sich Gestalten, die ihnen entweder besonders nahe stehen oder von denen sie sich kritisch distanzieren. So hat Bonaventura neben sich sowohl die ersten Anhänger des Franziskus als auch Joachim von Fiore, dessen Rezeption durch die Spiritualen er als Ordensgeneral heftig bekämpfte. Eine vergleichbare Versöhnung der Gegensätze liegt im ersten Kreis vor, da hier Thomas von Aquin zwar zu seiner Linken seinen Lehrer Albertus Magnus hat, zu seiner Rechten aber den von ihm attackierten Siger von Brabant. Wie Joachim von Fiore als Leitbild der radikalen Franziskaner fungiert, so Siger als Repräsentant des radikalen Aristotelismus. Bonaventura vertritt hingegen die gemäßigten Franziskaner, Thomas die gemäßigten Aristoteliker. Dieses Modell der Versöhnung der Gegensätze manifestiert sich auch darin, dass der Dominikaner Thomas seinen eigenen Orden kritisiert und Franziskus als leuchtendes Vorbild zeichnet, während Bonaventura umgekehrt die Missstände bei den Franziskanern geißelt und Dominikus preist. Wie mit Joachim von Fiore, dessen Trinitätslehre auf dem vierten Laterankonzil verurteilt wurde, hält auch mit Siger von Brabant jemand Einzug ins Paradies, dessen Position von kirchlicher Seite beanstandet worden war. 1270 und 1277 verurteilte der Bischof von Paris, Étienne de Tempier, im Rahmen des kirchlichen Vorgehens gegen bestimmte Formen der Aristotelesrezeption 219 Thesen45. Dazu gehörte unter anderem die Auffassung von der Autonomie der Philosophie gegenüber der Theologie, die dann als Lehre von der doppelten Wahrheit Berühmtheit erlangte, aber auch die Annahme der Ewigkeit der Welt und der Einzigkeit und Überindividualität des Intellekts. Siger wurde von Thomas wegen dieser Thesen zwar des Averroismus beschuldigt und der Häresie verdächtigt. Doch die Schärfe seines Angriffs erklärt sich letztlich aus der Tatsache, dass auch er selbst im Gegensatz etwa zu Bonaventura die Selbständigkeit der Philosophie gegenüber der Theologie behauptet und die Ewigkeit der Welt für philosophisch nicht beweisbar gehalten hatte. Postmortal findet dann eine Versöhnung zwischen Thomas und Siger, dem Theologen und dem Philosophen statt. Auch der zuvor verketzerte Vertreter der Artistenfakultät findet Aufnahme im Paradies, von dem die nichtchristlichen Philosophen, auf die sich die scholastischen Theologen und Philosophen stützen, natürlich ausgeschlossen bleiben. Sie befinden sich, wenn sie denn tugendhaft waren, als Ungetaufte und damit Ungläubige im Limbus, der von Dante poetisch als eine Festung auf grünem Rasen gefasst wird. Am Anfang seiner Wanderung durch die Hölle begegnet Dante, geleitet von Vergil, dort nicht nur Aristoteles, dem Meister der Philosophen, Sokrates, Platon, zahlreichen Vorsokratikern, Cicero und Seneca, sondern auch den arabischen Philosophen Avicenna und Averroes, dem großen Aristoteleskommentator46. Damit wertet Dante diese für ihn vorbildlichen nichtchristlichen Philosophen auf, da sie zwar anders als die alttestamentlichen Frommen keine Hoffnung auf Erlösung haben können, aber demselben Ort zugewiesen werden, dem auch die ungetauften Kinder angehören, während andere wie Epikur und seine Schüler mit den Ketzern im sechsten Höllenkreis in Flammengräbern schmachten47.
Die christlichen Weisheitslehrer sind dem Sonnenhimmel zugeordnet. Die sichtbare Sonne wird dabei platonisch als Abbild Gottes, des höchsten Gutes und der Sonne der Engel verstanden. Dante verdankt es der Gnade dieser urbildlichen Sonne, dass er zur sichtbaren Sonne aufsteigen kann, um dort den Weisheitslehrern zu begegnen und einen Einblick in die Weisheit zu erhalten. Die Weisheit wird als ontologische Größe gedeutet, die den ganzen Kosmos durchwaltet und Abbild der göttlichen Weisheit ist. Denn schöpfungstheologisch ist alles Abglanz des Logos, also der zweiten Person der Trinität, deren Strahlen nach un...