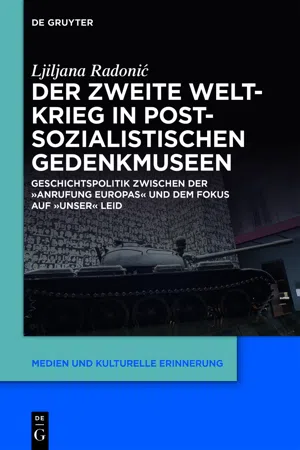
eBook - ePub
Der Zweite Weltkrieg in postsozialistischen Gedenkmuseen
Geschichtspolitik zwischen der 'Anrufung Europas' und dem Fokus auf 'unser' Leid
- 335 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der Zweite Weltkrieg in postsozialistischen Gedenkmuseen
Geschichtspolitik zwischen der 'Anrufung Europas' und dem Fokus auf 'unser' Leid
Über dieses Buch
Erstmals wird die Museumslandschaft aller postsozialistischen EU-Mitgliedsländer untersucht. Wie stellen Museen den Zweiten Weltkrieg, Holocaust und sowjetische Verbrechen dar? Im Zuge der EU-Beitrittsbemühungen betreiben einige eine 'Anrufung Europas' und wollen ihr Europäischsein beweisen, indem sie internationale Musealisierungstrends übernehmen. Andere verlangen von 'Europa', ihr Leiden unter den Sowjets als größeres Übel anzuerkennen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Zweite Weltkrieg in postsozialistischen Gedenkmuseen von Ljiljana Radonić im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Museumsverwaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Die Museumslandschaft in den postsozialistischen Transformationsländern unterliegt einem rasanten Wandel, der einerseits den Untersuchungsgegenstand immer wieder von Neuem einer abschließenden Analyse entzieht, der andererseits aber seine Aktualität und politische Brisanz schlagend vor Augen führt. Als 2012 dieses Habilitationsvorhaben konzipiert wurde, war auf dem Gelände des ehemaligen ‚Zigeunerlagers‘ Lety u Písku in Tschechien die in den 1970ern errichtete Schweinefarm noch in vollem Betrieb – trotz internationaler Proteste bis hin zum Europäischen Parlament. Litauen galt als enfant terrible unter den postsozialistischen Staaten, wenn es um die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs ging. 2008 hatte die Justiz noch angedroht, ehemalige jüdische PartisanInnen und Holocaustüberlebende vor Gericht zu stellen, weil sie bei ihren Sabotageakten gegen die NS-Besatzer die litauische Bevölkerung gefährdet hätten. Erst 2018 entschloss sich Litauen zu einer Art verbaler Abrüstung und folgte dabei dem Beispiel der lettischen und estnischen Okkupationsmuseen: Das Museum der Genozidopfer in Vilnius, das lange Zeit ausschließlich dem sowjetischen ‚Genozid‘ an den LitauerInnen gewidmet war, benannte sich in Museum der Okkupationen und der Freiheitskämpfe um. Nur die Weitblickendsten hatten geahnt, dass Viktor Orbán eine „illiberale Demokratie“ (Orbán 2018) plante und alle Erinnerungsorte nach dem Vorbild des geschichtsrevisionistischen Hauses des Terrors ausrichten wollte, als Ungarn die Geschichtspolitik der Fidesz-Partei in der Verfassung verankerte. In Polen waren das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau und das Museum des Zweiten Weltkriegs in Gdańsk noch nicht eröffnet und die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) noch lange nicht wieder an der Regierung. Kein „Holocaust-Gesetz“ reglementierte das Thematisieren polnischer Mittäterschaft im Nationalsozialismus.
Im Vordergrund meiner Studie steht das Gedenkmuseum als tragende Säule, als Flaggschiff der Geschichtspolitik (Schmid 2009) des jeweiligen Landes im Kontext transnationaler politischer Prozesse. Kämpfe um Hegemonie und Deutungshoheit und ihr Niederschlag in der „Identitätsfabrik“ Museum (Korff und Roth 1990) bilden also den Kern der Untersuchung. Die hier relevantesten Aushandlungsprozesse sind jene im Zuge der EU-Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und den Beitrittskandidaten sowie auf nationaler Ebene zwischen der amtierenden Regierung und den oppositionellen, marginalisierten oder gar stillgestellten Gegenerzählungen. Das Interesse gilt vor allem auch der politischen Kultur (Salzborn 2018, 51): Mit welchen Mitteln wird das dominante Geschichtsnarrativ als die Geschichte inszeniert? Welche Unterschiede bestehen zwischen solchen Aushandlungsprozessen in pluraleren Erinnerungskulturen demokratischer Gesellschaften und einer Geschichtspolitik, die von „Erinnerungskriegern“ (Bernhard und Kubik 2014) wie der PiS in Polen und Fidesz in Ungarn derzeit betrieben wird?
Im Zentrum steht die Frage, wie die Zeit des Zweiten Weltkriegs in großen, durch öffentliche Gelder (mit-)finanzierten Gedenkmuseen, die nach 1989 (wieder-)eröffnet wurden, in den elf postsozialistischen EU-Mitgliedsländern repräsentiert wird. Den Kontext bilden der europäische Einigungsprozess, insbesondere die ‚Europäisierung der Erinnerung‘ und die Bemühungen, Geschichte nach dem Fall der sozialistischen Regime neu zu erzählen. Über einen Überblick über die Museen, ihre Entstehungsgeschichte und die Frage, was sie repräsentieren, hinausgehend wurde untersucht, wie ‚doppelte‘ bzw. ‚dreifache‘1 Okkupation und der Holocaust, wie Opfernarrative und Kollaboration in den jeweiligen Dauerausstellungen und Museumsführern verhandelt werden, aber auch, welche Auswirkungen die EU-Beitrittsbemühungen auf dieses Aushandeln hatten und autoritäre Tendenzen heute haben. Dass einige ‚ständige‘ Ausstellungen nach 1989 mehr als einmal verändert wurden, erlaubt uns, den Wandel und die Dynamik der Opfernarrative, der Externalisierung von Verantwortung und des „negativen Gedächtnisses“ (Koselleck 2002) in Bezug auf TäterInnenschaft und Kollaboration des ‚eigenen‘ Kollektivs zu untersuchen. Dies geschieht besonders im Hinblick darauf, wie die Museen auf ‚europäische Standards‘ rekurrieren und inwieweit sie den von Holocaust-Museen ausgehenden Trend übernehmen, das individuelle Opfer in den Mittelpunkt zu rücken.
Aufgrund des autoritären Backlashs vor allem in Ungarn und Polen rückte dabei die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Demokratieentwicklung und Geschichtspolitik (Forest und Johnson 2011) immer stärker in den Vordergrund meiner Analyse. Drei der untersuchten Museen existierten bereits in der sozialistischen Ära. Dies erlaubt es, die Aufarbeitung der Vergangenheit in der Liberalisierungsphase der 1960er Jahre im Unterschied zu den repressiveren Jahrzehnten davor und danach zu beleuchten. Mit der Einführung demokratischer Strukturen gehen dann nach 1989 auch der Bruch mit dem starren sozialistischen Geschichtsnarrativ und die Aufarbeitung der im jeweiligen Land bisher marginalisierten und tabuisierten Erinnerungen einher. In den 1990er Jahren sind aber insbesondere auch die autoritär-geschichtsrevisionistischen Präsidentschaften von Franjo Tuđman in Kroatien und Vladimir Mečiar in der Slowakei von Interesse – wie später der autoritäre Backlash unter der Regierung Viktor Orbán II in Ungarn ab 2010 und der zweiten PiS-Regierung in Polen ab 2015. Im Zuge dessen verankerten die ungarischen und polnischen mnemonic warriors2 die neue Sicht auf die Vergangenheit etwa in der Präambel der ungarischen Verfassung von 2011 sowie im polnischen sogenannten ‚Holocaust-Gesetz‘ von 2018. Wie wirkt sich die aktuelle demokratiepolitische Verfasstheit des jeweiligen Staates also auf die Museen als zentrale Schlachtfelder ihrer Geschichtspolitik aus?
Die untersuchten Länder und Gedenkmuseen lassen sich in mehrerlei Hinsicht als ‚postsozialistisch‘ begreifen:
It is worth noting that when we talk about post-communist memory, we do not only mean the memory of communism, but the whole spectrum of phenomena regarding social memory and memory policy that occurred in Eastern Europe after the beginning of the political and social transformation.(Głowacka-Grajper 2018, 2)
Dies umfasst drei Bereiche: die Suche nach einer neuen nationalen Identität und Geschichtsschreibung nach 1989 im Allgemeinen, den neuen Fokus auf in der sozialistischen Ära marginalisierte oder gar gänzlich tabuisierte Ereignisse, Gruppen und ihre Erinnerungen – vor allem, aber nicht nur in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und die Kriegsendphaseverbrechen – sowie schließlich den Umgang mit der sozialistischen Ära selbst.
Verglichen werden hier zehn postsozialistische Gedenkmuseen im nationalen und internationalen Kontext: das Museum der Okkupationen in Tallinn, das Museum der Okkupation Lettlands, das Museum der Genozidopfer in Vilnius, das Museum des Warschauer Aufstands, das Museum der Kleinen Festung und das Ghettomuseum in der Gedenkstätte Theresienstadt, das Museum des Slowakischen Nationalaufstands in Banská Bystrica, das Haus des Terrors und das Holocaust-Gedenkzentrum in Budapest, das Zeitgeschichtemuseum in Ljubljana sowie das Jasenovac-Gedenkmuseum in Kroatien. Auch wird das Fehlen solcher dem Zweiten Weltkrieg gewidmeter Gedenkmuseen in Sofia und Bukarest analysiert. Museen der Revolution und Zeitgeschichteabteilungen nationaler Museen wurden dort nach 1989 zur Überarbeitung geschlossen und nicht wieder eröffnet.
Aus jedem postsozialistischen EU-Land habe ich jeweils ein3 öffentlich (mit-)finanziertes Museum ausgewählt, in welchem die Zeit des Zweiten Weltkriegs – oftmals verschränkt mit der sozialistischen Ära – behandelt wird und das bei Staatsbesuchen den ausländischen StaatschefInnen vorgeführt wird, um sie die Geschichte des Landes ‚besser verstehen‘ zu lassen. Sofern möglich, wurde das repräsentativste Museum in der jeweiligen Hauptstadt gewählt – ein solches existiert aber in Prag, Bratislava und Zagreb nicht, weshalb neben dem Aufstandsmuseum in Banská Bystrica mit Theresienstadt und Jasenovac auch zwei Gedenkstätten in die Analyse einbezogen wurden. Es handelt sich hierbei um in ihrer Ausrichtung unterschiedliche Museen, die jedoch alle – entsprechend der unterschiedlichen Botschaft, die das jeweilige Land an ‚das Ausland‘ und ‚Europa‘ senden will – einen der aktuellen kanonisierten lieux de mémoire (Nora 1990) eines Landes darstellen.4 Jedes dieser ‚Vorzeige‘museen im ausgewählten Sample hat in zumindest einem Punkt ein entsprechendes Pendant: Jasenovac und Theresienstadt sind Gedenkstätten; das Haus des Terrors und das Museum der Genozidopfer rekonstruierten Folterzellen aus der NS- wie der sozialistischen Zeit; die Museen in Banská Bystrica und Warschau behandeln Aufstände (von 1944); das Museum der Okkupation Lettlands und das Zeitgeschichtemuseum in Ljubljana sind in Gebäuden untergebracht, in denen zuvor sozialistische Museen zu einem anderen Thema beherbergt waren; die Gebäude in Tallinn und Banská Bystrica wurden speziell für diese Museen erbaut und sind auch architektonisch interessante Projekte. Die Untersuchung zeigt, dass sich entscheidende Parallelen nicht etwa zwischen den scheinbar verwandtesten Museen wie den beiden Gedenkstättenmuseen oder den zwei Aufstandsmuseen finden, sondern zwischen jenen Ländern, deren Museen eine ähnliche Funktion in der Kommunikation mit ‚Europa‘ erfüllen.
Damit lege ich die erste Typologie von Museen über die Zeit des Zweiten Weltkriegs in allen postsozialistischen EU-Mitgliedstaaten vor. Ich unterscheide zwei Pole in Bezug auf diese Kommunikation mit ‚Europa‘ während der EU-Beitrittsverhandlungen:
- Museen, die das ‚Europäischsein‘ des jeweiligen Landes dadurch unter Beweis stellen wollen, dass sie von ‚westlichen‘ Holocaustmuseen ausgehende Musealisierungstrends übernehmen – dunkle Ausstellungsräume, die erstmalige individualisierende Darstellung von Holocaust-Opfern, die Inklusion der Roma-Opfer und die Auseinandersetzung mit eigener Verantwortung und Kollaboration;
- Museen, die von ‚Europa‘ forderten, ‚unser‘ Leiden unter dem Stalinismus bzw. ‚Kommunismus‘ anzuerkennen und bestrebt waren, die Erinnerung an die nationalsozialistische Besatzung und den Holocaust ‚einzudämmen‘, damit sie die ‚eigene‘ Opfererzählung nicht überschreiben.
Ich werde ferner zeigen, wie sich diese Typologie der Museen in den letzten Jahren durch neue D...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Einbettung
- 3 Methodologie
- 4 Der Zweite Weltkrieg im Museum
- 5 Fazit
- Abkürzungsverzeichnis
- Personen- und Sachregister