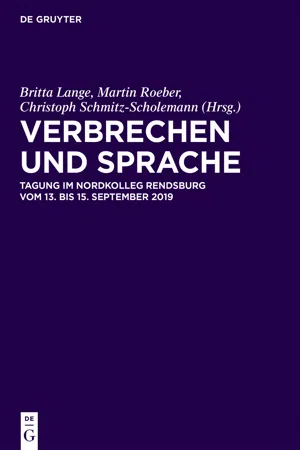A) Der Bänkelsang als Kunstform
Wenig reizt den Menschen mehr als das Verbrechen1. Mit Interesse betrachtet er das Geschehen. Die dahinterstehenden Triebe und Motive sind – abstrakt betrachtet – wohl niemandem fern. Aber auch die im Geschehen wurzelnde Spannung, der Ruch des Verbotenen, vermittelt einen fast magischen Reiz. Es verwundert daher wenig, dass sich auch die Kunst, die Musik, bereits früh besonders spektakulärer Verbrechen annahm. Ortsansässige Liedersänger oder fahrende Dichter dürften das ganze Mittelalter hindurch die Bevölkerung mit Liedern unterhalten haben, die auch Gewalttaten zum Gegenstand hatten. Die Reichweite dieser Lieder war indes – bis auf wenige Ausnahmen – recht begrenzt. Dies sollte sich mit dem 15. Jahrhundert ändern im Kontext einer Medienrevolution2.
Im Zuge der Medienrevolution des Buchdrucks etablierte sich ein regelrechter Buchmarkt. Die neuen Vervielfältigungstechniken beschränkten sich nicht nur auf das geschriebene Wort. Auch Bilder ließen sich mit Druckmaschinen vervielfältigen, etwa in Form von Holzschnitten oder Kupferstichen. Musste das Mittelalter noch mit verhältnismäßig wenig Büchern und Bildern auskommen, bricht sich mit dem 16. Jahrhundert eine wahre Buch- und Bilderflut Bahn.
Zehntausende Werke entstanden. Diese wurden begierig erworben und waren ein lukratives Geschäft.
Gleichwohl konnten bis zum Jahr 1600 nicht einmal drei Prozent der Bevölkerung lesen3. Was die drei Prozent der Alphabeten jedoch mit den 97 Prozent der Analphabeten teilten, war ein evolutionärer Urtrieb, der allen eingeprägt ist – die Neugier4. Die Gier nach Neuem oder wissenschaftlich ausgedrückt: „Das als ein Reiz auftretende Verlangen, Neues zu erfahren und insbesondere Verborgenes kennenzulernen.“5 Des Lesens nicht Mächtige waren zum Stillen der Neugier auf Kommunikation angewiesen. Kommunikationszentren waren seit jeher Wirtshäuser und Märkte. Hier unterhielten (fahrende) Sänger die Besucher. Als Bühne dienten häufig Tische oder Bänke, Bänkel; weshalb sich die Bezeichnung Bänkelsänger lexikalisierte6. Die Bänkelsänger machten sich die neuen Massenmedien des 16. Jahrhunderts zu Nutze, die Flugblätter. Zunehmend besangen sie Geschichten, die bereits auf Flugblättern gedruckt waren. Durch den Verkauf dieser Blätter erschlossen sie sich eine zweite Einnahmequelle. Häufig führten sie bebilderte Tafeln mit sich. Während des Vortrags wiesen sie mit einem Stab kommentierend auf das jeweilige Bild und zeichneten so den Verlauf des Geschehens nach. Der Bänkelsänger bot also public viewing in Reinform – ein kollektives (Fern-)Seherlebnis. Leseunkundigen dienten die während des Vortrags feilgebotenen bebilderten Flugblätter überdies als Gedächtnisstütze. So machte die leseunkundige – oft weibliche – Bevölkerung einen großen Teil der Zuschauer und Käufer aus7.
Der Bänkelsang lässt sich als eine populäre Kunstform des Jahrmarkts einordnen8. Als audiovisuelles Medium vereinte er die Kunstgattungen Literatur, Musik und bildende Kunst in sich9 – ein volksnahes Gesamtkunstwerk in Form der Reportage. Bänkelsänger waren bedeutende Nachrichtenüberbringer der prätelegraphischen Epoche und damit wichtig für die öffentliche Meinungsbildung. Sie operierten in einem Grenzbereich zwischen mündlicher und schriftlicher Tradition. Die Stücke, Blätter und Lieder der Bänkelsänger entsprangen jedoch keinem Furor poeticus und keinem künstlerischen Plan – es ging den Bänkelsängern ausschließlich um den Gelderwerb10.
B) Die Moritat
Mit dem Durchbruch der Zeitungen im 17. Jahrhundert änderte sich die Situation des Bänkelsangs11. Die Printmedien informierten umfassender und schneller über aktuelle Ereignisse. Mit dieser Geschwindigkeit konnten fahrende Sänger nicht mithalten. Sie mussten auf echte Aktualität verzichten, womit sich ihr Nachrichtenstoff verengte12. In den Mittelpunkt rückten nun Skandale und Verbrechen, das Grauenerregende und Rührselige13. Nur die geschäftstüchtigsten Bänkelsänger überlebten. Die Schilder wurden greller und bunter; die Gesänge lauter und die Geschichten spektakulärer.
Schreckliche Gewalttaten, garstige Räuberstücke, blutige Hinrichtungen, tragische Liebesgeschichten, entfesselte Naturgewalten. Der Abstieg des Sängers vom wichtigen Nachrichtenübermittler zum Schausteller begann. Mord und Totschlag bestimmten immer stärker den Bänkelsang. Der Siegeszug der Moritat nahm seinen Lauf14. Die sprachwissenschaftliche Herleitung (Etymologie) des Begriffs Moritat ist umstritten15. Einige leiten ihn von Mordtat ab; andere vom Lateinischen mors / mori (Tod / sterben), vom Französischen la moralité (Moral / Sittlichkeit) oder gar aus einer geheimen Gaunersprache, dem Rotwelsch. Dort stand more für Händel oder Lärm.
Neben der Verknappung des Informationsmarktes machte den Bänkelsängern die große Konkurrenz von Händlern, Bettlern und Jahrmarktartisten das Leben schwer. Haupterwerbsquelle wurden zunehmend die das Lied bebildernden Flugblätter16, weshalb es die Zurschaustellung der Ware zu attraktivieren galt. Es sind mehrere bildliche Darstellungen überliefert, auf denen die Kolporteure zum Teil über und über mit Druckerzeugnissen behängt sind, sich diese gar an den Hut stecken17. Das Sprichwort, „sich etwas an den Hut stecken können“, rührt daher. In anderen Fällen ließen die Bänkelsänger ihre Kinder oder Frauen während des Vortrags die Flugblätter verkaufen.
I. Zensur im Bänkelsang
Die Obrigkeit beargwöhnte die Rolle der Bänkelsänger als Nachrichtenvermittler und ungebetene Berichterstatter18. Zensur, Überwachung und Verbote waren deshalb – vor allem im 18. / 19. Jahrhundert – allgegenwärtig; teilweise herrschte gar Konzessionspflicht19. So wundert es nicht, dass die Moritaten der jeweiligen Ideologie genügen wollten und die Gerichte priesen20. Viele Moritate zeichnen sich durch einen moralischen Rigorismus aus, ein unreflektiertes Gerechtigkeitsgefühl, das der volkstümlichen Rechtsauffassung recht nah kam21. Man zielte sie auf bestimmte moralische Lehren, ermahnte und belehrte. Dies trug dem Bänkelsänger rasch das Verdikt eines Sittenrichters ein. Die Moral ermöglichte zwar das öffentliche Auftreten. Aber nur ein besonderes Spektakel versprach einen merkantilen Mehrwert. Dies zeigt sich neben der Themenwahl auch in der Sprachverwendung. So zeichnen sich Bänkellieder durch einen signifikant hohen Anteil an Eigenschaftswörtern und drastische Übertreibungen aus22. Eine Kindsmörderin wird als liederlich, unnatürlich, gefühllos und töricht apostrophiert; ein Hauseinsturz hinterlässt „über 40 Leichen […], zum Theil jämmerlich gequetscht und verstümmelt, mit zermalmten Schädeln und blutig zerfetzten Leibern“. Die Anhäufung drastischer Epitheta und Hypertrophierung weiterer sprachlicher Elemente erhöhte jedoch weniger die Anschaulichkeit, als dass es die Aussagen standardisierte und damit trivialisierte. Oft überzeichneten die Vortragenden derart, dass die Moritat zur Parodie avancierte. Dass sich die Bänkelsänger um hochgestochene Reflexionen und eine gewählte Sprache bemühten, mit pseudopoetischen Bildern um sich warfen, mach...