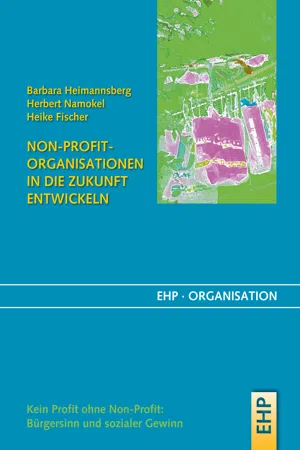![]() Teil II.
Teil II.![]()
Teamentwicklung bei der AOK
Die AOK als gesamte Organisation
Unter dem Begriff Allgemeine Ortskrankenkasse bestehen in Deutschland mehrere rechtlich selbstständige Krankenkassen, bei denen rund ein Drittel der Bevölkerung (25 Millionen Menschen) versichert ist.
Körperschaften des öffentlichen Rechts – Sie haben eigene Selbstverwaltungen aus Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und eigene Vorstände.
Die Ortskrankenkassen wurden im Jahre 1884 im Rahmen der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung durch Reichskanzler Otto von Bismarck gegründet. Anfangs gab es 8.200 von ihnen, denen die Arbeiter zugewiesen wurden, wenn sie nicht anderweitig versichert waren. Ab 1892 konnten auch Angestellte und Heimarbeiter Mitglied werden. Im Laufe der Zeit reduzierte sich die Zahl der Kassen durch Fusionen. Im Zuge der Kreisverwaltungsreform und dann durch das Gesundheitsstrukturgesetz im Jahre 1992 entstand eine Fusionswelle unter den damals noch knapp 300 AOKs zu nunmehr zwölf Organisationen.
Die Leistungen bestehen aus Pflichtleistungen laut SGB und aus Satzungsleistungen, die über die Pflichtleistungen hinausgehen und in der Kassensatzung verankert sind. Die Beiträge sind seit 2009 einheitlich vorgegeben. Die Einnahmen und Ausgaben beliefen sich auf ca. 60 Mrd. Euro im Jahre 2010, und mit 34 Prozent waren Behandlungen im Krankenhaus der größte Posten.
Alle AOKs zusammen werden vom Bundesverband in Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts vertreten. Der Sitz des Bundesverbandes ging im Jahr 2008 von Bonn nach Berlin. Kernaufgabe ist die Interessenvertretung gegenüber der Bundespolitik, dem GKV-Spitzenverband und den AOK-Vertragspartnern. Hinzu kommen Markenpflege, Entwicklung neuer Produkte und das Finanzmanagement im Haftungsverbund. In Kooperation mit SAP entwickelt die AOK Systems GmbH eine Branchensoftware, die sie auch an Ersatzkassen vermarktet.
Die betrachtete Teilorganisation
Eine Bezirksdirektion (BD) einer Landes-AOK, zuständig für einen bestimmten Ballungsraum mit einer Großstadt als Zentrum, ist der organisatorische Rahmen, in dem sich dieser Fall abspielt. Diese AOK-Bezirksdirektion ist eine von über 30 BDs innerhalb eines Bundeslandes und bedient über 200.000 Versicherte.
Die AOK insgesamt ist Teil des Sozialversicherungssystems in Deutschland. Sie hat den gesetzlichen Auftrag der Krankenversicherung, ist aber – anders als beispielsweise die Berufsgenossenschaften – dem Wettbewerb mit anderen Anbietern von Versicherungen ausgesetzt. Neben den Aufgaben des gesetzlichen Krankenversicherers ist die AOK in vielfältiger Weise Partner der am Gesundheitssystem beteiligten Organisationen und Unternehmen, wie z. B. die Kassenärztliche Vereinigung (KV), Interessensvertretungen von Pharmaindustrie und Apothekern.
Die AOK ist nach wie vor eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, bewegt sich aber am Markt der Krankenversicherer eher wie ein Profitunternehmen in der Versicherungsbranche. Abgeleitet aus der langfristigen Strategie, befindet sich die Organisation auf dem Weg zu einem »modernen Dienstleistungsunternehmen«, ist aber abhängig von politischen Entscheidungen im Gesundheitswesen, die oft direkte Auswirkung auf die Arbeitsprozesse und das Arbeitsaufkommen haben. Über diese Veränderungen und die damit verbundenen Eingriffe kann nicht, wie in einem Profitunternehmen, frei entschieden werden. Um dies zu veranschaulichen, sei hier das Beispiel der geringfügigen Beschäftigung genannt. Menschen, die einen sogenannten 400-Euro-Job hatten, wurden durch eine gesetzliche Regelung krankenversicherungspflichtig. Die Lawine an Mehrarbeit für die AOK, die diese Veränderung bewirkte, hatte der Gesetzgeber nicht bedacht. Andererseits wurde Druck seitens des Gesetzgebers in Richtung der Senkung der Verwaltungskosten ausgeübt. Es entstand eine Konfliktsituation, die nicht in die langfristige Strategie passte und anders als in einem Profitunternehmen nicht durch eine Managemententscheidung lösbar war. Hier wird sehr deutlich, wie das Dienstleistungsspektrum der Organisation und die dahinter liegenden Arbeitsprozesse von außen vorgegeben werden und nicht durch unternehmerisches Handeln und daraus resultierende Managemententscheidungen bestimmt sind. Die AOKs sind, wie bereits erläutert, eine typische Hybridorganisation.
Um das Projekt Teamentwicklung richtig einordnen zu können, ist ein Blick in die Historie der Organisation nützlich. Bevor die Wahlfreiheit der Versicherten eingeführt wurde, hatte die AOK keinen Wettbewerb zu scheuen. Die Arbeitsplätze waren sicher, die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter klar vorgezeichnet, sowohl von der Position als auch von der Bezahlung. Gesetze und Vorschriften regelten den Arbeitsalltag. In aller Regel mussten keine Entscheidungen getroffen werden, denn es gab kaum Handlungsalternativen. Es wurde bearbeitet, geprüft, genehmigt und verwaltet. Überspitzt gesagt wurde Arbeit und Anwesenheit, nicht aber Leistung und Übernahme von Verantwortung gefordert. Die Identität der Organisation war fest gegründet auf den gesetzlichen Auftrag und die Verankerung im Staatswesen. Die Menschen die sich für diese Organisation als Arbeitgeber entschieden hatten, waren geprägt von Wertvorstellungen, die hier geschätzt und anerkannt wurden. Deutsche Tugenden wie Ordnung, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Disziplin standen hoch im Kurs, denn schließlich ging man ja mit dem Geld anderer Leute um.
Diese Situation begann sich mit Beginn der 80er-Jahre allmählich zu verändern. Aus der Krankenkasse wurde die »Gesundheitskasse«, IT-Anwendungen gewannen immer mehr an Bedeutung, der Beamtenstatus für neu hinzugekommene Mitarbeiter wurde abgeschafft und die Wahlfreiheit zur Krankenversicherung bescherte Konkurrenz durch Betriebs- und Innungskrankenkassen. Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung in Verbindung mit hoher Arbeitslosigkeit wurden in Form von steigenden Beitragssätzen spürbar. Zu diesen von außen einwirkenden Veränderungen kam die Notwendigkeit ökonomischen Handelns hinzu und bescherte den Mitarbeitern und Führungskräften eine Veränderungsdynamik von bisher unbekanntem Ausmaß.
Ausgangslage und Hintergrundinformationen
Die Führungskräfte hatten nur teilweise die veränderten Anforderungen an ihre Aufgabe umgesetzt. Ehemalige autonome Geschäftsführer wurden zu weisungsabhängigen Managern, auch wenn der Name Geschäftsführer blieb. Einige begriffen die Veränderungen als Chance, andere verlangsamten den Veränderungsprozess so stark wie möglich, oft im Hinblick auf die in einigen Jahren bevorstehende Pensionierung. Im Unterschied zu Profitorganisationen wurden diese Verhaltensweisen toleriert. Es war undenkbar, sich von einem Mitarbeiter zu trennen, der 40 Jahre der AOK gedient hatte, auch wenn er aktuell nicht mehr den Anforderungen gerecht wurde. Das konservative und autoritäre Verständnis von Führung verhinderte bis in die 90er-Jahre auch den Aufstieg von Frauen in die oberste Führungsebene. Dieser Umstand war besonders interessant, weil über 70 Prozent der Mitarbeitenden dieser AOK Frauen waren.
Auf den unteren Führungsebenen wurden, auch begünstigt durch den Ausbau des Geschäftsstellennetzes, viele sehr junge Mitarbeiterinnen zu Führungskräften gemacht. Durchweg engagierte und gut ausgebildete Spezialistinnen, die sich eher als Obersachbearbeiterinnen, aber nicht als Führungskräfte verstanden.
Im hier beschriebenen Fall vollzog sich aus Altersgründen ein Führungswechsel an der Spitze der Bezirksdirektion. Der Vorgänger, der über viele Jahre versucht hatte, in seiner BD die Zeit anzuhalten, wurde abgelöst durch einen dynamischen, an anderer Stelle bereits erfolgreichen Mann, der nun endlich in dem »Laden« aufräumen sollte.
Ein wesentlicher Grund für das Projekt war die extreme Belastung der Mitarbeiter durch Mehrarbeit. Bei einer Analyse hatte sich herausgestellt, dass sich über 200 Mannjahre an Arbeitsrückständen aufgestaut hatten. Ein für die Mitarbeiter unüberschaubarer Berg. Trotz Samstagsund Sonntagsarbeit war kein Ende der Belastungssituation abzusehen. Mangels Perspektive hin zum Besseren zogen viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Konsequenzen von überwiegend defensiver Natur. Es gehörte zur Kultur der Organisation, sich nicht offiziell zu beklagen oder gar aufzulehnen. Anders als in der freien Wirtschaft gehen die Mitarbeiter davon aus, der Organisation ein Leben lang zu dienen ohne aufzumucken. Überdurchschnittlich hoher Krankenstand, eine Häufung von Schwangerschaften bei jungen Frauen und abnehmende Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung waren konkret zu beobachten. Dadurch verschärfte sich die ohnehin kritische Situation für die verbleibenden Mitarbeiter. Der Arbeitsmarkt gab keine qualifizierten Mitarbeiter her, denn die AOK ist der einzige Krankenversicherer, der über Bedarf ausbildet. Umgekehrt bedienen sich die Mitbewerber aus dem Reservoir der AOK-Mitarbeiter, wenn sie qualifizierte Arbeitskräfte benötigen. Viele unbesetzte Stellen blieben offen oder konnten nur mit ungelernten, neuen Mitarbeitern besetzt werden, die in der Anlernphase mehr Belastung denn Entlastung bedeuteten.
In dieser extrem schwierigen Lage waren viele junge Teamleiterinnen und Teamleiter mit ihrer Führungsaufgabe überfordert. Zum einen identifizierten sich viele Teamleiterinnen mehr mit den Problemen der Mitarbeiter als mit denen der Organisation. Ein Phänomen, das bei Vorgesetzten, die aus dem Kreis der eigenen Kollegen hervorgehen, häufig auftritt. Zum anderen fehlte der Mut zu deutlicher Führung in Form von Leistungsanforderungen gegenüber den Mitarbeitern, aber auch gegenüber den Vorgesetzten. Hier wird die Historie des Unternehmens spürbar, die sich aus der Idee des Solidarprinzips speist und den Wert Gleichheit favorisiert gegenüber dem Wert Gerechtigkeit.
Noch erschwerend kam hinzu, dass durch eine Veränderung der Geschäftsstellenstruktur einige Teams neu zusammengesetzt waren und die typischen Probleme der Teambildung auftraten. Dies bedeutete eine zusätzliche Herausforderung für die Leitung, denn es war bisher nicht üblich, Mitarbeiter an den Platz zu stellen, an dem sie gebraucht werden. Das Recht der Organisation, einen beamteten Mitarbeiter dorthin zu versetzen, wo er oder sie gebraucht wird, wurde geleugnet. Weil von diesem Recht in der Vergangenheit kein Gebrauch gemacht wurde, durfte es auch jetzt in dieser Situation nicht angewendet werden, dachten die Mitarbeiter – ein Phänomen, das in Organisationen mit beamteten Mitarbeitern immer wieder auftritt. Die Privilegien des Beamtenstatus werden wie selbstverständlich in Anspruch genommen. Die Pflichten dagegen werden als nicht mehr zeitgemäß infrage gestellt oder gar zurückgewiesen. Hier wird die Chance vertan, den Beamten wieder zu Ansehen zu verhelfen, weil sie mit ihrer Pflichterfüllung die Kontinuität des Staatswesens sicherstellen.
Aus der Sicht des neuen Geschäftsführers gemeinsam mit der Stabsabteilung Organisationsentwicklung war das eigentliche Problem die Führungsschwäche der Teamleiter, die nicht dazu in der Lage waren, die Arbeit zu organisieren und Leistung einzufordern. Die anderen Faktoren wurden zwar gesehen, aber nicht als sonderlich bedeutend bewertet.
Rolle der Berater
Bei der Betrachtung der Organisation zeigte sich deutlich, dass die Verantwortlichen das Hauptproblem in der Überforderung der unteren Führungskräfte, also der Teamleiter und der Geschäftsstellenleiter, sahen. Als Verursacher und Schuldigen für den schwierigen Zustand der gesamten Bezirksdirektion wurde der alte Geschäftsführer betrachtet, der jetzt im Ruhestand war.
Die externen Berater konnten dieser Einschätzung zustimmen, denn sie kannten die Organisation als Trainer und Berater seit vielen Jahren. Die Hinweise auf den größeren Zusammenhang, wie bereits hier beschrieben, wurden zur Kenntnis genommen, aber dann beiseite geschoben. Die Verantwortlichen waren im System gefangen und fühlten sich außerstande, daran etwas zu verändern. Hätten sie sich die Einschätzung der Berater zu eigen gemacht und an höherer Stelle thematisiert, wäre das als Mangel an Loyalität zur Organisation gewertet worden. Außerdem wurden schnelle Ergebnisse erwartet, denn der neue Geschäftsführer wollte und musste zeigen, dass sich etwas tut.
Den Beratern war bewusst, dass sie mit diesem Projekt nicht das generelle Problem dieser Organisation bearbeiten konnten. Aber sie hatten großen Gestaltungsspielraum bei der Planung und Konzeption des Projektes und versuchten, das in dieser Situation Mögliche für diese Organisation zu gestalten. Aus systemischer Sicht und aus der Erfahrung mit ähnlichen Situationen war den Beratern klar, dass kleine Anstöße in die richtige Richtung große Veränderungen in Gang setzen können. Dazu ist es allerdings erforderlich, die Reaktionen des Systems und seiner Mitarbeiter, die in die angestrebte Richtung gehen, positiv zu verstärken mit Wertschätzung und Anerkennung.
Eine Intervention der Berater beim Vorstand der AOK wäre vermutlich als Mangel an Loyalität gewertet worden und hätte zur Disqualifikation geführt, ähnlich wie bei den Führungskräften. Die Darstellung der ursächlichen Probleme hätte einige andere Maßnahmen der Organisationsentwicklung infrage gestellt. Mit der Kultur der AOK zu gehen hätte es erforderlich gemacht, sich auf den Status einer NPO zu besinnen und nicht weiter so zu tun, als wäre man eine wettbewerbsfähige Profitorganisation.
Zusammenfassend gesagt, wurde das Projekt »Teamentwicklung« direkt durch den Führungswechsel und die hohe Arbeitsbelastung in den Teams ausgelöst. Indirekter Auslöser war der typische Konflikt einer NPO, die dem Wettbewerb ausgesetzt ist und mit klassischen Mitteln der Profitorganisationen darauf reagiert. Zusätzlicher...