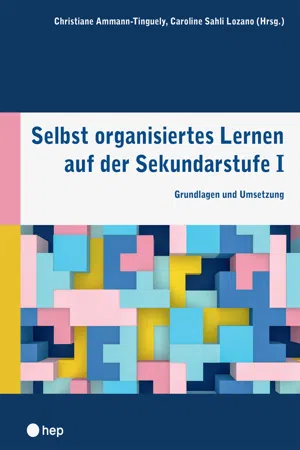
eBook - ePub
Selbst organisiertes Lernen auf der Sekundarstufe I (E-Book)
Grundlagen und Umsetzung
- 280 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Selbst organisiertes Lernen auf der Sekundarstufe I (E-Book)
Grundlagen und Umsetzung
Über dieses Buch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.Wer eigenständig und selbstverantwortlich handeln kann, ist im Zeitalter der Digitalisierung bestens gewappnet. Ein Mittel das zu erreichen sind Unterrichtsformen des selbst organisierten Lernens (SOL). Dieses Studienbuch beinhaltet die Grundlagen sowie ein Modell zur Analyse und Weiterentwicklung des SOL. Beispiele aus der Praxis helfen bei der Umsetzung. Erfahren Sie, wie Sie Lerngruppen etablieren und reichhaltige Aufgaben für die Fächer Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und Natur, Mensch, Gesellschaft gestalten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Selbst organisiertes Lernen auf der Sekundarstufe I (E-Book) von Christiane Ammann-Tinguely, Caroline Sahli Lozano, Christiane Ammann-Tinguely,Caroline Sahli Lozano im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Bildung & Naturwissenschaften & Technik unterrichten. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil 1
Grundlagen für das selbst organisierte Lernen
1Einleitung
Im einleitenden Kapitel 1 geben wir einen Überblick über die Themen, die auf der ► Sekundarstufe I im Hinblick auf das selbst organisierte Lernen (SOL) zu divergenten Meinungen führen. Während wir in Kapitel 1.1 darauf eingehen, dass SOL eine Antwort auf viele pädagogische Fragen sein könnte und wahrscheinlich gerade deswegen so kontrovers diskutiert wird, gehen wir in Kapitel 1.2 auf die Begriffsklärung von SOL ein, da dieser Begriff oft sehr unterschiedlich gedeutet wird. Häufig wird die Wirksamkeit von SOL auf persönlichen Erfahrungen und nicht auf evidenzbasierten Fakten beurteilt, was immer wieder zu Diskussionen führt. Deshalb widmen wir uns in Kapitel 1.3 der Frage der Wirksamkeit von SOL. Eine zentrale Frage für Lehrpersonen der Sekundarstufe I und viele Eltern ist, inwiefern die beim SOL gewonnenen Erfahrungen und erworbenen Kompetenzen in ► Berufslehren und ► weiterführenden Schulen gefragt sind, was in Kapitel 1.4 erläutert wird. Zudem zeigen wir in Kapitel 1.5 auf, weshalb SOL auch für die ► Kompetenzorientierung im Deutschschweizer ► Lehrplan 21 von zentraler Bedeutung ist.
1.1Selbst organisiertes Lernen auf der Sekundarstufe I
SOL – Neomanie?
Gesellschaftliche Veränderungen machen vor der Schule keinen Halt. Auch der Unterricht bleibt davon nicht unberührt. Methodische und didaktische Konzepte werden angepasst, weiterentwickelt und teilweise neu erfunden. Auch SOL bezeichnet eine solche Innovation. Die veränderte Schule wirft viele Fragen auf und SOL kann dazu verschiedene Antworten anbieten. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gibt es wohl kaum ein pädagogisches Unterrichtskonzept, das vergleichbar kontrovers diskutiert wird. Während die einen Lehrpersonen überzeugt sind, dass SOL Antworten auf alle möglichen aktuellen schulischen Herausforderungen bietet, gibt es andere, die einen lehrerzentrierten Unterricht präferieren oder SOL als Neomanie (vgl. Reichenbach 2014) abtun. Kann das Unterrichtskonzept angesichts der vielen und teilweise divergierenden Annahmen für die Praxis nutzbar gemacht werden? Und wie könnte das konkret aussehen?
Kritische Stimmen zu SOL
Diese Fragen stellen sich insbesondere auf der Sekundarstufe I. Unterricht mit SOL sieht sich auf dieser Stufe kritischen Stimmen gegenübergestellt. Schülerinnen und Schüler werden teils in getrennten Klassen, teils in denselben Klassen oder in Schulzügen mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus unterrichtet. Sie werden von verschiedenen Fachlehrpersonen mit unterschiedlichen Lehr- und Lernverständnissen gefördert (siehe Kap. 2.5). Es wird deutlich: Diese große Komplexität ist herausfordernd. Zudem stehen Übertritte der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Schulen oder Berufslehren an.
Selektionsrelevante Schullaufbahnentscheide
Gerade vor den selektionsrelevanten Schullaufbahnentscheiden ist der Druck auf Schule und Unterricht von verschiedenen Seiten sehr hoch. Die Forderungen, dass die Unterrichtszeit effektiv und effizient genutzt werden soll, und dass guter Unterricht an den Lernerfolgen in den selektionsrelevanten Fächern gemessen wird, sind verständlich. Angesichts solcher Forderungen kann das SOL einen schwierigen Stand haben. Gleichzeitig verspricht man sich gerade auf der Sekundarstufe I von SOL Antworten auf relevante Fragen.
Große Heterogenität
Diese fokussieren ...
•auf eine Pädagogik, die der zunehmenden Heterogenität (siehe Kap. 2.1) in den Schulklassen stärker gerecht werden kann. Dabei ist die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler ein Phänomen, das alle Schulstufen betrifft (vgl. Eckhart 2009). Thematisiert wurde sie bisher vor allem in der Vor- und Primarschulstufe, weniger auf Sekundarstufe I und II, weil hier bereits über Selektion homogenere Lerngruppen gebildet werden. Nichtsdestotrotz sind die Klassen auch auf diesen Stufen sehr verschieden zusammengesetzt. Dazu kommen Schulmodelle mit erhöhter ► Durchlässigkeit auf der Sekundarstufe I, die in den letzten Jahren vermehrt entwickelt und umgesetzt wurden. Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen lernen hier selbstverständlich miteinander. Die Diversität der Jugendlichen bildet dabei nicht ein Problem, sondern ist Ausgangspunkt für weiterführende pädagogische Überlegungen. Gesucht sind deshalb geeignete Unterrichtskonzepte.
Integrativer/inklusiver Unterricht
•auf integrativen beziehungsweise inklusiven Unterricht. Im Bildungssystem ist seit Jahren der Trend zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf zu beobachten. Schülerinnen und Schüler mit und ohne Beeinträchtigungen besuchen gemeinsam den öffentlichen Unterricht. Eine soziale Entwurzelung wird durch die wohnortnahe, integrative Beschulung verhindert (vgl. Bless 2018). Die ► schulische Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen findet in der Vorschul- und Primarstufe ihren Ausgangspunkt, ist aber seit einiger Zeit auch auf der Sekundarstufe I angekommen (siehe Kap. 2.1.2). Benötigt wird ein integrativer und inklusiver Unterricht, der alle Schülerinnen und Schüler fördern kann - auch Jugendliche mit Beeinträchtigungen.
Selbstverantwortetes Lernen auf der Sekundarstufe I
•auf selbstverantwortetes Lernen. Von den Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie mehr Verantwortung fürs eigene Lernen übernehmen, je älter sie werden. Auf der Sekundarstufe I findet dieses Anliegen besondere Bedeutung, denn die Jugendlichen treten danach in eine Berufslehre oder in weiterführende Schulen über. Selbstständigkeit wird vorausgesetzt. Gefragt ist daher besonders für die Sekundarstufe I ein Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler zum selbstverantworteten Lernen führen kann.
Unterschiedliche Bedürfnisse der Lernenden
•auf einen Unterricht, der individuelles und kooperatives Lernen (siehe Kap. 3.2) verbindet. Die zentrale Herausforderung des Unterrichts für heterogene Lerngruppen besteht in der Verbindung dieser beiden übergeordneten didaktischen Prinzipien (vgl. Eckhart 2005). Der Unterricht muss den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden. Hierfür bedarf es individualisierter Lernwege und -materialien. Die Schülerinnen und Schüler lernen gleichzeitig miteinander und voneinander. In der Schule wachsen sie in die Gesellschaft hinein. Die Lerngruppe eröffnet unermessliche Möglichkeiten für ► soziale Lernprozesse. Gesucht ist ein Unterricht, der nicht nur fachliche, sondern auch ► überfachliche Kompetenzen zu fördern vermag.
Kompetenzorientierter Unterricht
•auf einen kompetenzorientierten Unterricht. Kompetenzorientierung bildet die Basis für das schulische Lernen wie es zum Beispiel im Deutschschweizer Lehrplan 21 verankert ist (vgl. Adamina et al. 2015). Lernen wird als «(individuell-) konstruktiver, aktiv-entdeckender, dialogischer, schrittweise selbstregulierter und reflexiver Prozess» verstanden (ebd., S. 19). In einem solchen Lernen werden verschiedene Wissensarten, Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen sowie überfachliche Kompetenzen vernetzt (vgl. Adamina 2019). Quasi das Rückgrat eines solchen Unterrichts bilden geeignete Aufgaben und passende Lernumgebungen. Unterricht sollte sich nach diesem veränderten Lern- und Unterrichtsverständnis richten.
Sinnvoll gestaltete Lernumgebungen
•auf einen indirekten Unterricht (vgl. Wocken 2012). Der Unterricht in heterogenen Lerngruppen wird von vielen Lehrpersonen als belastend erlebt (vgl. Eckhart 2005). Die skizzierten Überlegungen verdeutlichen, dass die Erwartungen an Lehrpersonen hoch sind. Ein einseitig traditioneller, lehrerzentrierter Unterricht wird an diesen Erwartungen scheitern. Lehrerinnen und Lehrer müssen Verantwortung durch entsprechend gestaltete Lernumgebungen abgeben können. Dann können sie sich auf eine wirksame Lernbegleitung und das Coaching der Schülerinnen und Schüler konzentrieren. Neben dem kooperativen Lernen und der inneren ► Differenzierung werden damit Ansätze der natürlichen Differenzierung zentral.
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams
•auf die Arbeit in multiprofessionellen Teams. Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler findet ihren Ausdruck in unterschiedlichen Lern- und Leistungsvoraussetzungen. Um dieser Heterogenität pädagogisch zu begegnen, wird unterschiedliches Know-how benötigt. Das führt dazu, dass in heterogenen Schulklassen Lehrerinnen und Lehrer mit weiteren Fachpersonen kooperieren. Mit ihrem je spezifischen Fachwissen helfen sie mit, die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler als Chance zu nutzen. So entstehen multiprofessionelle Teams mit einem breiten Wissensbestand, die als wesentliche Gelingensbedingung für integrative beziehungsweise inklusive Schulsettings gelten (vgl. Lütje-Klose & Urban 2014 u. a. m.).
SOL ≠ SOL
Es wird deutlich, dass die offenen Fragen und Herausforderungen vielfältig sind. Gerade auf der Sekundarstufe I sind Antworten dringend notwendig, damit die Vielfalt der Lernenden und Lehrenden im SOL als Chance genutzt werden kann. In diesem Kontext ist das gemeinsame SOL-Projekt der Mosaikschule Munzinger (siehe Teil 2, Kap. 1.3) und der PHBern einzuordnen. Während drei Jahren wurden auf verschiedenen Ebenen Antworten auf alltägliche pädagogische Fragen gesucht. Dabei stellte sich bald heraus, dass es das SOL nicht gibt. Dies gilt insbesondere, wenn von der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler ausgegangen wird. Die Suche nach Antworten führte während des Projekts zu einem Modell für SOL, das spezifische ► Spannungsfelder aufnimmt. In der Zusammenarbeit mit der Mosaikschule Munzinger wurden viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Diese geben einen konkreten Einblick in die Umsetzung eines erfolgreichen SOL-Unterrichts.
Im Folgenden wird diese Praxisorientierung akzentuiert in der Überzeugung, dass guter SOL-Unterricht auf der Sekundarstufe I in den jeweiligen Fächern sowie fachübergreifend im Hinblick auf die verschiedenen Facetten der Heterogenität einer Lerngruppe umgesetzt werden muss.
1.2Verständnis von selbst organisiertem Lernen
SOL ist mehr als Organisation
Wie meistens findet man auch bezogen auf das SOL sehr viele und teilweise sehr unterschiedliche Begriffsklärungen. Entsprechend bleiben der Begriff und die mit ihm verbundenen Konzepte vage (vgl. Kraft 1999). Klar ist hingegen, dass es bei einer wörtlichen Begriffsauslegung leicht zu Missverständnissen kommen kann. Es würden dann nämlich in erster Linie organisatorische Aspekte hervorgehoben. Schü...
Inhaltsverzeichnis
- Cover Page
- Copyright
- Vorwort
- Zum Aufbau des Buchs
- Dank
- TEIL 1 - GRUNDLAGEN FÜR DAS SELBST ORGANISIERTE LERNEN
- TEIL 2 - DAS PROJEKT
- TEIL 3 - FACHSPEZIFISCHE UMSETZUNG IM SELBST ORGANISIERTEN LERNEN
- ANHANG