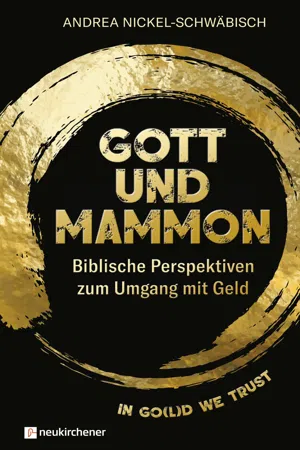
eBook - ePub
Verfügbar bis 11 Apr |Weitere Informationen
Gott und Mammon
Biblische Perspektiven zum Umgang mit Geld - In go(l)d we trust
Dieses Buch kann bis zum folgenden Datum gelesen werden: 11. April, 2026
- 175 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 11 Apr |Weitere Informationen
Gott und Mammon
Biblische Perspektiven zum Umgang mit Geld - In go(l)d we trust
Über dieses Buch
Andrea Nickel-Schwäbisch widmet sich in ihrem Buch dem Thema Geld aus biblischer und soziologischer Perspektive.
In einem ersten Teil beschreibt sie auf spannende und fundierte Art, wie Geld entstanden ist und heute "funktioniert". Anhand ausgewählter Bibelstellen fragt sie dann in einem zweiten Teil danach, welche Rolle Geld in der Beziehung zwischen Gott und Menschen spielt und weckt das Bewusstsein dafür, das Geld schon immer auch eine spirituelle Komponente hatte.
Entstanden ist ein tiefgründiges und kluges Buch mit überraschenden Einblicken in die Wechselbeziehung von Geld, Gesellschaft und Religion.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Gott und Mammon von Andrea Nickel-Schwäbisch im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Mensch – Geld – Mensch
Die fast erotische Lust,
immer mehr haben zu wollen
immer mehr haben zu wollen
Im Gebot, nicht unbegrenzt begehren zu sollen, spiegelt sich die Erfahrung, dass Menschen an ihrer Maßlosigkeit zugrunde gehen können. Maßhalten im Begehren ist nach dem biblischen Zeugnis die Voraussetzung für Glück.
„Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat“ (2. Mose 20,17).
Zunächst erscheint es anstößig, dass auch die Ehefrau zum Besitz des Mannes gerechnet wird. Eine Frau konnte in Israel zwar nicht verkauft werden, wie es nach vielen altorientalischen Gesetzbüchern möglich war, aber sie zählte zum Haus wie Sklaven und Sklavinnen, Tiere und Sachgüter. Darum galt Ehebruch vor allem als Einbruch in den Besitzstand eines anderen Mannes. Die Anstößigkeit der Stellung der Frau wird aber im Laufe der Zeit auch in der biblischen Überlieferung selbst reflektiert. So wird im Paralleltext im 5. Buch Mose die Frau an erster Stelle genannt und damit vom restlichen Hausstand abgehoben. Auch die Verben, die das Verlangen ausdrücken, unterscheiden sich nun. Darin spiegelt sich die Erfahrung, dass das Begehren nach einer Frau und das Begehren nach einer Sache nicht das Gleiche ist. Die Stellung der Frau war der des Mannes nicht ebenbürtig. Wir haben den Schatz der biblischen Wahrheit nur im „irdenen Gefäß“ der kontextuellen Zeitbezogenheit.
Abgesehen von dieser anachronistischen Perspektive auf die gesellschaftliche Stellung der Frau zeigt sich aber auch eine menschliche Erfahrung, die sich bis in die Gegenwart erhalten hat. Es ist der Wunsch des Menschen, immer mehr haben zu wollen, auch auf Kosten anderer. Diese Todsünde hat Luther im Großen Katechismus wie folgt beschrieben: „Denn so, wie die Natur geartet ist, gönnt niemand dem anderen so viel als sich selber, und jeder bringt an sich, so viel er immer kann; ein anderer soll bleiben, wo er mag.“ Während dies im Gebot „Du sollst nicht stehlen“ auf einen konkreten Akt bezogen wird, ist im neunten Gebot die Gesinnung im Fokus. Das Immer-mehr-haben-Wollen kann zum Habitus werden, zur seelischen Grundkonstante, die dann ein Handeln nahelegt.
Wenn es aber aus dem Habitus der Gier zum Handeln kommt, ist dieses oft nicht kriminell wie beim Stehlen, sondern wird rechtlich verbrämt. Noch einmal Luther: „Und sie wollen dabei noch fromm und rechtschaffen sein; sie können uns aufs Feinste etwas vormachen und den Bösewicht vor uns verbergen. Sie suchen und ersinnen schlaue Kniffe und üble Tricks (wie das heute gang und gäbe ist), und bemühen noch das Recht dazu und wagen es, sich vor uns kühn darauf zu berufen und darauf zu pochen. Und sie wollen das alles nicht Bosheit, sondern Gescheitheit und Klugheit genannt haben. Dabei helfen auch die Juristen und die Anwälte mit, die das Recht verdrehen und dehnen, wie’s der Sache am besten dient; sie pressen das Recht und nehmen es zum Vorwand und fragen nicht nach Billigkeit und dem, was dem Nächsten dient. Kurz: Wer in diesen Dingen der Geschickteste und Gescheiteste ist, dem hilft das Recht am besten.“ Es geht also beim neunten Gebot um ein Denken und Verhalten, das das Stigma der Alltagswirklichkeit trägt und durchaus legal sein kann. Dennoch stehen diese Gesinnung und das daraus resultierende Handeln dem Schalom entgegen.
Inwiefern die Habgier dem friedvollen Leben seine Grundlage entziehen kann, wird sehr schön am Beispiel des altgriechischen Mythos des Königssohns Erysichthon deutlich. Dieser lässt einen Baum im Heiligen Hain der Demeter fällen, um damit einen Festsaal für seine Feiern zu bauen. Als Demeter ihn in Gestalt einer Priesterin vor diesem Tun warnen will, spricht er: „‚Hebe dich weg, damit ich nicht meine schwere Axt in deinen Leib schlage! Diese Bäume werden die Balken der Decke meines Saales sein, in dem ich herrliche Mahlzeiten in Fülle mit meinen Freunden feiern werde.‘ So sprach der Jüngling. Demeter aber ergriff unsäglicher Zorn. Sie wurde wieder Göttin und ihr Haupt ragte bis zum Himmel. Sie wandte sich zum gottlosen Herrn: ‚Gut, baue das Haus, in dem du deine Feste feiern wirst – unablässig wirst du deine Feste feiern.‘ Mit diesen Worten verfluchte sie Erysichthon: Er bekam einen unstillbaren Hunger, heftig und wild, der Arme wurde von schrecklicher Krankheit gequält. Nach allem, was er gerade verschlungen hatte, ergriff ihn sogleich wieder die Begierde. Er saß Tag und Nacht an der Tafel seines Palastes, er aß und aß unermesslich viel. Solange er dort noch irgendetwas zum Essen fand, kannte nur der Palast sein Unglück; aber als der unersättliche Jüngling alles im Palast aufgegessen hatte, saß er, der Königssohn, auf der Straße und bettelte um etwas zu essen.“
Der Ökonom Binswanger verweist mit dieser mythologischen Erzählung von der Habgier des Menschen auf unsere auf Wachstum angelegte Wirtschaftsordnung. In dieser wäre ein Verhalten, wie es Erysichthon zeigt, wünschenswert, ja sogar notwendig. Der Mensch soll immer mehr konsumieren, damit die Wirtschaft wächst. Die Wirtschaft wiederum muss wachsen, um die immer größeren Forderungen der Geldwirtschaft zu befriedigen, die auf den Gewinnen von Zins und Zinseszins beruhen. Es darf somit gar keinen abnehmenden Grenznutzen beim Konsum geben. Der Mensch darf niemals satt werden.
Ginge es nur um reale Bedürfnisse, dann wäre der Mensch irgendwann einmal satt. Davon gingen Adam Smith und John Maynard Keynes im Grunde aus. Für Smith war die Gültigkeit des abnehmenden Grenznutzens sogar die Voraussetzung dafür, dass man von einer vernünftigen Regelung der Märkte durch eine unsichtbare Hand ausgehen konnte: „Die Reichen verzehren wenig mehr als die Armen; trotz ihrer natürlichen Selbstsucht und Raubgier und obwohl sie nur ihre eigene Bequemlichkeit im Auge haben, obwohl der einzige Zweck, welchen sie durch die Arbeit all der Tausende, die sie beschäftigen, erreichen wollen, die Befriedigung ihrer eigenen eitlen und unersättlichen Begierden ist, trotzdem teilen sie doch mit den Armen den Ertrag aller Verbesserungen, die sie in der Landwirtschaft einführen. Von einer unsichtbaren Hand werden sie dahin geführt, beinahe die gleiche Verteilung der zum Leben notwendigen Güter zu verwirklichen, die zustande gekommen wäre, wenn die Erde zu gleichen Teilen unter alle ihre Bewohner verteilt worden wäre.“
Und auch für Keynes gab es einen abnehmenden Grenznutzen der Bedürfnisbefriedigung. Er ging, wie wir gesehen haben, davon aus, dass, wenn ein durchschnittliches Einkommen von 46.000 Euro pro Jahr erreicht wäre – und dies erwartete er für das Jahr 2030 –, der Mensch seine Arbeitszeit auf drei Stunden pro Tag reduzieren und sich den wirklich wichtigen Dingen widmen könnte.
Es kam allerdings anders. Zwar wuchs das reale Pro-Kopf-Einkommen, wie es Keynes vorhergesehen hatte, aber die Arbeitszeit ging nicht in dem vorhersagten Maße zurück. Denn anders als Smith und Keynes annahmen, schwindet der Zufriedenheitsgewinn der Menschen schon nach kurzer Zeit, weil sie sich einem höheren Konsumniveau anpassen. Dass es dabei keine Grenzen gibt, hängt damit zusammen, dass es nicht nur Grundlebensmittel, sondern auch Positionsgüter gibt. Der Mensch wird zwar, wie Smith richtig gesehen hatte, irgendwann einmal satt, aber der Hunger nach Gütern, die seine gesellschaftliche Rangordnung begründen, kann trotzdem ungestillt bleiben, auch wenn er mit zunehmendem Reichtum nicht glücklicher wird.
Es gibt im Hinblick auf das Glück einen abnehmenden Grenznutzen des Geldes, und doch bleibt der Wunsch, immer mehr haben zu wollen. In der Glücksforschung zeigt sich immer, dass die Lebenszufriedenheit bei Gehaltserhöhungen nur bis zu einem Gehalt von monatlich 5.000 Euro steigt, wie Köcher und Raffelhüschen in ihrem Glücksatlas Deutschland nachweisen. Und dabei ist noch zu beachten, dass die Glücksteigerungen durch Gehaltserhöhungen in der Regel nur von vorübergehender Natur sind. „Die amerikanische Psychologin Sonja Lyubomirsky bezeichnet die ‚hedonistische Anpassung‘ als das größte Hindernis für dauerhafte Glückssteigerung. Wenn sich die Menschen an mehr Geld und Erfolg gewöhnen, kann das Glücksgefühl nicht wirklich zunehmen … Der Zufriedenheitsgewinn verschwindet wieder, weil sich die Menschen nach einer gewissen Zeit an ein höheres Konsumniveau anpassen … Somit ist die Vorstellung illusionär, dass die Konsumgesellschaft irgendwann einen absoluten Sättigungspunkt erreicht, denn die Menschen gewöhnen sich einfach an höhere Konsumniveaus.“
Warum streben die Menschen dann aber immer noch nach mehr? Warum begehren sie des Nächsten Haus und Besitz? Dies liegt in der Tatsache begründet, dass sich die Menschen stets in Relationen wahrnehmen. Es geht ihnen in der Regel nicht um ihr subjektives Wohlbefinden, sondern um die Frage, ob sich andere eventuell noch wohler fühlen. Darin liegt eine große Quelle der Unzufriedenheit, die Søren Kierkegaard mit dem Satz zusammenfasst: „Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“
„Dass die relative Position zu anderen eine wesentliche Rolle spielt, zeigen auch moderne psychologische Experimente, die seit Kurzem von immer mehr Ökonomen genutzt werden. Man stelle sich beispielsweise vor, man werde vor die Entscheidung gestellt, entweder ein Jahreseinkommen von 30.000 Euro zu beziehen, während die anderen im Mittel über ein Jahreseinkommen von 15.000 Euro verfügen, oder ein Jahreseinkommen von 60.000 Euro zu beziehen, während die anderen ein Einkommen von im Mittel 120.000 Euro erhalten. Obwohl die zweite Wahlmöglichkeit ein doppelt so hohes Gehalt offeriert, stellt diese Frage die meisten Menschen vor keine leichte Aufgabe. Tatsächlich entschieden sich 50 Prozent der Befragten für nur halb so viel Einkommen.“ Was der Glücksatlas Deutschland festhält, bedeutet, dass der sozialen Rangordnung bzw. der empfundenen sozialen Rangordnung eine große Bedeutung zukommt und Menschen bestrebt sind, diese durch den Besitz von Positionsgütern zu steigern. Es ist evident, dass es bei diesem Streben nach Positionsgütern keine Grenze geben kann. Erysichthon macht auch vor dem Heiligen Hain der Demeter nicht halt, nur um sich einen schönen und imposanten Palast zu bauen und mit diesem anzuzeigen, welche gesellschaftliche Position er innehat. Der Ausweis einer Position ist immer steigerungsfähig.
Die Folgen dieses Strebens nach immer mehr werden im Mythos von Erysichthon sehr plastisch geschildert: ‚Unablässig wirst du deine Feste feiern.‘ Mit diesen Worten verfluchte Demeter Erysichthon: Er bekam einen unstillbaren Hunger … Nach allem, was er gerade verschlungen hatte, ergriff ihn sogleich wieder die Begierde.“ Beim Dichter Kalimachos führt diese Gier ins Elend, bei Ovid muss sich Erysichthon am Ende gar selbst aufzehren. Die grenzenlose Gier des Menschen nach Positionsgütern führt zu einer Aufzehrung seiner Lebensgrundlage.
Diese Erfahrung ist auch in der Gegenwart nachzuvollziehen. Im Streben nach immer mehr, im Wahn der Selbstoptimierung, erleben viele Zeitgenossen, wie sie innerlich aufgezehrt werden. Mit Burn-out wird ein Krankheitsphänomen beschrieben, das genau für dieses Empfinden steht, innerlich ausgebrannt und ausgezehrt zu sein.
Der US-Soziologe Richard Sennett untersuchte die Auswirkungen der Arbeitswelt und des Konsums und kam zum Schluss: „Solch ein Wachstum hat einen hohen Preis, nämlich eine wachsende ökonomische Ungleichheit und zunehmende soziale Instabilität … Nur eine bestimmte Art von Mensch vermag unter instabilen, fragmentierten sozialen Beziehungen zu prosperieren. Dieser Idealmensch muss drei Herausforderungen meistern …, er muss mit kurzfristigen Beziehungen [leben und muss bereit sein,] Gewohnheiten aufzugeben und sich von der Vergangenheit zu lösen.“ Im Grunde muss der Mensch, der ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Schmutztitel
- Impressum
- Widmung
- Zum Geleit
- Danksagung
- Das Wesen des Geldes
- I. Teil: Geld im Überblick
- II. Teil:Biblische DimensionenMensch – Geld – Gott
- Mensch – Geld – Mensch