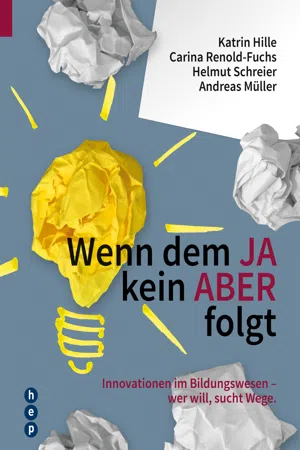Die neue Lebens- und Arbeitswelt braucht eine andere Schule: Wie Frido Koch und sein Team die OSW Wädenswil umbauen.
Von Helmut Schreier
S
chöne Ausblicke bietet die Fahrt mit dem Zug von Zürich am Zürichsee entlang zum Bahnhof Wädenswil, und der weitere Anstieg zu Fuss über Treppen und schmale Wege den Hang hinauf. Beim Vorübergehen an den gepflegten Vorgärten der alten Villen und der neueren Institutsgebäude kommen noch weitere Panorama-Bilder ins Blickfeld, bis wir bei der Grossbaustelle des neuen Schulgebäudes für die Oberstufenschule Wädenswil an der Fuhrstrasse ankommen. Von hier aus öffnet sich bei Sonnenschein der schönste Blick über den Zürichsee. Die älteren Gebäude der Schule liegen gleich neben der Baugrube: Ein Beton-Flachbau mit breiten Fensterbändern und ein zweistöckiger Stapel von Baucontainern, die im Innern miteinander zu geräumigen Sälen verbunden sind.
Schulkultur; © André Dommann
Frido Koch kommt uns entgegen - freundlich, sportlich, erfahren im Umgang mit Besuchern, seit die Schule im Dezember 2013 mit dem Schweizer Schulpreis ausgezeichnet und in der Laudatio von Professor Oelkers eine «Leuchtturmschule» genannt wurde. Frido Koch ist einer von drei Schulleitern (neben Irène Schmid und Martin Gross) im Schulleitungsteam dieser über vier Schulhäuser an drei Orten verteilten Schule. (Ausser Wädenswil gehören die Orte Schönenberg und Hütten dazu.) Die insgesamt 600 etwa dreizehn- bis sechzehnjährigen Schülerinnen und Schüler werden von 70 Lehrpersonen (in 32 Klassen) unterrichtet. – Helvetische Oberstufenschulen werden von Jugendlichen im Anschluss an die sechsjährige Grundschule bis zum Ende der Schulpflichtzeit (zehn Jahre) besucht, – in den meisten Fällen, sollte man vorsichtiger Weise hinzufügen, denn in den 26 Schweizer Kantonen besteht ein breites Spektrum besonderer Formen, zumal auch den einzelnen Kommunen Einfluss auf das Schulwesen zusteht.
Trotz der geographischen Streuung handelt es sich um eine organisatorische Einheit, ein Schulgebilde, das als OSW (Oberstufenschule Wädenswil) ein- und dieselbe Schulidee verfolgt. Für die OSW ist eine besondere, eigens gegründete Kreisschulgemeinde zuständig; die ungewöhnliche öffentlich-rechtliche Konstruktion bringt enge Zusammenarbeit zwischen Schulleitungsteam und Administration mit sich, schafft also beste Voraussetzungen für schnelle Entscheidungen. Die Standorte in den verschiedenen beteiligten Gemeinden vermehren gleichzeitig den Ressourcen-Pool und legen auch die Erprobung von Varianten bei den Reformen nahe, auf die sich die Schule einlässt. Frido Koch erklärt, dass keiner von den drei Schulleitern im Team den anderen gegenüber weisungsbefugt ist; man ist gezwungen, Einhelligkeit herzustellen und sich mit den Vertretern der Kreisschulgemeinde so zu arrangieren, dass ein Zusammenwirken gelingen kann. Ausserdem: «Wenn Schulleiter zusammen arbeiten, werden sie zum Vorbild für Lehrer, und wenn Lehrpersonen zusammen arbeiten, werden sie zum Vorbild für Schülerinnen und Schüler.»
Das sei nicht immer so gewesen: Vor 15 Jahren habe es keine Schulleitung gegeben. Jeder Lehrer und jede Lehrerin war damals im Prinzip unmittelbar der Schulbehörde unterstellt, und Konflikte waren fast unausweichlich: Konflikte mit der Schulbehörde, Konflikte innerhalb der Lehrerschaft, und – wie in einem Spiegel, weil die Schule ja stets einen Zusammenhang bildet – auch Konflikte unter den Schülern und Schülerinnen. In dieser Zeit traten all jene Schwierigkeiten zutage, die beim Übergang von einer Reihe kleiner autonomer Volksschulen hin zu einem neuen Schultypus auftreten, solange keiner die Herausforderung annimmt. Als die Lage allen unerträglich schien, habe man sich an einem Tisch zusammengesetzt, erzählt unser Repräsentant des Schulleitungsteams; damals ging es um die Frage: Wie wollen wir unsere Schule verbessern? Die Zusammenführung zu einem Gebilde, das gleichwohl Raum für lokale Besonderheiten lässt, wurde beschlossen; die Notwendigkeit einer Leitung des Ganzen wurde erkannt. 2002 wurde Frido Koch zusammen mit zwei Kollegen als Schulleiter eingesetzt, und in den folgenden vier, fünf Jahren seien dann die Strukturen erarbeitet worden, die schliesslich zur reibungslosen und konstruktiven Zusammenarbeit führten.
Der Leitgedanke, der seinerzeit dem öffentlichen Leitbild der Schule vorangestellt wurde, setzt den Akzent auf ein ermutigendes Klima: Wir leisten unseren Beitrag für eine ganzheitliche Bildung unserer Schülerinnen und Schüler zu lebensfrohen und verantwortungsbewussten Menschen. Mit unserer positiven Grundhaltung und durch abgestimmte Zusammenarbeit schaffen wir ein Klima von Leistungsbereitschaft und Vertrauen.
Lernlandschaften; ©André Dommann
Das Wort «lebensfroh» fällt aus dem Rahmen dessen, was in den meisten «Schulordnungen» angesprochen wird. Es ist ein passendes Beiwort zur Orientierung dieser Schule am Leben der drei Gemeinden mit ihren Anforderungen und ihren Freuden, wie sich im Lauf dieses Tages immer wieder zeigt. Und ist es nicht auch, nebenbei angemerkt, genau die richtige Medizin zur Vorbeugung gegen die vielfachen im Alter dieser Jugendlichen auftauchenden Pubertäts-Blues-Stimmungen.
Frido Koch weist im Vorübergehen auf ein Plakat an der Tür: Am nächsten Wochenende singt der Gospel- und Soulsänger Edwin Hawkins in der Kirche – die Edwin Hawkins Singers haben das Lied «O Happy Day» weltberühmt gemacht – und der Schulchor wird ihn mit 130 (!) Stimmen begleiten.
Das Ansehen der Schule unter den Schülern spiegelt das Ansehen in der Gemeinde. Die Pflege des «Standing» in der Öffentlichkeit ist Teil des Qualitätsmanagement und der Schulpolitik der OSW. So entsteht – ohne Abgrenzung gegenüber anderen Schulen und ohne äussere Identifizierungsmittel wie Schuluniformen – ein Zugehörigkeits- und Identitätsgefühl unter denen, die hier miteinander lernen.
Im Flur ist in Augenhöhe ein elektronischer Bildschirm in der Grösse einer Wandtafel montiert, der wechselnde Video-Informationen zum Schulleben zeigt. Auf der Plakette daneben lesen wir, dass diese Tafel als Projekt von einem Schüler während der Schulzeit begonnen, aber – in einer Geste der Verbundenheit – erst nach seiner Ausbildung zum Elektrotechniker fertiggestellt und der Schule übergeben wurde.
Schulleiter Frido Koch in einer zur Lernlandschaft umgestalteten Raumflucht
Anstelle von Unterrichtsräumen: Lernlandschaften (eine Hochbaustelle)
Durch die räumliche und administrative Vernetzung der Schule entstehen Spielräume für den Unterricht. Es wird leichter, eine Verbindung von hergebrachten mit neuen Unterrichtsformen zu erproben und einander über Machbarkeit und Tragfähigkeit auszutauschen. Lehrpersonen etwa sollen von Wissensvermittlern zu Lernbegleitern werden, die ihre Schülerinnen und Schüler beim Aufbau von Kompetenzen unterstützen statt sie mittels Zensurenerteilung zu selektieren. Und die hier tätigen Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich tatsächlich darum, besonders «umsichtig» zu sein, – sie haben sich geeinigt auf eine «360 Grad-Umsicht als Instrument zur eigenen Qualitätskontrolle»; das heisst, sie bleiben mit Schülern, Eltern, Kollegen und den Vertretern der Schulaufsicht in Dauerkontakt und sehen bei gleichmässig verteilter Achtsamkeit zu, dass sie möglichst alle Ansprüche zufrieden stellen.
Mir scheint, dass der entscheidende Akzent bei dieser Rundum- Umsichtigkeits-Haltung auf dem Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern liegt. Denn hier kommt eine – angesichts der dominanten Wirklichkeit des Geschehens in Schule und Unterricht allerdings immer noch utopische – Möglichkeit zum Vorschein. An der Stelle, an der die Verwandlung von Lehrern zu Coaches oder Lernbegleitern tatsächlich gelingt, liegt gewissermassen der Schatz vergraben, der die Kraft hat, die herkömmliche Schule zu verwandeln in einen Lernort der Zukunft mit einem auf die persönliche Lage jedes einzelnen Lernenden zugeschnittenen Lernprogramm. Die Lehrer werden zu Gestaltern des personbezogenen Lernens, – sie sehen was passt, was geht, und nehmen wahr, wie jemand am besten weiter zu bringen ist. Als «Lerncoaches» würden sie die Heranwachsenden beobachten und im Dialog mit ihnen «auf Augenhöhe» den Weg entwerfen, der jeden einzelnen entsprechend seinen Anlagen und besonderen Fähigkeiten voranbringen wird.
Lernende und Coaches; © André Dommann
Die Schulgemeinschaft der OSW sympathisiert mit derart immer noch einigermassen utopischen Vorstellungen, ohne sich indes einem solchen Programm völlig zu verschreiben. – «Unsere Schule ist nie einen extremen Weg gegangen, wir haben stets den goldenen Mittelweg gesucht. Unser Weg ist die gute Mischung», sagt Frido Koch. In der öffentlichen Schule kommt es ja, im Unterschied zur Privatschule, darauf an, sich zu verantworten gegenüber einem Ausschnitt der Öffentlichkeit, in der neben fortschrittlichen auch eher konventionelle Kräfte repräsentiert sind. Man kommt weiter mit Vorsicht und Umsicht, die das Neue allmählich ins Alte einspielt und eine Balance sucht, bei der gewissermassen keiner vor den Kopf gestossen wird. Er erläutert das Mischungsverhältnis im Lehrplan der OSW anhand eines Tortendiagramms zur Aufteilung der Unterrichtszeit auf drei gleich grosse Abschnitte. «Input» ist eines der Segmente genannt; damit ist etwa das bezeichnet, was man sich als herkömmlichen Unterricht vorstellen mag, der durch die Lehrperson gesteuert wird und vor allem die Fächer Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik deckt. Besser sollte es «Intake» heissen, bemerkt Koch, denn es kommt ja viel weniger auf das an, was hineingegeben wird, als auf das, was die Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Das zweite Drittel ist dem gewidmet, was als «Fachunterricht» meistens...