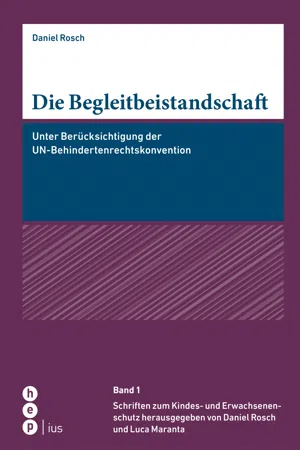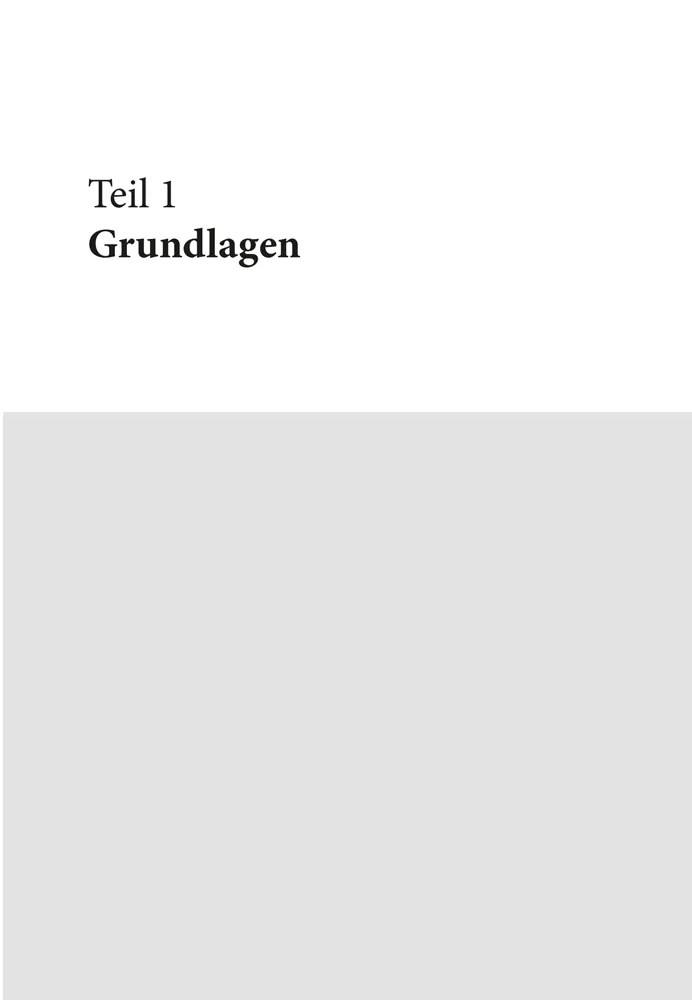I. Grundlagen des Erwachsenenschutzes
1. Ziel und Zweckbestimmung des Erwachsenenschutzes
1
Natürliche handlungsfähige Personen handeln als Rechtssubjekte im Rahmen der Rechtsordnung grundsätzlich selbstständig. Diese Selbstständigkeit kann dann infrage gestellt werden, wenn eine Person einen Schwächezustand aufweist, der ihr Wohl gefährdet und zur Folge hat, dass sie wichtige Angelegenheiten nicht mehr oder nur noch unzureichend besorgen kann. Hier sollen die Instrumente des Erwachsenenschutzes greifen, und zwar in zweifacher Hinsicht: Sie sollen zunächst ermöglichen, dass die schutzbedürftige Person im Rechtsverkehr als eigenverantwortliche Entscheidungsträgerin trotz ihres Schwächezustandes auftreten kann. Die Instrumente haben somit zum Ziel, die Selbstbestimmung der betroffenen Person zu verwirklichen. Zudem kommt den Instrumenten des Erwachsenenschutzes – und hier insbesondere den behördlichen Massnahmen – auch die Aufgabe zu, davor zu schützen, dass sich die betroffene Person aufgrund ihres Schutzbedarfes selbst an Person oder Vermögen schädigt. So kann der Erwachsenenschutz auch darin bestehen, dass eine handlungsfähige Person zu ihrem eigenen Schutz aufgrund eines hoheitlichen Aktes vom Zugang zum Rechtsverkehr rechtlich oder tatsächlich beschränkt wird. Damit enthält der Erwachsenenschutz auch zentrale fremdbestimmende Elemente.
2. Erwachsenenschutz als Teil des Sozialrechts
2
Die schweizerische Rechtsordnung kennt kein Gebiet, das sich «Sozialrecht» nennt. «Sozial» ist letztlich jede Rechtsnorm, da sie Ausdruck des sozialen Kontexts der Gesellschaft ist. Dennoch gibt es Rechtsgebiete, die den Begriff «sozial» tragen, wie Sozialhilfe, Sozialversicherungen etc. Die Begrifflichkeit ist unscharf, und die älteren unterschiedlichen Definitionsversuche haben die sozialpolitische Zwecksetzung als Gemeinsamkeit, weil die Definitionen massgeblich von der sozialpolitischen Literatur geprägt sind.
3
Anknüpfungspunkt des Sozialrechts waren in der Vergangenheit vielfach soziale Spannungen in der Bevölkerung, so insbesondere im Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht. Es ging darum, die damit verbundenen persönlichen und gesellschaftlichen Risiken gerade für unterprivilegierte Bevölkerungsschichten abzufedern. Später kamen Massnahmen hinzu, die unabhängig von einer Schichtzugehörigkeit bestanden, wie Mieterschutz, Opferhilfe Konsumentenschutz. Die dafür ursächlichen sozialen Problemlagen konnte der Einzelne nicht ohne die Mithilfe des Staates verändern respektive verbessern. Sozialrechtliche Massnahmen beinhalten solche zur Gewährleistung «der als notwendig erachteten Lebensbedürfnisse der Daseinsfürsorge und –vorsorge gerade dort, wo sie aufgrund der tatsächlichen Situation (z. B. Wohnungsmarkt) nicht mehr gewährleistet sind. Was zu diesen Lebensbedürfnissen gehört, ergibt sich aufgrund einer gesellschaftlich wandelbaren Wertung. Sozialrecht ist somit Ausdruck des verfassungsmässig verankerten Sozialstaatlichkeitsprinzips (z. B. Art. 12, 19, 29 Abs. 3, 41, 111 f. BV)». Sozialrecht versteht sich nach dieser Auffassung als Querschnittsmaterie zwischen öffentlichem und Privatrecht und umfasst sämtliche rechtlichen Normen, «welche die für die Lebensbewältigung notwendige Teilhabe ermöglichen sollen und zugleich Ausdruck einer besonderen sozialstaatlichen Zielsetzung sind, also auf soziale Absicherung, sozialen Ausgleich, Schutz, Teilhabe und Chancengleichheit ausgerichtet sind.»
4
Gemäss dieser Definition gehören zum Sozialrecht neben den klassischen Bereichen Sozialhilfe–, Sozialversicherungs– und Eingriffssozialrecht auch das Bildungs- und Gesundheitsrecht. Damit ergibt sich eine Ausweitung der Begrifflichkeit von sozialpolitischen auf sozialstaatliche Massnahmen. Diese erscheint angezeigt, weil sich das Gesundheits- und Bildungsrecht häufig mit den klassischen Bereichen des Sozialrechts überschneiden. So beinhaltet das Sozialversicherungsrecht auch gesundheitsrechtliche Fragestellungen, das Kindesschutzrecht findet sich auch im Bildungsrecht etc. Gleiches gilt auch für das revidierte Erwachsenenschutzrecht, in dem diverse Bestimmungen zum Gesundheitsrecht zu finden sind.
3. Erwachsenenschutzrecht als Eingriffssozialrecht
5
Eingriffssozialrecht bezieht sich auf zwei Aspekte: zunächst als Eingriff in die verfassungsmässig geschützten Grundrechte im Bereich des Sozialrechts. Daneben rekurriert der Begriff auch auf Eingriffe im Sinne einer Verwaltungstätigkeit, nämlich auf die Eingriffsverwaltung. Dieser letztere Aspekt wird weiter unten ausgeführt.
6
Zivilrechtlicher Erwachsenenschutz ist nach schweizerischem Rechtsverständnis nicht nur Sozialrecht, sondern – insbesondere bei den behördlichen Massnahmen gemäss Art. 388 ff. ZGB – auch Eingriffssozialrecht. Anknüpfungspunkt des behördlichen Erwachsenenschutzrechtes ist die Handlungsfähigkeit, die faktisch oder rechtlich beschränkt werden kann. Die einzelne Person ist vor Eingriffen in die Rechtsstellung insbesondere durch das Grundrecht der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) geschützt. Dieses bewahrt das Individuum vor Eingriffen des Staates – insbesondere in die körperliche Integrität, in die Bewegungsfreiheit und in die geistige Unversehrtheit. Daneben können weitere Grundrechte tangiert sein. Aufgrund der sich potenziell überschneidenden Schutzbereiche des Grundrechtsrechts auf Privatsphäre nach Art. 13 BV und der geistigen Unversehrtheit als Teil des Grundrechts auf persönliche Freiheit greift Erwachsenenschutz je nach Konzeption des Verhältnisses dieser Grundrechte zueinander mehr oder minder – auch überschneidend – in das Grundrecht auf Privatsphäre ein. Zusätzlich werden auch das Grundrecht auf Menschenwürde (Art. 7 BV) und das Recht auf Ehe (Art. 14 BV) genannt.
7
Dieser grundrechtliche Schutz gilt nicht allumfassend. Gemäss Art. 36 BV können Grundrechte eingeschränkt werden, sofern eine gesetzliche Grundlage besteht, der Eingriff durch ein öffentliches Interesse bzw. durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig ist, das heisst geeignet sowie erforderlich und in einem angemessenen Verhältnis von Eingriffszweck und Eingriffswirkung steht. Zudem ist der Kerngehalt der jeweiligen Grundrechte unantastbar und darf nicht verletzt werden.
8
Die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes bieten eine ausreichende gesetzliche Grundlage für einen Eingriff in die obgenannten Grundrechte. Sie sind angesichts des Eingriffs ausreichend bestimmt und in einem Gesetz im formellen Sinne verfasst. Das öffentliche Interesse ist sozialpolitischer Natur und hat Wohl und Schutz der betroffenen Person zum Inhalte. Mit einer Interessenabwägung im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung kann das Spannungsverhältnis zwischen angeordneter Betreuung und Freiheit bzw. Selbst- und Fremdbestimmung austariert werden.
9
Demgegenüber wird in der deutschen Literatur die These vertreten, dass die Betreuungen (d. h. die Beistandschaften des deutschen Rechts) weitgehend kein Eingriffssozialrecht darstellen würden. Wenn man davon ausgehen könne, dass Sinn und Zweck der Massnahmen auf die altruistisch geprägte Teilhabe am Geschäftsverkehr bzw. am gesellschaftlichen Leben abzielen würden, dann werde mit der Massnahme nicht in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen, sondern diese würden verwirklicht. Die Betreuung ermögliche die gleichberechtigte Teilhabe. So sei es auch Aufgabe der Betreuungsperson, die betreute Person vor unangemessenen staatlichen Eingriffen zu schützen. Nur dort, wo die eigenverantwortliche Entscheidung des Grundrechtsträgers missachtet würde, gehe es um grundrechtlich relevante Eingriffe. Damit würde aber die Betreuungsperson – zumindest nach deutschem Recht – seine Kompetenzen überschreiten. Dementsprechend seien weder die Betreuung noch die einzelnen Handlungen der Betreuungsperson grundrechtlich relevant. Trotzdem bestehe latent die Gefahr, dass die Betreuungsperson im Einzelfall potenziell in die Grundrechte eingreife – insbesondere dort, wo es um ...