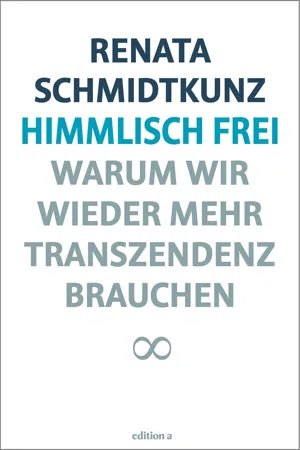
- 192 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Transzendenz ist in unserer wissenschaftsgläubigen Welt in Ungnade gefallen. Sie wird uns vom Mainstream als Esoterik oder Frömmelei vermiest. Doch wer nur noch ein materielles, eindimensionales Leben führt, ist leichter manipulierbar. Denn in der Transzendenz, dem Denken, das über uns selbst und das Irdische hinausgeht, liegt auch die Kraft zur Selbstbestimmung und zum Widerstand.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Himmlisch frei von Renata Schmidtkunz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Philosophy of Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Mein neuer Gott
∞
Woran ich heute glauben kann
Was ist Unendlichkeit? Ich habe viele Jahre meines Lebens nicht darüber nachgedacht und es daher wahrscheinlich auch nicht so genau gewusst. Im Jahr 2007 hatte ich dann das, was man ein Burnout nennt. Die familiäre und berufliche Verantwortung, die auf meinen Schultern lag, war mir, trotz oder vielleicht gerade wegen meiner hohen Leistungsfähigkeit, auf einmal zu viel geworden. Ein erfahrener Mediziner erkannte, was hinter meinen mich unbeweglich machenden Rückenschmerzen steckte, und schickte mich ins Krankenhaus. Zwei Wochen lang sollte ich nun zur Ruhe kommen und von erstklassigen Physiotherapeutinnen wieder mobil gemacht werden. Das Krankenhaus wurde von katholischen Ordensschwestern geführt, die hinter der kleinen, anstaltseigenen Kapelle einen wunderschönen Garten bewirtschafteten. In diesem Garten, unter einem der vielen Apfelbäume liegend, hatte ich in jenem Frühsommer 2007 eine Einsicht. Unfähig zu allem anderen, lag ich nur so da und beobachtete, wie der Wind mit den Blättern des Baumes spielte. Vögel flogen heran und ließen sich nieder, hoben sich wieder in den Himmel empor, und ihr Gesang mischte sich mit dem Rascheln des Laubes. Ein Geräusch, das einen in andere Sphären heben kann, wenn man ihm zuhört.
Das war es, was ich jeden Tag unter diesem Baum suchte: dieses Erleben der aktiven Natur. Ich verstand plötzlich: Dieser Baum steht hier, egal ob es mich gibt oder nicht. Dieser Wind weht, egal ob es mich gibt oder nicht. Es existiert über mich hinaus so viel, das ich gar nicht wahrnehme, von dem ich gar nichts weiß.
Der Gedanke entspannte und erleichterte mich. Denn dass es über mich hinaus so vieles gibt und ich im Vergleich dazu ganz klein bin, bedeutete ja auch, dass ich mich selbst nicht immer ins Zentrum meines Denkens rücken musste.
Das nahm Druck von meinen Schultern und machte mich gleichzeitig neugierig auf das, was da noch ist. Auch darauf, wie andere Menschen mit alldem, mit ihrer Unwissenheit darüber und ihrer Neugierde darauf umgehen, wie sie es sich erklären, welche Konzepte sie dafür entwickeln. Denn schließlich bewegen wir uns alle im gleichen großen Kreislauf und fragen uns, wer oder was hinter diesem großen Kreislauf steht und wer ihn überhaupt erschaffen hat.
Abschied vom alten Mann mit dem Bart
Während der ersten vierzig Jahre meines Lebens war die Antwort auf diese Frage mehr oder weniger klar: Es war der Gott der Bibel, der dies alles geschaffen und so schön und klug bereitet hatte, der Gott Abrahams und Isaaks, der Gott Luthers und meiner Eltern. Von ihm kommen wir, dank ihm leben wir und zu ihm kehren wir zurück. Das war meine Sicht der Dinge. Ich hatte Bilder von diesem Gott und seinem Wirken im Kopf. Der alte, gütige Mann mit dem Bart, der sein Volk aus der Knechtschaft der Ägypter befreit und durch die Wüste geführt hat. Dazu sein Personal. Maria, Josef, Jesus, der Esel. Und auch die älteren Geschichten von der Erschaffung der Welt, der Arche Noah, der Erzmutter Sara und dem Patriarchen Abraham.
Ich fand ihn manchmal langweilig, diesen Gott, aber er war immer da. Wahrscheinlich kam die Langeweile auch daher, dass ich vieles an ihm und den Geschichten, die von ihm berichtet wurden und die in der Bibel nachzulesen waren, nicht verstand. Ich verstand zum Beispiel sehr lange nicht, was Dreifaltigkeit eigentlich ist und kann bis heute sehr gut nachvollziehen, wenn das selbst intelligente und gebildete Menschen nicht verstehen.
Ich bin, wie gesagt, als Tochter eines evangelischen Pfarrers aufgewachsen und lebte lange sehr glücklich in diesem biblischen Universum, mit all seinen Wundergeschichten und erstaunlichen Menschen. Ich hatte im Kindergottesdienst absolute Lieblingslieder. Eins davon ging so:
Lass mich an Dich glauben, wie Abraham es tat! Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Seinen Sohn führt er zum Brandaltar, zu opfern ihn wie’s ihm von Gott befohlen war. Lass mich an Dich glauben, wie Abraham es tat!
Schon als Kind rang ich allerdings um meinen Glauben an diesen Gott, den ich beeindruckend fand, den ich aber nicht verstand. Wie konnte Abraham seinen Sohn zum Brandaltar führen, und würde mein Vater das auch mit mir tun, wenn Gott es von ihm verlangen würde?
Ich schrieb mir dieses Defizit selbst zu. Ich war eben nicht fähig, alles zu verstehen. Gott und Jesus konnten jedenfalls nichts dafür, dessen war ich mir sicher.
Meine Eltern erzogen uns Geschwister in den Erzählungen der Bibel. Wir beteten auch zuhause. Vor jeder Mahlzeit und am Abend, wenn wir schon im Bett lagen. Dann kam unsere Mutter, redete noch ein wenig mit uns und stimmte das Gebet an, das mich durch die Nächte meiner Kindheit trug.
Müde bin ich, geh zur Ruh,
schließe meine Äuglein zu.
schließe meine Äuglein zu.
Vater, lass die Augen Dein,
über meinem Bettchen sein.
über meinem Bettchen sein.
Hab ich Unrecht heut’ getan,
sieh es lieber Gott nicht an.
sieh es lieber Gott nicht an.
Deine Gnad und Christi Blut,
machen alle Sünden gut.
machen alle Sünden gut.
Alle, die mir sind verwandt,
Gott lass ruh’n in Deiner Hand.
Alle Menschen, groß und klein,
sollen Dir befohlen sein.
sollen Dir befohlen sein.
Amen.
Jeden Abend betete ich das voller Inbrunst, selbst, als ich schon lange in Wien und später in anderen Städten wohnte und Theologie studierte. Und erst recht wieder, als meine Tochter geboren wurde. Wenn ich dieses Gebet heute manchmal im Geiste anstimme, ist es ein mir sehr vertrautes Zitat, ein Teil meiner Kindheit, in der ich mich wegen dieses Gebetes geborgen gefühlt hatte.
Der Kindergottesdienst, geleitet von der Gemeindeschwester Christa, die auch mit uns im Pfarrhaus wohnte, war der absolute Höhepunkt der Woche. Ich liebte es, mich am Sonntag schön anzuziehen und ging wirklich freudig erregt in die Kirche. In einem bestimmten Moment des von meinem Vater geleiteten Gottesdienstes verließen wir Kinder, gemeinsam mit Schwester Christa und ihrer lässig über die Schulter gehängten Gitarre, die Kirche und zogen in den Gemeindesaal. Es war mein wöchentlicher kleiner »Auszug aus Ägypten«.
Im Gemeindesaal erwartete uns eine grüne Filzwand. An ihr konnte man die aus Papier gefertigten biblischen Figuren befestigen. So erstanden sie alle, Woche für Woche: Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Ruth, die Moabiterin, König David und König Salomon, Jesus und seine Jünger, der Zöllner und der Mann, der sein Bett in die Hand nahm und ging, weil Jesus ihn geheilt hatte. Das war meine biblische »Wochenschau«. Kein Kino war besser.
Später, wir wohnten schon in einem Oberkärntner Bergdorf, wurde ich selbst Kindergottesdiensthelferin. Nun war es an mir, den Kindern im Gemeindesaal diese Geschichten zu erzählen. Aber da konnte ich es schon nicht mehr. Da waren schon zu viele Fragen in meinem Kopf. Und ich wollte den Kindern nicht etwas erzählen, das mir selbst immer unklarer wurde.
Mein Studium der Theologie erforderte eine Übersiedlung nach Wien. Das war das Ende meiner Karriere im Gestalten von Kindergottesdiensten. Ich war erleichtert.
Im Sommer 1998 reiste ich zum ersten Mal nach Israel. Meine Freunde und Gastgeber, die bereits erwähnte Familie Katzenelson im Kibbutz Shefayim, schickten mich mit den öffentlichen Bussen der Firma Eggeth durch das Land. In diesen Bussen sah ich Drusen und Araber, Soldatinnen und Soldaten der israelischen Streitkräfte IDF, alte Menschen, die aus Deutschland stammten und in Plastiktütchen ihre Brotzeit mit sich trugen, Jecke, wie man sie in Israel nannte, alle miteinander chauffiert von rasanten, älteren Chauffeuren mit bärengroßen Händen, deren Eltern einst aus Marokko oder Syrien, dem Jemen oder dem Irak nach Israel eingewandert waren. Was für eine lebendige, lustige Mischung.
Jeden Tag übernachtete ich bei einem Mitglied der großen und weit verzweigten Familie Katzenelson, die ursprünglich aus Polen nach Eretz, Israel, eingewandert war, eine gewichtige Rolle in der Kibbutzbewegung gespielt hatte und heute verstreut über das ganze Land lebt.
So kam ich auch nach Tel Hazor, eine bis heute aktive Ausgrabungsstätte im Norden Israels, die um 1800 vor unserer Zeitrechnung eine florierende kanaanäische Handelsmetropole war. Hier soll der biblische König David, der Held meiner Kindheit, einen Palast bewohnt haben.
Voller Ehrfurcht, zum ersten Mal in diesem Land zu sein, das meine Kinderseele bevölkert hatte, betrat ich Tel Hazor. Da stand ich nun, zwischen anderen Touristen, und war irgendwie enttäuscht: Dieses kümmerliche, staubige Gemäuer, das da blass in der Sonne stand, sollte der Palast König Davids gewesen sein? In meinen Vorstellungen war David zwar immer ein kleiner Mann (der große war ja Goliath), aber doch ein mächtiger König. Und da war nun dieses Palästchen. Ich war ganz erschüttert.
Ähnlich erging es mir am Jordan. Dort hat nach der biblischen Erzählung Johannes, der Bußprediger und Prophet, Jesus getauft. Wenn ich als Kind diese Geschichte hörte, dachte ich an einen großen breiten Strom, an eine biblische Donau oder einen israelischen Rhein. Doch an den Ufern des Jordans stehend, musste ich erkennen, dass er ein Rinnsal ist, in manchen Monaten des Jahres fast ohne Wasser. Darin soll Jesus getauft worden sein? Echt jetzt?
Meinen vielen, über Jahre und oft für den ORF getätigten Reisen nach Israel verdanke ich einige gute Erkenntnisse über meine eigene Religiosität, aber auch über Religionen im Allgemeinen. Bevor ich zu diesen Erkenntnissen vordringen konnte, musste ich aber mein Kinderglauben-Wissen erst einmal aus dem Weg räumen.
Ich vertiefte mich in die Geschichte der Region, die Geschichte des Zweistromlandes, Vorderasiens, Großsyriens. Ich studierte die Geschichte der großen Reiche, die diese Region über die Jahrtausende hinweg beherrscht haben. Die Assyrer und die Griechen, die Römer und die Mamelucken, die Kreuzfahrer und das osmanische Reich bis hin zu den europäischen Großimperien, die bis heute dort ihre Fäden ziehen.
Lawrence von Arabien, natürlich in Gestalt Peter O’Tooles, war der Held meiner ersten Jahre in Israel. Dazu die Gründerinnen und Gründer der Kibbutzim, die Chaluzim und Chaluzod, die Pioniere und Pionierinnen. Dann erweiterte sich das Bild um die Geschichte der Palästinenserinnen und Palästinenser, die innerhalb und außerhalb der israelischen Grenzen leben, die Teil der modernen israelischen Gesellschaft sind oder in den seit 1967 und zu Unrecht besetzten Gebieten leben.
In der Geschichte und in den Gesichtern der Palästinenser spiegeln sich alle Herrschaftssystemen wider, die sich im Laufe der Geschichte dieses, warum auch immer, so begehrten Stück Landes, in dem Asien, Afrika und Europa einander berühren, bemächtigt haben. Rote Haare, grüne Augen, eine nicht selten anzutreffende Erscheinung im Shuk von Jerusalem. Keltische Kreuzfahrer unter Richard Löwenherz, Franken und Burgunder, Finnen und Byzantiner, alles sieht man in den Jerusalemer Gesichtern.
Jedes Ringen um die Vorherrschaft des eigenen Gottes ist ablesbar. Vergangenheit und Gegenwart versuchen, einander den Rang abzulaufen. Wer will, kann in Jerusalem in das Auge Gottes schauen. Oder, besser gesagt: in das Auge der Vorstellungen, die sich Menschen von Gott gemacht haben und machen.
Wenn ich dort bin, trete ich ganz in den Hintergrund. Dann bin ich nur Ohr und Auge, Nase und Haut. Ich sauge alles in mich auf. All die Ekstase, all die Enttäuschungen und Schmerzen, all das Himmelfliegende, das Berauschende, Beglückende, das Liebe und Kunst, aber auch Hass und Vernichtung mit sich bringt, in sich birgt.
Auch der Gott meiner Kindertage ist dort noch spürbar. Er ist Teil des Konfliktes, so zum Beispiel in den zahlreichen Ausgrabungsstätten in und um Jerusalem. Die sogenannte »Ir David« (Stadt Davids) im Süden der Altstadt gilt als der älteste besiedelte Teil Jerusalems und ist die wichtigste archäologische Fundstelle des biblischen Jerusalem. Heute befindet sich dort das arabische Dorf Silwan. Israelis und Palästinenser beanspruchen das Gebiet gleichermaßen. Die Archäologie wird zum Mittel der Okkupation.
Wenn mich heute jemand fragt, an welchen Gott ich glaube, tauchen vor meinem inneren Auge noch immer spontan die Bilder dieses alten Mannes auf, der das Volk Israel aus Ägypten führte und der der Vater des Jesus aus Nazareth ist. Das ist so, obwohl sich die Grenzen und Strukturen meines Glaubens längst erweitert und transformiert haben.
Wenn ich über den Gott meiner Kindheit, meiner Erziehung und Kultur spreche, sage ich trotzdem nie »Ich glaube«, sondern immer »Ich denke«. Ich denke über den Gott meiner Eltern nach, und ich denke darüber nach, was ich von dem jungen jüdischen Mann aus Galiläa lernen kann.
In einer Epoche der Besetzung seines Landes durch römische Legionäre fühlte er sich berufen, seinen Mitmenschen etwas über einen Gott zu erzählen, dem das gute Leben jedes einzelnen Menschen wichtiger ist als die Einhaltung priesterlicher Gebote. »Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat« (Evangelium nach Markus, Kapitel 2, Vers 27).
Wer das einmal verstanden hat, kann sich wahrhaft himmlisch frei fühlen: Alles, was von Gott, von der Quelle des Lebens kommt, ist für die Menschen da und will wieder Leben hervorbringen. Das war es, was mich im Laufe meines Studiums und auch seither beschäftigt: die Frage, was wir mit dem, was wir das »Göttliche« nennen, anfangen sollen, was es eigentlich bedeutet.
Was ich am Beginn meiner Suche nach einem neuen Gott verstanden zu haben glaubte: Dogmatische Systeme, seien sie religiöser oder politischer Natur, können nur dann eine Berechtigung haben, wenn sie gutes Leben für alle Menschen ermöglichen. Religiöse Herrschaft in meist Männern vorbehaltenen hierarchischen Strukturen, denen es mehr um Gehorsam als um Erkenntnis geht, hat mit Gott nichts zu tun. Sie haben keine Berechtigung. Denn sie dienen nur der Herstellung und Bewahrung eben dieser Herrschaft, und das um jeden Preis.
Wenn wir versuchen, das auf unsere religiöse Geschichte anzuwenden, lässt sich das schnell verstehen. Wie viele Menschen wurden im Laufe der Geschichte von anderen unter Berufung auf Gott oder seine Gebote gequält, verfolgt und ermordet! Meist waren die Verfolgten Menschen, die den anderen in ihrem Verständnis des Göttlichen, des Unverfügbaren, einen Schritt voraus waren.
Wie zum Beispiel der schon genannte italienische Priester, Dichter, Philosoph und Astronom Giordano Bruno, der verstanden hatte, dass Zeit und Raum unendlich sein müssen, und dessen tragisches Schicksal ich bereits beschrieben habe. Während ihn die Katholische Kirche bis heute nicht voll rehabilitierte, haben lange nach seinem Tod, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Relativitätstheorie Albert Einsteins und die Quantenphysik Max Plancks und anderer seine Theorien bestätigt.
Bruno war davon überzeugt, dass auch der erkennende Mensch, jeder und jede Nachdenkende, Teil des Kosmos sei. In dem Moment, in dem der Mensch versteht, dass alles, was ist, eine Einheit bildet, löst sich seine Individualität auf. So dachte Giordano Bruno. Und ich denke heute, dass ich das auch so sehe.
Das Leben, das uns umgibt
Erst jetzt kann ich sagen: ich glaube. Ich glaube daran, Teil einer Ganzheit, einer Einheit von allem zu sein. Von Mensch und Natur, von Zeit und Raum, von hier und jetzt. Alles steht miteinander und zueinander in Beziehung.
Das können wir nur erkennen, wenn wir auf Distanz gehen, zu uns selbst, zum Trubel unserer sich immer mehr erregenden Welt, zu den überbrachten Gottesbildern, zu dem, was uns scheinbare Sicherheit gibt.
Das ist es, was ich meine, wenn ich vom Unverfügbaren rede. Diesem Unverfügbaren müssen wir in all der bereits absurd gewordenen Machbarkeit um uns herum wieder mehr Platz einräumen, in all der scheinbaren Erreichbarkeit, die sich nicht nur in unseren Mobiltelefonen, sondern auch in unserer irrwitzig mobil gewordenen Welt ausdrückt. Ein Wochenende in Barcelona, ein schneller Trip auf die Malediven und zurück.
Was ich von Jesus von Nazareth, aber auch von vielen anderen religiösen Lehren und Menschen, Frauen und Männern, lernen kon...
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Die Entvölkerung des Himmels
- Der Zauber der Welt
- Die entzauberte Welt
- Alles Gute und Schöne
- Mein neuer Gott
- Himmlische Freiheit
- Dank …
- Fußnoten
- Literaturliste