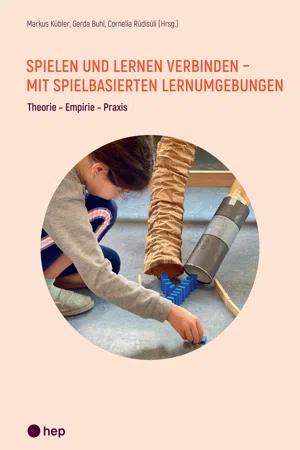
eBook - ePub
Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen (E-Book)
Theorie - Empirie - Praxis
- 268 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen (E-Book)
Theorie - Empirie - Praxis
Über dieses Buch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.Spielen und Lernen zu verbinden - wie gelingt das? Lassen sich die Kompetenzziele des Lehrplans mit der spielerischen Selbststeuerung 4- bis 8-jähriger Kinder vereinbaren? Das Buch bietet dazu eine fundierte theoretische Einführung, einen breiten Überblick über den Stand der Forschung und als Schwerpunkt viele praxistaugliche und erprobte Beispiele zu spielbasierten Lernumgebungen in verschiedenen Fachbereichen. Die Beispiele zeigen auf, wie sich kompetenzorientierter Unterricht in spielbasierten Lernumgebungen verwirklichen lässt.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen (E-Book) von Markus Kübler,Gerda Buhl,Cornelia Rüdisüli, Markus Kübler, Gerda Buhl, Cornelia Rüdisüli im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Bildung & Naturwissenschaften & Technik unterrichten. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil III
Praxis
Fachspezifische spielbasierte Lernumgebungen
Spielintegrierte Wortschatzförderung im Kindergarten
Nadine Itel und Andrea Haid
1 Einleitung
Die Wortschatzerweiterung ist eines der zentralen Spracherwerbsziele von Kindern im Vorschulalter. Wortwissen ist ganz eng mit Weltwissen verbunden. Folglich stellt ein umfangreicher aktiver und passiver Wortschatz eine wichtige Voraussetzung für den schulischen Erfolg dar (Dickinson & Porche, 2011).
Folgendes Beispiel, das in einem Kindergarten mit vielen fremdsprachigen Kindern beobachtet wurde, soll die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Thema verdeutlichen:
Drei Kinder mit beginnendem Deutscherwerb sitzen gemeinsam an einem Tisch und zeichnen. Eines der Kinder hatte am Vortag Geburtstag, der im Kindergarten gefeiert wurde. Es zeichnet einen Kuchen mit Kerzen. Immer wieder schauen die anderen zwei Kinder neugierig auf die Zeichnung. Das Kind bemerkt dies und möchte ihnen berichten, was es gemalt hat: «Das so essen, ’burtstag, so pff» (macht das Ausblasen der Kerze vor). Die anderen Kinder hören zwar zu, keines sagt jedoch etwas und sie wenden sich wieder dem eigenen Blatt zu. Das Gespräch ist beendet. Der Wunsch, sich mitzuteilen, ist vorhanden, jedoch scheitern die Kinder in dieser Situation an den sprachlichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Der Wortschatz, obwohl sie ihn thematisch eingebettet bereits erlebt haben, ist noch nicht genügend gefestigt, wodurch sie für sich keine Sprachvorbilder sind, um daraus gegenseitig lernen zu können. Sie benötigen eine gezielte Förderung.
Mit dem Eintritt in den Kindergarten vollziehen viele Kinder nicht nur einen Schritt in einen neuen institutionellen Kontext, sondern auch in ein neues Sprachlernumfeld. Insbesondere mehrsprachig aufwachsende Kinder finden sich in einem «Sprachbad» wieder und sind herausgefordert, weitgehend ohne eine Form angeleiteten Unterrichts neue Wörter und Satzstrukturen, aber auch morphologische Regeln zu erkennen, Regeln abzuleiten und so ihr Sprachwissen aufzubauen bzw. zu erweitern.
Wie die Kinder auf dieses neue sprachliche Umfeld reagieren und welche Verhaltensweisen sie dadurch zeigen, hängt von der Dauer und Häufigkeit des bisherigen Kontakts mit der neuen Sprache ab (Scharff Rethfeldt, 2013): Zu Beginn des Zweitspracherwerbs kann es eine Schweigephase geben, die unterschiedlich lang dauert. Schweigt ein Kind jedoch über eine längere Zeit, ist eine genaue Analyse des Sprachlernsettings und der dem Kind zur Verfügung stehenden Kommunikationsstrategien indiziert. Wenn ein Kind zu wenige solcher Strategien wie Mimik zeigen und Gestik einsetzen, Blickkontakt aufrechterhalten oder sich von sprachlichen Situationen nicht abwenden kennt, kann es sich erste Wörter nur schwer erfolgreich aneignen. In der zweiten Phase des Zweitspracherwerbs beginnen die Kinder erste Wörter nachzusprechen, floskelhafte Wortverbindungen zu verwenden und sich langsam an die Aussprache der neuen Sprache heranzutasten. Langsam erkennen sie Wörter des Alltagswortschatzes und setzen diesen situationsgerecht ein. Sobald sie ein grösseres Repertoire aufgebaut haben, kombinieren sie Wörter in der dritten Phase zu Sätzen, womit die vierte Phase mit dem Erwerb der grammatischen Regeln beginnt. Gewisse Strukturen der deutschen Sprache wie z. B. Pluralformen, die Konjugation unregelmässiger Verben oder die verschiedenen Fallformen sind jedoch lange von Fehlern gekennzeichnet, was aber in diesem Prozess normal ist. Um diese zu beherrschen, benötigen die Kinder viel Sprachkontakt. Für den Aufbau der Bildungssprache Deutsch bedarf es zum einen der Auseinandersetzung mit Büchern und zum anderen des angeleiteten Sprachunterrichts, in welchem diese schwierigen Strukturen der deutschen Sprache vermittelt werden. Für den Erwerb der Alltagssprache benötigen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache rund zwei Jahre und für die Bildungssprache, die Voraussetzung für das differenzierte Verständnis der schulisch vermittelten Inhalte ist, bis zu fünf Jahre (Scharff Rethfeldt, 2013).
Im Folgenden wird zuerst auf die Bedeutung der Wortschatzförderung im Kindergarten eingegangen. Im Anschluss daran werden Strategien zur Wortschatzförderung vorgestellt und die Phasen des Wortschatzerwerbs beschrieben. Wie Wortschatz im Spiel und integriert in Spielsituationen aufgebaut und gefestigt werden kann, wird in Abschnitt 4 und 5 ausgeführt.
2 Wortschatzförderung im Kindergarten
Kinder benötigen einen Grundwortschatz, um in der alltäglichen Kommunikation eine aktive Rolle einnehmen und an ersten Gesprächen teilhaben zu können. Fehlt ihnen dieser, sind sie nicht nur mit sprachlichen Herausforderungen konfrontiert, sondern teilweise auch mit missverständlichen Reaktionen seitens der Interaktionspartner. So kann es beispielsweise vorkommen, dass auf eine Aufforderung der Lehrperson, ein Schneidebrett für den «Znüni» zu holen, das Kind seinen eigenen Znüni holt, weil es nur das Wort «Znüni» verstanden hat. Natürlich merkt es aufgrund der Reaktion der Lehrperson, dass es nicht richtig gehandelt hat. Solche Missverständnisse können Kinder verunsichern oder frustrieren. Ebenso ist für die Teilhabe an Spielinteraktionen mit den Gleichaltrigen die Grösse des Wortschatzes ausschlaggebend: Kinder, die wenig verstehen, werden seltener von anderen Kindern ins Spiel einbezogen (Gertner, Rice & Hadley, 1994), sind häufiger Aussenseiter und spielen «bevorzugt» allein. Dabei ist stets zu hinterfragen, ob es sich um ein charakterspezifisches Bedürfnis handelt, dass ein Kind gerne Zeit allein verbringt oder ob eine Sprachbarriere ein Grund dafür sein könnte.
Kinder, die nicht adäquat reagieren, wenn sie von einem anderen Kind angesprochen werden, sind bei ihren Peers am wenigsten beliebt, anders als dies beispielsweise bei einem Kind mit einer reinen Aussprachestörung der Fall ist (Bucheli, 2017). Ein nicht kompetenter Sprecher zu sein hat einen Einfluss auf die Häufigkeit der Peerinteraktionen, die im Vorschulalter fast ausschliesslich im Spiel stattfinden. Nicht zu unterschätzen ist die psychosoziale Folge der häufigen Ablehnung durch andere Kinder. Der soziale Rückzug von Kindern mit eingeschränkten Sprachkompetenzen kann in eine Negativspirale führen: Je weniger Kontakt sie mit anderen Kindern haben, umso weniger erhalten sie Lerngelegenheiten zur Erweiterung der Zweitsprache, was wiederum dazu führt, dass sie noch weniger Kontakt zu den anderen Kindern aufnehmen (Licandro & Lüdtke, 2012). Dieser Entwicklung muss dringend entgegengewirkt werden, indem einerseits im Rahmen von geführten Fördersequenzen gezielt Wortschatz vermittelt und aufgebaut wird und andererseits die Kinder im Rahmen von begleiteten Spielsequenzen in ihren Interaktionen mit anderen Kindern unterstützt werden (Licandro, 2014). Diese Wechselwirkung von Wortschatz und den daraus resultierenden Kommunikationsmöglichkeiten und Interaktionen mit Peers muss bei der Förderung im Kindergarten berücksichtigt werden. Es gilt, zum einen den Blick auf die gezielte Erweiterung von Wortschatz und zum anderen auf die Etablierung eines Fördersettings zu richten, das spielerische Elemente zur Steigerung der Interaktionsmöglichkeiten der Kinder integriert.
3 Strategien der Wortschatzförderung
In vorschulischen Bildungseinrichtungen findet Sprachförderung häufig entweder in offenen oder angeleiteten Interaktionen, aber kaum in einem unterrichtsähnlichen Setting statt. Die Lehrperson muss deshalb durch ihr pädagogisches Handeln ein sprachförderliches Lernumfeld schaffen (Licandro & Lüdtke, 2012), wobei der Fokus nicht in erster Linie auf dem Lernmaterial (dem WAS), sondern auf der Interaktionsqualität (dem WIE) liegt (Weltzien, 2014). Damit sind spezifische Verhaltensweisen angesprochen, die die Lehrperson einsetzt, um den Kindern gezielt bedeutungsvollen Sprachinput und Wortschatz anzubieten. Solche Verhaltensweisen oder sogenannte Sprachförderstrategien sind vergleichbar mit der kindgerichteten Sprache (KGS), die aus den frühen Mutter-Kind-Dialogen bekannt sind. Mütter passen ihren Sprachinput intuitiv dem Kind an (Hoff-Ginsberg, 2000). Der Sprachinput der Mutter zeichnet sich im ersten Lebensjahr des Kindes durch ein langsames Tempo, starke Betonung und Intonation aus (sogenannter Baby Talk). Im zweiten Lebe...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Copyright
- Inhaltsverzeichnis
- Geleitwort
- Vorwort
- Teil I: Theorie
- Teil II: Empirie
- Teil III: Praxis
- Anhang
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis