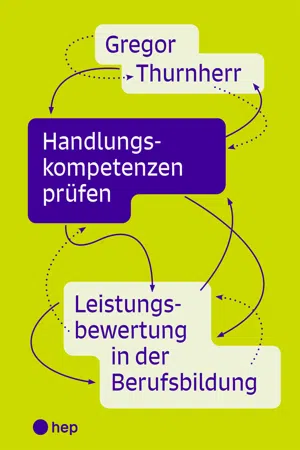![]()
1 Handlungskompetenzorientierung in der Berufsbildung
Damit man Handlungskompetenzen prüfen und beurteilen kann, ist ein klares Verständnis nötig, was die Begriffe «Kompetenz» und «Handlungskompetenz» bedeuten und beinhalten. Ein vertieftes Begriffsverständnis hilft bei der Gestaltung von Prüfungen. Es bildet für die Prüfenden die Grundlage für die Auswahl von Prüfungsformen, dient der zuverlässigen Durchführung und fairen Bewertung.
![]()
1.1 Kompetenz und Handlungskompetenz – Klärung und Abgrenzung der Begriffe
Die Begriffe «Kompetenz» und «Handlungskompetenz» sind nicht eindeutig und allgemeingültig definiert. Sie werden unterschiedlich verstanden und interpretiert (vgl. Kaufhold 2006). So stehen am Anfang dieses Kapitels die Fragen:
Zuerst wird der Begriff «Kompetenz» vorgestellt und anschließend das Verständnis von Handlungskompetenz dargelegt. Letzteres ist besonders für das Prüfen und Beurteilen in der Berufs- und Weiterbildung von großer Bedeutung und wird deshalb ausführlicher beschrieben.
Die folgenden Unterkapitel zeigen die Dimensionen und Bereiche von Handlungskompetenzen auf und wie man Handlungskompetenzen formuliert. Die Kompetenzdimensionen und -bereiche haben für das Buch eine leitende Funktion.
1.1.1 Kompetenzbegriff
Der Kompetenzbegriff lässt sich zum Beispiel aus pädagogischer, (arbeits-)psychologischer und handlungstheoretischer Sicht betrachten. So wird er unterschiedlich verwendet und noch immer kontrovers diskutiert. Es lassen sich trotz der Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit in der Begriffsdefinition gemeinsame Merkmale erkennen (vgl. Kaufhold 2006). Demnach zeichnet sich eine Kompetenz durch folgende Elemente aus:
Kompetenz äußert sich in der Bewältigung von Situationen, die in einem bestimmten Rahmen und in einem bestimmten Umfeld beziehungsweise Zusammenhang (Kontext) vorkommen. Personen bewältigen Situationen mit einem angepassten und erkennbaren Handeln. Der Zusammenhang von Handlung und Situation ist besonders bei der Beurteilung von beruflichen Handlungskompetenzen bedeutsam (siehe Abschnitt 1.1.2). Kompetenz zeigt sich somit nur in Situationen, in denen sie tatsächlich gefordert ist und zur Anwendung kommen kann. Personen beurteilen Situationen subjektiv und somit individuell. Diese Subjektivität beeinflusst die Art der Bewältigung beziehungsweise das Handeln, was die Beurteilung der Kompetenzerreichung erschwert. Kompetenz lässt sich entwickeln und bleibt nicht konstant. Man kann Kompetenz also erlernen (vgl. Kaufhold 2006).
Mehrere Autoren (z.B. Weinert 2001) beschreiben Kompetenz als eine Ausprägung beziehungsweise als das Potenzial, geistige, personale und praktische Fähigkeiten für die Lösung von Problemen einsetzen zu können. Dieser Definition liegt die alte Trias Geist–Körper–Seele zugrunde oder das, was Pestalozzi unter Kopf, Herz und Hand versteht (vgl. Walzik 2012). Andere Kompetenzdefinitionen bezeichnen diese drei Dimensionen einer Kompetenz mit Wissen, Wollen und Können (vgl. Wollert 1997, in Hof 2002). Darauf gehe ich in Abschnitt 1.1.3 vertieft ein.
Le Boterf (2000) betrachtet Kompetenz aus einer arbeitspsychologischen Sicht, welche die frankophone Auffassung von Kompetenz widerspiegelt. Er verwendet für individuelle Kenntnisse, Fertigkeiten, geistige Fähigkeiten sowie Umfeldbedingungen, Vorwissen und Erfahrungen den Begriff «Ressourcen». Sie sind also die Quelle, Grundlage oder das Potenzial einer Person, Arbeitssituationen zu bewältigen.
Auch die in der Berufsbildung weitverbreitete KoRe-Methode legt Kompetenzen Ressourcen zugrunde: Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen.
Kompetenz ist bei Le Boterf und in der KoRe-Methode die Befähigung, diese Ressourcen gezielt einzusetzen und zu kombinieren, um Arbeitssituationen zu bewältigen (vgl. Thomann 2011).
1.1.2 Handlungskompetenz
Wie beim Kompetenzbegriff bestehen auch für den Begriff der Handlungskompetenz verschiedene Definitionen. Ihnen ist gemeinsam, dass man davon ausgeht, eine kompetente Person verfüge über eine Auswahl von Handlungsmöglichkeiten, um eine Situation selbstorganisiert zu bewältigen. Man spricht dabei von einem ganzheitlichen Handlungsrepertoire, einer (Selbstorganisations-)Disposition oder von Ressourcen. Handlungskompetenzen sind komplex und nicht zwingend die Summe von Teilkompetenzen (vgl. Hundenborn & Kühn-Hempe 2006).
Die folgende Definition von Handlungskompetenz ist grundlegend für das Verständnis des Begriffs in diesem Buch. Sie ist eine Zusammenführung der beiden aktuellen Begriffsbestimmungen der nationalen, zuständigen Stellen in Deutschland (vgl. KMK 2007) und der Schweiz (vgl. SBFI 2017). Sie bezieht zudem die Definition von Erpenbeck (2009) ein.
Definition
Handlungskompetent ist, wer komplexe und zukunftsoffene Situationen eigeninitiativ, zielorientiert, fachgerecht, situationsgerecht und sozial verantwortlich bewältigt.
Doch was bedeuten die verschiedenen Begriffe, die in der Definition verwendet werden? Der Begriff «Situation» ist umfassend und schließt berufliche, gesellschaftliche und private Situationen ein. Komplex ist eine Situation, wenn sie vielschichtig und fachübergreifend ist. Es gilt, verschiedene Aspekte, Perspektiven und Rahmenbedingungen für die Bewältigung zu berücksichtigen. Eine kompetente Person muss mit unscharfen oder fehlenden Zielvorstellungen und Unbestimmtheit umgehen können. Nicht immer ist voraussehbar, wie die Situation bewältigt werden kann und welche Konsequenzen damit verbunden sind. Deshalb passt die Charakterisierung «zukunftsoffen».
Bei der Beschreibung der Begriffe «eigeninitiativ», «zielorientiert», «fachgerecht», «situationsgerecht» und «sozial verantwortlich» nehme ich Bezug [Hinweise in eckigen Klammern] auf die in den Abschnitten 1.1.3 und 1.1.4 beschriebenen Kompetenzmodelle «Wissen x Können x Wollen» beziehungsweise «Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz».
«Eigeninitiativ» äußert den Anspruch, eine berufliche Situation nicht nur selbstständig im Sinne von allein und ohne Hilfe von Dritten auszuführen, sondern bewusst, gewollt und selbstorganisiert. «Eigeninitiativ» geht im Erfüllungsgrad also über «selbstständig» hinaus. Eine (Arbeits-)Situation soll demnach aus eigenem Antrieb beziehungsweise aus eigener Initiative gemeistert werden können. Die Eigeninitiative ist eine Ausprägung der Kompetenzdimension [Wollen] (siehe Abschnitt 1.1.3) beziehungsweise des Kompetenzbereichs [Selbstkompetenz] (siehe Abschnitt 1.1.4).
«Zielorientiert» ist ein weiterer Anspruch, wie berufliche Aufgaben und Tätigkeiten auszuführen sind. Es geht dabei darum, eine berufliche Handlung geplant und auf das Ergebnis ausgerichtet durchzuführen. Dabei ist es wichtig, die entsprechenden Ziele zu kennen und zu verstehen. Das Vorgehen ist systematisch, methodisch abgestützt und stringent im Sinne von logisch und schlüssig. Zielorientierung drückt einen Aspekt von Professionalität aus. Um zielorientiert vorgehen zu können, muss man über Fachwissen verfügen [Wissen/Fachkompetenz, Methodenkompetenz] und einen Antrieb haben, die Situation selbstorganisiert zu bewältigen [Wollen/Selbstkompetenz]. Ein günstiges Vorgehen erfolgt geplant und mit priorisierten Arbeitsschritten. Es wendet zweckdienliche Methoden und Verfahren an [Können/Methodenkompetenz]. Dabei ist in der beruflichen Realität nicht immer klar, was das Ergebnis des Vorgehens sein wird. Die Arbeitssituation kann demnach zukunftsoffen sein.
Eine Arbeitshandlung wird dann fachgerecht ausgef...