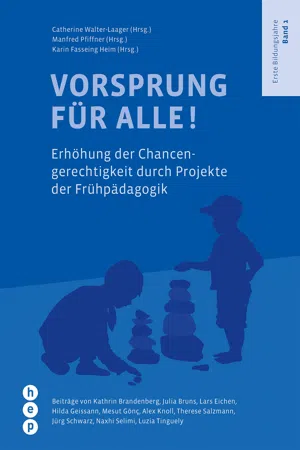
Vorsprung für alle!
Erhöhung der Chancengerechtigkeit durch Projekte der Frühpädagogik
- 232 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Vorsprung für alle!
Erhöhung der Chancengerechtigkeit durch Projekte der Frühpädagogik
Über dieses Buch
Dieses E-Book enthält komplexe Grafiken und Tabellen, welche nur auf E-Readern gut lesbar sind, auf denen sich Bilder vergrössern lassen.Im Anschluss an den PISA-Schock in Deutschland und den umliegenden Ländern anfangs des neuen Jahrtausends wird das Potenzial des vorschulischen Bereichs als Bildungsreserve in Forschung und Politik rege und teilweise auch kontrovers diskutiert. Forderungen, welche die Bildungschancen aller Kinder erhöhen, sind schneller formuliert, als wissenschaftsbasierte Interventionen und Programme entworfen werden. In diesem Band werden mehrere Projekte mit ihren Ergebnissen beschrieben und Ideen für die Praxis formuliert. Mit der vorliegenden Publikation wird eine Buchreihe ins Leben gerufen, die Anliegen und Weiterentwicklungen der ersten Bildungsjahre aufnimmt, thematisiert und Impulse für die praktische Arbeit gibt. Im Zentrum steht dabei die Professionalisierung der institutionellen Bildung, Betreuung und Erziehung im Frühbereich sowie der ersten Jahre des öffentlichen Schulsystems.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Jetzt geht’s los!
Den Übergang von der Familie in den Kindergarten professionell gestalten
Karin Fasseing Heim
6
1
Einleitung
2
Die vielfältigen Anforderungen der Transition
2.1
Transitionen – eine Begriffsbestimmung in Kürze

2.2
Der Transitionsprozess als Entwicklungsaufgabe
2.2.1
Die individuelle Ebene
2.2.2
Die interaktional-soziale Ebene
2.2.3
Die ko...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit – eine Übersicht
- Lernchancen für Kinder in fokussierten Spielumwelten
- Eltern-Kind-Interaktionen mit Bildungsgehalt
- BiLiKiD-Spielgruppen
- Beobachten und Dokumentieren
- Jetzt geht’s los!