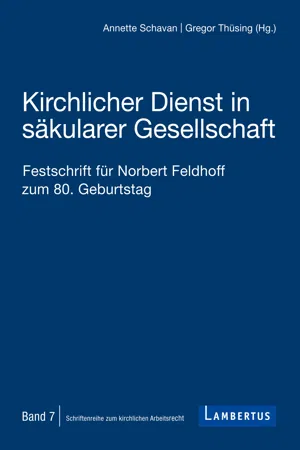
Kirchlicher Dienst in säkularer Gesellschaft
Festschrift für Norbert Feldhoff zum 80. Geburtstag
- 680 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Kirchlicher Dienst in säkularer Gesellschaft
Festschrift für Norbert Feldhoff zum 80. Geburtstag
Über dieses Buch
Anlässlich seines 80. Geburtstages widmen rund 40 Kollegen und Weggefährten aus Politik, Kirche, Caritas und Wissenschaft dem Jubilar Prälat Dr. iur. utr. h.c. Norbert Feldhoff, ehemaliger Domprobst und Generalvikar von Köln, ehemaliger Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes, diese Festschrift zum Thema "Kirchlicher Dienst in säkularer Gesellschaft". Die zahlreichen Beiträge, die sich – aus ganz unterschiedlichen Perspektiven - dem Thema nähern, sind so vielfältig wie die Interessen- und Arbeitsgebiete des Jubilars. Die Festschrift bietet damit eine einzigartige Zusammenstellung wesentlicher Beiträge zum hochaktuellen Diskurs um das deutsche kirchliche Arbeitsrecht, eingebettet in den derzeitigen (kirchen-)politischen und juristischen Kontext und das einzigartige Lebenswerk des Jubilars.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Mutatur, non tollitur
Kirchliche Dienstgemeinschaft als Grund und Grenze der Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts
Gregor Thüsing und Regina Mathy
I. Die Besonderheiten des Dienstes für die Kirche
1. „Dienstgemeinschaft“ – Ein umstrittener Begriff
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Zum Geleit
- Norbert Feldhoff und die Kunst des Politischen
- Mehr als Paragraphen
- Kollektive Konflikte in kirchlichen Einrichtungen
- Kirchlicher Dienst in der pluriformen Moderne als Ort der Kirche
- Norbert Feldhoff als Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission
- Kirchlicher Dienst in säkularer Gesellschaft
- Kirchlicher Dienst und caritatives Unternehmertum in säkularer Gesellschaft
- Als Caritas glaubwürdig in Märkten handeln
- Arbeitsstreitigkeiten im katholischen Kirchenarbeitsrecht
- Der KODA-Vermittlungsausschuss
- Kirchlicher Dienst in säkularer Gesellschaft
- Einrichtungsübergreifende Mitbestimmung in der katholischen Kirche
- Der „Kölner Weg“ des kirchlichen Arbeitsrechts in der Dombauhütte zu Köln
- Kirchliche Spiritualität und kirchliche Rechtsbeziehungen
- Richter-Fenster und kirchliches Arbeitsrecht
- Kirchlicher Dienst in säkularer Gesellschaft
- Die Einbindung von Gewerkschaften in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes
- Vom personen- zum institutionenorientierten Verständnis kirchlichen Arbeitsrechts?
- Liebe auf Distanz?
- Einrichtungsspezifische Arbeitsrechtliche Kommissionen
- Begrenzung befristeter Dienstverhältnisse in der Dienstgemeinschaft Katholische Kirche
- Im Dienst der Kirche
- Die Geltung des kirchlichen Arbeitsrechts im säkularen Arbeitsverhältnis
- Auswirkungen der Veränderungen der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission
- Die Bedeutung des Arbeitsvertrags für den Dritten Weg
- 70 Jahre GG – 100 Jahre WRV
- „Ehe für alle“
- „So ist also die Caritas der Dampf in der sozialen Maschine“
- Reformbedarf der MAVO, insbesondere für Mitarbeitervertretungen pastoraler Dienste
- Der Europäische Gerichtshof als Impulsgeber für das kirchliche Arbeitsrecht
- Der EuGH als Promotor eines neuen Loyalitätsrechts
- Die Grundordnung für die Arbeitsverhältnisse in der katholischen Kirche
- Deutsches Staatskirchenrecht im Blick der Europäischen Union
- Gesandt in die Welt von heute
- „Nichts über uns ohne uns!“
- Mutatur, non tollitur
- Die katholische Soziallehre vor neuen Herausforderungen
- Theologische Fakultäten in einer säkularen Gesellschaft
- Mit seelischer Schwungkraft
- Zur Auslegung kirchlichen Rechts durch staatliche Gerichte
- „Der Mensch ist der Weg der Kirche“
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- Lebenslauf