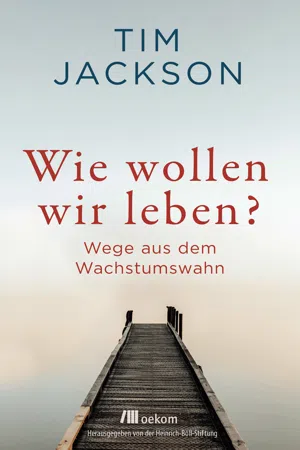
- 304 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
»Ökonomische Weisheit, verpackt in Poesie – das kann nur Tim Jackson. Eine wundervolle Lektüre!« Kate Raworth, Autorin von »Die Donut-Ökonomie«
Seit Jahrzehnten richten wir unser Leben an der Überzeugung aus, dass »besser« auch immer »mehr« heißen muss. Doch das Streben nach ständigem Wachstum hat zu ökologischer Zerstörung, sozialer Instabilität und einer globalen Gesundheitskrise geführt. Wenn Wachstum uns so sehr schadet, warum verabschieden wir uns dann nicht davon?
Tim Jackson stellt dem Mythos Wachstum seine Vision einer Gesellschaft gegenüber, die uns ohne Wachstum reicher macht statt ärmer. Sein Buch ist nicht nur ein Manifest für ein anderes Wirtschaftssystem, sondern vor allem eine Einladung, darüber nachzudenken, was das Leben lebenswert macht.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Wie wollen wir leben? von Tim Jackson im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Política y relaciones internacionales & Política. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kapitel 1
Der Mythos vom Wachstum
»Wir stehen am Beginn eines Massenaussterbens.
Und Sie reden über nichts anderes als über Geld und
Märchen vom ewigen Wachstum.«
Und Sie reden über nichts anderes als über Geld und
Märchen vom ewigen Wachstum.«
Greta Thunberg, September 20191
»Viel zu sehr und viel zu lange haben wir persönliche Qualitäten und gemeinschaftliche Werte über der bloßen Anhäufung materieller Dinge vernachlässigt.«
Robert F. Kennedy, 19682
St. Patrick’s Day, 17. März 1968. Es war ein für die Jahreszeit milder Sonntagabend. In der Nachtluft lag schon ein Hauch von Frühling, als Senator Robert F. Kennedy aus New York in Kansas eintraf. Er hatte gerade an diesem Tag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 1968 angekündigt. Um für die Demokraten nominiert zu werden, würde er sich gegen den amtierenden Präsidenten Lyndon B. Johnson durchsetzen müssen. Senator gegen Präsident; Demokrat gegen Demokrat: Das versprach ein harter Kampf zu werden, und Kennedy war sich seines Erfolgs keineswegs sicher.3
Umso erstaunlicher war der Empfang, der ihn und seine Frau Ethel erwartete, als sie über die Gangway herab den Boden von Kansas City betraten: Einige Tausend Anhänger hatten die Polizeiabsperrung durchbrochen und stürmten über die Rollbahn auf die beiden zu. »Los, Bobby, los!«, riefen sie und verlangten eine Rede. Nichts war vorbereitet und ein Megafon gab es auch nicht. Sportlich warf Kennedy ein paar Sätze in den Wind, als er merkte, dass er kaum zu verstehen war. »Das war meine allererste Wahlkampfrede«, sagte er, »und jetzt Applaus!« Er klatschte in die Hände, die Zuhörer ebenfalls, und alle lachten. Das sah nach einem vielversprechenden Anfang für einen Präsidentschaftswahlkampf aus.
Der Senator war noch merklich nervös, als er am nächsten Morgen in der Kansas State University (KSU) eintraf, um seine erste offizielle Wahlkampfrede zu halten. Adam Walinsky, sein Redenschreiber, hatte sie für den Anlass sorgfältig ausgearbeitet. Der erste Eindruck ist immer wichtig. Niemand im Kampagnenteam konnte seine Wirkung vorhersagen. Kansas war einer der konservativsten Bundesstaaten, dem Establishment und der amerikanischen Flagge treu ergeben. Es war wahrscheinlich der letzte Ort, an dem man mit Sympathie für Robert F. Kennedys Antikriegsbotschaft rechnen konnte.
Um gleich beim Einstieg zu punkten, eröffnete er die Rede mit einem Zitat von William Allen White, dem ehemaligen Herausgeber einer Zeitung hier in Kansas. »Wenn unsere Hochschulen und Universitäten keine [Studierenden] heranziehen, die Randale machen und rebellieren, die das Leben mit der ganzen visionären Kraft der Jugend angehen, dann stimmt etwas nicht mit unseren Hochschulen«, sagte er. »Je mehr Aufruhr in unseren Universitäten, desto besser für die Welt von morgen.« Es war ein aufrichtiger Appell an die Generation, die die Anti-Vietnam-Protestbewegung aus den Ghettos heraus auf die Gelände liberaler, bürgerlicher Universitäten in ganz Amerika gebracht hatte. Die Studenten waren begeistert. Kennedys Eröffnungssalve wurde mit »freudigem Getöse« begrüßt.4
Die Erregung war mit Händen zu greifen. Die Studierenden im Saal – zum Teil auf den Dachbalken hockend – bejubelten seinen Rundumschlag gegen den Vietnamkrieg, seine Verachtung für die Johnson-Regierung und seinen Ärger über die mangelnde Moral der zeitgenössischen US-Politik im In- und Ausland. Das war kein vorsichtiges Eröffnungsgeplänkel einer sorgfältig austarierten Präsidentschaftskampagne. Das war Sprengstoff. Die Rede wurde besser aufgenommen, als irgendjemand zu hoffen gewagt hatte. Augenzeugen beschreiben, wie ein Journalist – der Fotograf Stanley Tettrick vom Look Magazine –, umzingelt von der Masse, versucht, sich mitten im Tumult auf den Füßen zu halten, und in den Saal schreit: »Wir sind in Kansas, im gottverdammten Kansas! Er wird das voll durchziehen!«5
Bobby Kennedy sollte es nicht bis zum Schluss »durchziehen«, die Geschichte hatte es anders bestimmt. Aber niemand wusste das am Eröffnungstag dieses verhängnisvollen Präsidentschaftswahlkampfes. Das Team war in Ekstase. Die Kampagne war auf den Weg gebracht. Die Journalisten hatten ihre Story; und die Medienberichterstattung würde ihrem Kandidaten keinen Schaden zufügen können. Es war große Erleichterung zu spüren, als sich das Gefolge zur zweiten Rede des Tages auf den Weg machte, bei dem großen sportlichen Rivalen der KSU, der University of Kansas (KU).
Walinsky nutzte die kurze Fahrt, um die Rede, die er für die zweite Veranstaltung vorbereitet hatte, schnell nochmal umzuschreiben. Sie war ursprünglich als eher ruhiger und ausgewogener Vortrag geplant, um den Senator auch von seiner nachdenklichen, intellektuellen Seite zu zeigen. Eine Passage, die für uns besonders interessant ist, drehte sich um den Nutzen und Missbrauch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – also die Kennziffer, mit der Wirtschaftswachstum gemessen wird. Für eine Wahlrede war das ein eher ungewöhnliches, schwer zugängliches Thema. Ein Zeugnis für die Radikalität von Kennedys politischer Vision. Um ein Haar hätte die Passage die Revision der Rede nicht überlebt.
Kennedy war überrascht und beglückt von der begeisterten Reaktion auf seine Rede am Morgen und wollte für den Nachmittag mehr davon. Er wies seinen Redenschreiber an, den nüchternen Teil loszuwerden und dem Vortrag ein bisschen von der Schärfe des Vormittags zu geben. Das Ergebnis könnte man mit etwas Nachsicht als Mischmasch bezeichnen: Abschnitte aus früheren Reden verwoben mit Anekdoten und ab und zu einem gut platzierten Scherz. Durch Zufall blieb die Passage zum BIP im Text. Diese kleine Laune des Schicksals sollte für das vorliegende Buch eine enorme Rolle spielen – und im Übrigen auch für das Leben seines Autors, der zu der Zeit, als das alles geschah, noch ein Kind war.6
Zur Bedeutung des Mythos
Jede Kultur, jede Gesellschaft hält an einem Mythos fest, nach dem sie lebt. Unser Mythos ist der des Wachstums. Denn solange die Wirtschaft wächst, fühlen wir uns sicher und in der Vorstellung bestärkt, dass das Leben besser wird. Wir glauben, dass wir Fortschritte machen – nicht nur als Individuen, sondern auch als Gesellschaft. Wir leben in der Überzeugung, dass die Welt von morgen ein noch strahlenderes Leben für unsere Kinder und für deren Kinder bereithält. Wenn das Gegenteil passiert, macht sich Ernüchterung breit. Unsere Stabilität ist von Zusammenbruch bedroht. Der Horizont verdüstert sich. Und die Macht dieser Dämonen – so real sie in einer derart wachstumsabhängigen Wirtschaft auch sein mögen – wird noch bedrohlicher, wenn wir dazu das Vertrauen an das Herzstück unseres tragenden Narrativs verlieren: den Mythos des Wachstums.
Ich benutze das Wort »Mythos« hier im positivsten Sinne. Mythen sind wichtig. Narrative tragen uns. Sie schaffen unsere Gedankenwelten und formen unser gesellschaftliches Gespräch. Sie legitimieren politische Macht und bekräftigen den Gesellschaftsvertrag. Sich einem Mythos zu verschreiben, ist nicht grundsätzlich falsch. Wir alle tun das in der einen oder anderen Form, implizit oder explizit. Aber die Macht des Mythos anzuerkennen, bedeutet nicht immer, sie stillschweigend hinzunehmen. Manchmal arbeiten die Mythen für uns, manchmal auch gegen uns.
Wenn sie sich dauerhaft halten, dann hat das einen Grund. Das Wirtschaftswachstum hat außergewöhnlichen Reichtum hervorgebracht. Es hat Millionen aus der Armut befreit. Allen, die reich genug sind und vom Glück begünstigt, hat es ein Leben in unvorstellbarem Komfort, in Vielfalt und Luxus eröffnet. Es hat Möglichkeiten geschaffen, die sich unsere Vorfahren unmöglich hätten vorstellen können. Es hat den Traum vom sozialen Fortschritt vorangebracht. Ernährung, Medizin, Obdach, Mobilität, Flugreisen, Vernetzung, Unterhaltung: Dies sind nur einige der vielfältigen Früchte des Wirtschaftswachstums.
Die massive Explosion der Wirtschaftstätigkeit hat aber auch die Natur in beispielloser Weise verwüstet. Wir verlieren Arten schneller als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wälder werden dezimiert. Lebensräume gehen verloren. Lebensnotwendiges Ackerland ist von weiterer wirtschaftlicher Expansion bedroht. Die Instabilität des Klimas untergräbt unsere Sicherheit. Brände verzehren ganze Landstriche. Der Meeresspiegel steigt. Die Ozeane versauern. Der Reichtum, nach dem wir streben, wurde zu einem unbezahlbaren Preis erkauft. Der Mythos, der uns getragen hat, ist im Begriff, uns zu vernichten.
Ich habe nicht vor, hier noch einmal alle diese Auswirkungen aufzuzählen oder ihre Schäden zu dokumentieren. Dazu gibt es bereits viele ausgezeichnete Berichte und Bücher. »Seit mehr als dreißig Jahren ist die Wissenschaft kristallklar«, wie Greta Thunberg die UN-Klimakonferenz 2019 erinnerte. Aus ihren Worten wurde ein kulturelles Mem. Sie regten sogar zu künstlerischen und musikalischen Interpretationen an, die ein viel breiteres Publikum erreichen, als es Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen je möglich wäre. Die eindeutigen Fakten, auf denen sie gründen, sind auf unzähligen Seiten akribischer Arbeit dokumentiert.7
Ich möchte lieber Gretas tiefergehende Herausforderung aufgreifen. Hinter den »Märchen vom Wirtschaftswachstum« liegt eine komplexe Welt, die unsere Aufmerksamkeit erfordert. Diese Märchen sind in den Handlungsleitfaden der modernen Wirtschaft einprogrammiert, und zwar schon seit Jahrzehnten. Sie verzerren weiterhin unsere Vorstellung von sozialem Fortschritt und verhindern ein tieferes Nachdenken über die Bedingungen des Menschseins.
Vereinfacht gesagt, lautet die These dieses Buches, dass ein gutes Leben nicht die Erde kosten muss. Materieller Fortschritt hat unser Leben verändert – in vielerlei Hinsicht zum Besseren. Aber das Besitzen kann auch eine Last sein, die der Freude der Zugehörigkeit im Weg steht. Wer besessen ist vom Produzieren, findet nicht die Erfüllung, die das Herstellen von Dingen gewährt. Der Zwang, konsumieren zu müssen, kann die einfache Leichtigkeit des Seins untergraben. Bei der Wiederentdeckung von Wohlstand geht es weniger um Verzicht als um Chancen.
Dieses Buch befasst sich mit den Bedingungen, die wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Es möchte herausfinden, welches Potenzial wir für ein Leben haben, das besser, reicher, erfüllender und nachhaltiger ist als bisher. Das Ende des Wachstums ist nicht das Ende gesellschaftlichen Fortschritts. Die materielle Expansion vom Thron zu stoßen, bedeutet nicht, menschlichen Wohlstand aufzugeben. Eine andere (bessere) Welt ist möglich. Spätestens seit Kansas ist das klar.
Als Kennedy in der Halle des Basketball-Teams der University of Kansas ankam, war die Atmosphäre wie aufgeladen. Weit über zwanzigtausend Menschen standen dicht gedrängt in der Arena: Studierende und Belegschaft, Journalistinnen und Kommentatoren, die auch auf das Spielfeld überquollen, sodass um Kennedy an seinem hölzernen, mit Mikrophonen gespickten Pult nur ein kleiner Kreis frei blieb.
Er eröffnete seine Rede mit einem vermutlich eher spontanen Scherz. »Eigentlich bin ich gar nicht hier, um eine Rede zu halten«, witzelte er. »Ich bin hier, weil ich von der Kansas State University komme und euch alle ganz lieb grüßen soll. Im Ernst. Sie reden dort über nichts anderes als, wie gern sie euch haben.« Die Rivalität zwischen den beiden Spitzenuniversitäten von Kansas war legendär. Das traditionelle Turnier zwischen den beiden Basketball-Teams – der »Sunflower Showdown« – wurde seit 1907 mit harten Bandagen ausgetragen. Die Arena brach in lautes Gelächter aus. Er hatte sie schon gewonnen und konnte es deshalb wagen, ihnen eine kleine Lektion in Makroökonomie anzubieten.8
Eine kleine Lektion in Makroökonomie
Ganz einfach ausgedrückt ist das Bruttoinlandsprodukt ein Maß für die Größe der Wirtschaft eines Landes: Wie viel wird produziert, wie viel wird verdient und wie viel wird im gesamten Land ausgegeben. Gerechnet wird selbstverständlich in Geldwert: Dollars, Euros, Yuan und Yen. Das BIP ist die übergeordnete Maßeinheit innerhalb eines komplexen Systems der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die seit 1953 den internationalen Standard liefert, um die Wirtschaftsleistung eines Landes zu messen. Diese Form der Berechnung wurde während des Zweiten Weltkriegs entwickelt, nicht zuletzt, weil die Regierungen sich Klarheit darüber verschaffen mussten, wie viel sie für ihre Kriegsanstrengungen ausgeben konnten.9
Bereits 1968 galt die Größe des BIP dann fast überall als Indikator für politischen Erfolg. Die Herausbildung der Gruppe der Sieben (G7) in den frühen 1970ern und der Gruppe der Zwanzig (G20) in den 1990ern zementierte seine Bedeutung. Diese eine Zahl wurde zum allerwichtigsten Gradmesser für Politik auf der ganzen Welt. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gilt das BIP nun als konkurrenzloses Äquivalent für gesellschaftlichen Fortschritt. Umso außergewöhnlicher also, am Eröffnungstag eines Präsidentschaftswahlkampfs eine kritische Analyse des Begriffs geboten zu bekommen.
Als Kennedy anfing, über Wirtschaft zu sprechen, wurde die Menge ruhiger, erzählte mir Walinsky; die Aufmerksamkeit galt nun dem Inhalt der politischen Vision ebenso wie der Rhetorik des Senators. Sein Argument war bestechend einfach. Die Statistik, in die wir so viel Vertrauen setzen, zählt einfach die falschen Sachen. Sie beinhaltet zu viel »Schlechtes«, das unsere Lebensqualität beeinträchtigt, und schließt zu viel »Gutes« aus, das für uns wirklich wichtig ist. Das BIP »rechnet Luftverschmutzung und Zigarettenwerbung mit ein und Krankenwagen, die das Gemetzel auf unseren Autobahnen bereinigen«, erklärte Kennedy seiner Zuhörerschaft in der University of Kansas:
Es erfasst Spezialschlösser für unsere Türen und die Gefängnisse für die Leute, die diese Schlösser knacken. Es erfasst die Zerstörung der Mammutbäume und den Verlust unserer Naturwunder infolge wüster Zersiedlungen. Es erfasst Napalm und Atomsprengköpfe und Panzerwagen für die Polizei, mit denen sie die Unruhen in unseren Städten niederkämpft. Es erfasst Whitmans Gewehr und Specks Messer und auch die Fernsehprogramme, die Gewalt verherrlichen, damit man unseren Kindern dann Spielzeug verkaufen kann.10
Und während das BIP fälschlicherweise alle diese Dinge als Gewinn für uns einstuft, gibt es zahlreiche Aspekte unseres Lebens, die auf der Liste schlichtweg fehlen. Die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Die Beiträge derer, die keinen Lohn erhalten. Die Arbeit derer, die sich um die Jungen und die Alten zu Hause kümmern. Was es nicht erfasst, ist »die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität ihrer Erziehung oder ihre Freude beim Spielen«. Es übersieht »die Schönheit unserer Poesie … die Klugheit unserer öffentlichen Debatten … Die Integrität unserer Beamten«.
Einen Politiker zu finden, der sich so ausdrückt, wäre heute noch schwerer als damals. Mehr denn je hat uns die Sprache des Wachstums im Griff. Die Politik hat sich immer weiter von Anstand, Integrität und Gemeinwohl entfernt. Dafür ist auch unsere Fixierung auf das BIP verantwortlich. Diese einzelne Zahl »misst weder unseren Verstand noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unsere Bildung, weder unser Mitgefühl noch unsere Treue zu unserem Land«, schloss Kennedy. »Kurz gesagt misst es alles außer dem, was das Leben lebenswert macht.« Am Ende dieser kritischen Bemerkungen machte er eine kurze Pause. Das Publikum begann zu klatschen. Nicht so euphorisch wie vorher, erinnerte sich Walinsky. »Der Applaus klang jetzt ernsthaft, nachdenklich. Aber man hatte den Eindruck, es könnte den ganzen Tag so weitergehen.«
Es ist schwer zu vermitteln, wie extrem Kennedys Bemerkungen damals aus der Reihe fielen. In den späten 1960er-Jahren wuchs die US-Wirtschaft jedes Jahr um rund fünf Prozent. Man ging davon aus, dass sich diese Wachstumsraten ewig so weiterentwickeln. Genau darauf baute auch die Wirtschaftswissenschaft auf. Und doch stand hier ein Politiker, nicht irgendeiner, sondern einer, der sich darum bewarb, Präsident der größten Volkswirtschaft der Erde zu werden, und zog die heiligste Parole des Kapitalismus in Zweifel: die unablässige Anhäufung von Reichtum.11
Einfach die »Geschäftigkeit« der Wirtschaft zu messen und das dann Fortschritt zu nennen, das war nie der Weg zu dauerhaftem Wohlstand und wird es auch niemals sein. So lautete die ungeschminkte Botschaft, die Robert F. Kennedy den Studentinnen und Studenten von Kansas so wortgewaltig mit auf den Weg gab. Diese Rede diente später allen BIP-Kritikern als Vorlage und hat bis zum heutigen Tag nichts an Gültigkeit verloren.12
Die Story dahinter
Dieser Tag in Kansas hat mich lange fasziniert, insbesondere nachdem jemand vor rund zwanzig Jahren in irgendeinem Keller einen Livemitschnitt der Rede ausgegraben hatte. Ich war ergriffen von der historischen Bedeutung der Aufzeichnung für die Debatte, die immer noch eher am Rande geführt wurde. Mit den Jahren betrachtete ich ihre Existenz zunehmend als selbstverständlichen Teil der Diskussion. Robert F. Kennedys Worte flossen quasi i...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- Vorwort
- Prolog
- Kapitel 1: Der Mythos vom Wachstum
- Kapitel 2: Wer hat den Kapitalismus auf dem Gewissen?
- Kapitel 3: Das Begrenzte und das Grenzenlose
- Kapitel 4: Das Wesen des Wohlstands
- Kapitel 5: Von Liebe und Entropie
- Kapitel 6: Ökonomie ist eine Erzählkunst
- Kapitel 7: Arbeit und Menschsein
- Kapitel 8: Krone der Hoffnung
- Kapitel 9: Die Kunst der Macht
- Kapitel 10: Delfine in Venedig
- Danksagung
- Anmerkungen
- Literatur
- Über den Autor