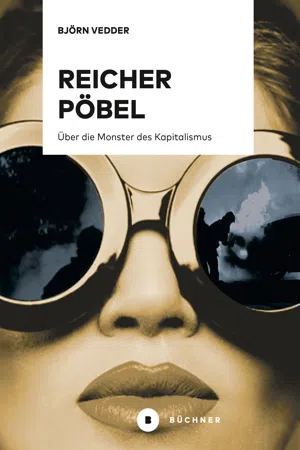
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Über dieses Buch
Die Superreichen stehen unter heftigem Beschuss: Sie plündern die Welt und mästen sich an fremder Arbeit, verspielen unsere Zukunft und zerstören den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die "Fuck-You-Politik der Oberschicht" (Michael Naumann) hat einen "Krieg der Klassen" (Warren Buffet) provoziert, der größtenteils noch in den Medien, vielleicht aber bald schon in den Parlamenten und auf den Straßen geführt wird. Mit den geschulten Augen des Kulturphilosophen zeigt Björn Vedder: Die Kritik am "reichen Pöbel", wie sie derzeit in Debatten, Filmen, Büchern und Fernsehserien Konjunktur hat, ist halbherzig und heuchlerisch. Sie dämonisiert eine kleine gesellschaftliche Gruppe, ohne das dahinterstehende Wirtschaftssystem und unsere eigene Rolle darin infrage zu stellen. Wie gefährlich diese fehlgeleitete Kritik für die politische Kultur und die unter Druck geratene Mittelschicht werden kann, zeigen die jüngsten Wahlerfolge von Populisten, etwa von Donald Trump oder der AfD. Denn während es sich die vermeintlichen Gesellschaftskritiker beim Reichen-Bashing gemütlich machen, entsteht eine brandgefährliche politische Allianz: Der arme und der reiche Pöbel schicken sich gemeinsam an, der von ihnen umklammerten Mitte der Gesellschaft den Garaus zu machen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Vorwort
- Kapitel 1: Der Pöbel brandmarkt den Pöbel – eine Einleitung
- Kapitel 2: Der Spekulant als Raubtier
- Kapitel 3: Das Band der Not und die Verklärung der Arbeit – über Markt und Sittlichkeit
- Kapitel 4: Vom spitzen Bleistift zum goldenen Zombie – über den Wandel des Porträts reicher Menschen
- Kapitel 5: Zucht und Degeneration – über die Affektpolitik des Geldes
- Kapitel 6: Freiheit, Kraft und Kooperation oder Moral für Herren und Sklaven
- Kapitel 7: Abspaltung und Projektion: die Dämonisierung des reichen Pöbels
- Kapitel 8: Der reiche Pöbel der Weltgesellschaft
- Kapitel 9: Die Herrschaft des Pöbels oder wie man der neuen Mitte den Garaus macht
- Kapitel 10: Über die Schwierigkeit, das Rad bei seinem Umschwunge auszutauschen
- Endnoten