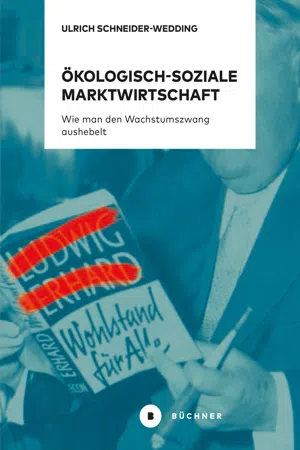Kapitel 1: Die neue Ordnung – Wie die dynamische ökologisch-soziale Marktwirtschaft funktioniert und wie sie zustande kommt
Einleitung: Zwischen allen Stühlen
Das neue Modell selbst könnte einerseits Leser_innen verschiedener politischer Richtungen inspirieren und damit auch zusammenbringen. Andererseits wird es beide großen politischen Lager erst einmal enttäuschen. Denn das Modell beinhaltet weder ›staatliche Maßnahmen‹ zur Rettung der Armen und der bedrohten Umwelt, wie sie eher ›links‹ (›rot‹ oder ›grün‹) geprägte Leser_innen erwarten, noch einen Abbau des Sozialstaats als eines lästigen Hemmnisses guter Geschäfte, wie ihn manche auf (neo)liberal-konservativer Seite wünschen. Natürlich werden staatliche Maßnahmen nicht grundsätzlich abgelehnt; zu ihnen sollte aber erst dann gegriffen werden, wenn die grundsätzlich weitaus wirksameren Rahmenbedingungen spezielle Probleme nicht lösen (können).
Es geht gerade nicht um einen staatlichen ›Eingriff‹ in diese Welt und ihr reiches wirtschaftliches und kulturelles Leben, sondern umgekehrt darum, sie von dauernd stattfindenden Eingriffen zu befreien, damit sich Reichtum und Vielfalt noch mehr steigern lassen. Dabei sind aber die von der ›neoliberalen‹ Propaganda so gerne fokussierten staatlichen Eingriffe das geringere Problem gegenüber den viel massiveren Übergriffen durch Kapital(anleger)interessen und einem Dogmatismus der Gewerkschaftsspitze. Überhaupt sind jedwede Betonkopf-Fraktionen und Erstarrungen die eigentlichen Hemmnisse der ›natürlichen‹ gesellschaftlichen Tendenzen zu Solidarität und Ökologie; sie schränken die ›normal-bürgerliche‹ wie auch die unternehmerische Freiheit ein und beschädigen – global – den ›Wirtschaftsstandort Erde‹.
Ein Schutz vor den Übergriffen durch Kapital(anleger)interessen ist nicht durch ›mehr staatliche Regulierung‹ möglich, sondern nur durch eine Selbststeuerungsdynamik, die sogar das Umgekehrte erlaubt: die von liberaler Seite so erwünschte Deregulierung. Denn die Eigendynamik der zu beschreibenden Weichenstellung wird dafür sorgen, dass sich der soziale Schutz des Einzelnen wie auch der ökologische Schutz der Ressourcen ›von selbst‹ zu einem immer höheren Schutzwall auftürmen wird: Das wäre Ordnungspolitik im besten Ludwig-Erhardschen Sinne – aber eben unter den heutigen Anforderungen der dreifachen Nachhaltigkeit:
- • ökologisch,
- • sozial und
- • ökonomisch,
d. h. die neue Ordnung muss eine dreifache Trend-Umkehr sicherstellen:
- • langfristige Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen statt Ressourcen-Raubbau,
- • Trend zu gerechterer Verteilung und sozialer Stabilität statt sozialer Schieflage und
- • Stabilität für Unternehmen statt Verschärfung der Konkurrenzsituation und des Risikos.
Die üblichen politischen Prägungen bewirken bisweilen jedoch, dass bei bestimmten Stichwörtern sofort die Diskussion erstirbt – bzw. die Bereitschaft, auch nur zuzuhören. Begriffe, die für das eine Lager einen selbstverständlichen Konsens markieren, sind für das andere Lager Reizwörter, z. B. ›Solidarität‹ und ›Kapitalinteressen‹ für die liberal-konservative oder ›Arbeitskosten‹ und ›Deregulierung‹ für die linke Seite.
Sie werden hier alle bewusst benutzt. Wer sich davon nicht beirren lässt, ist eingeladen, sich mit dem neuen Modell ebenfalls zwischen alle Stühle zu setzen – und damit einen Anfang bei der Auflösung der alten Fronten zu setzen.
Das Modell einer dynamischen ökologisch-sozialen Marktwirtschaft
Die Instrumente einer selbstgesteuerten ökologisch-sozialen Marktwirtschaft sind
- • eine Besteuerung der drei Produktionsfaktoren Energie, Kapital, Arbeit durch Ökosteuern, Sachkapitalsteuer und Lohnsummensteuer,
- • ein daraus finanziertes steigerbares Grundeinkommen für jede(n) in gleicher Höhe.
Beides kann auf kleinem Niveau starten; innerhalb kurzer Zeit wird sich dies zum politischen Prinzip entwickeln, zu einem Instrumentarium, mit dem sich eine wirklich freie Marktwirtschaft zum Nutzen aller Beteiligten herbeiführen und austarieren lässt:
- • mit Vollbeschäftigung,
- • unter Schonung der Ressourcen,
- • bei zurückgehender Verschmutzung, Zerstörung und Klimaerwärmung
- • samt einem Aufblühen verarmter Weltregionen in Afrika, Südamerika, Mittelasien.
Die Instrumente dafür existieren zum Teil bereits: die Ökosteuern in der Realität, das Grundeinkommen hat immerhin schon in einer breiten öffentlichen Diskussion und in programmatischen Entwürfen mehrerer Parteien konkrete Formen angenommen.
Die Ökosteuern, die schon 1999 von der damals neuen ›rot-grünen‹ Bundesregierung beschlossen wurden, waren von Anfang an völlig richtig als eine Einkommensquelle konzipiert, die nicht auf Arbeitskosten beruht: Sie finanzieren einen Teil der Rentenbeiträge.
Das Problem ist nur: Dieser Beitrag zum Einkommen ist so indirekt, dass ihn die Arbeitnehmer_innen überhaupt nicht wahrnehmen. Weil nur den wenigsten bewusst ist, dass die Ökosteuern mit zu ihrem Einkommen beitragen, sind sie bzw. ist das ganze ›ökosoziale‹ Thema – wie mancher der auf dem o. g. ›Forum‹ vertretenen Autoren beklagt – so unpopulär.
Würde hingegen das durch die heutigen Ökosteuern Eingenommene (ca. 20 Mrd. Euro pro Jahr) nicht in die Rentenkasse fließen, sondern auf alle bar ausgeschüttet werden, hätte jede(r) direkt und spürbar ein jährliches Zusatzeinkommen von ca. 250 Euro – und würde fragen: ›Warum nicht mehr davon?‹ Damit käme sofort eine neue wirtschaftspolitische Dynamik in Gang. Es gäbe auf einmal ein neues Instrument, um das persönliche Einkommen zu steigern. Dieses neue Instrument, diese neue Dynamik könnte die bisherige Tarifdynamik ersetzen.
Ein bedarfsunabhängiges Grundeinkommen für alle in gleicher Höhe wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr intensiv diskutiert, v. a. auch dank der medienwirksamen Beiträge von Götz Werner, dessen spezielle Konzeption allerdings sehr an der Finanzierung krankt. In den aktuellen Programmen einiger im Bundestag vertretenen Parteien findet sich die Forderung nach Grundeinkommen – ebenso wie die nach Ökosteuern und einer Kapitalbesteuerung16. Nur: Beides zu verbinden und damit ebenso die Frage nach der Finanzierung des Grundeinkommens zu beantworten, das war bisher selten in der öffentlichen Diskussion17. Überhaupt nicht in Erwägung gezogen wurde, Grundeinkommen und Ökosteuern mit einer Dynamik, d. h. mit der Möglichkeit einer Entwicklung nach oben, auszustatten und damit die Frage nach der Höhe des Grundeinkommens und der Ökosteuern nicht irgendwelchen Expertengremien anzuvertrauen, sondern durch die Bevölkerung als ganze, durch die politische Meinungsbildung und die Antagonismen einer mündigen, pluralistischen Gesellschaft, d. h. durch das Ringen einander gegenüberstehender Interessensgruppen um politische Fragen, beantworten zu lassen.
Funktionsweise und Auswirkungen im Einzelnen
Wie das Ganze funktioniert, wird vielleicht am besten sichtbar, wenn wir verschiedene Detailfragen nacheinander durchgehen.
Ökologie: Durch steigende Ökosteuern wird umweltschädliches Verhalten, d. h. Ressourcenverschwendung und damit auch Müll und Giftausstoß immer mehr ›bestraft‹, umweltgerechtes Verhalten dagegen immer vorteilhafter. Ein bisschen davon erleben wir ja schon heute.
Zusätzlich belohnt wird ein nachhaltiger Lebensstil durch das steigende Grundeinkommen. Dieses wird, je mehr es steigt, umso mehr zu einem differenzierten
Energiesparlohn: Das Grundeinkommen wird zwar in gleicher Höhe für alle ausbezahlt, doch da jeder Schritt einer Grundeinkommenserhöhung durch eine entsprechende (Öko-)Steuererhöhung zu finanzieren ist, wird z. B. eine in einer Durchschnittswohnung lebende, den öffentlichen Verkehr nutzende mehrköpfige Familie (jedes Kind bekommt sein Grundeinkommen!) tatsächlich einen Gewinnzuwachs haben, während dem kinderlosen Vielflieger und Luxusvilla-Beheizer das Geld, das auch er durch das erhöhte Grundeinkommen zunächst einnimmt, mehrfach wieder aus der Tasche gezogen wird. Die – ich nehme mal die Zukunft in meiner Phantasie vorweg – wahlentscheidende ›Ökolohnrunde‹ und die in den Medien x-fach vermittelte Frage ›Wie mache ich das meiste aus meinem Grundeinkommen?‹ strahlt mehr Faszination aus als die mit Macht ausgekämpfte Tarifpolitik, die Arbeitsplätze gefährdet.
Sozialpolitik: Je mehr das Grundeinkommen auf die Höhe des Existenzminimums klettert, desto mehr andere soziale Sicherungen, v. a. Sozialhilfe (›Hartz IV‹), kann es ersetzen. Durch den Wegfall des Kontrollaufwands wird das ganze Sozialsystem vereinfacht und verbilligt, wobei das Eingesparte mithilfe des Grundeinkommens ausgeschüttet werden kann.
Das Grundeinkommen ist eine Überlebenshilfe bei Arbeitslosigkeit, langer Krankheit, zu kleiner Rente. Familien werden ebenso unterstützt wie Alleinerziehende: Jede Mutter, jeder Vater, jedes Baby bekommt sein Grundeinkommen. Erleichtert werden Aus- und Weiterbildung, der Schritt in die berufliche Selbstständigkeit und ehrenamtliches Engagement. Die bisherigen komplizierten Formen der Familien- und Ausbildungsförderung werden allmählich überflüssig.
Gegen eine ›bedarfsabhängige Grundsicherung‹, wie sie sich in manchen Parteiprogrammen findet, spricht u. a. der immense Kontrollaufwand. Die genannte Vereinfachung und Verbilligung der Sozialverwaltung unterbliebe.
Es ist wesentlich billiger und für die Armen hilfreicher, auch den wenigen Millionären Grundeinkommen zu überweisen, als die Bedürftigkeit aller Bedürftigen zu überprüfen und über Bemessungsgrenzen zu streiten.
Standortvorteil und internationale Wende: Wenn durch ein allmählich steigendes Grundeinkommen Tarifsteigerungen überflüssig werden, kommt es zu niedrigen oder stabilen Arbeitskosten; diese sind DER Standortvorteil für jedes Land, das diese Reform durchführt. Dieser Traum der Unternehmer wird dank dem zweiten Einkommens-Standbein Grundeinkommen nicht zum Alptraum der Arbeitnehmer. Niedrige Arbeitskosten (trotz steigender Netto-Einkommen) bringen andere Länder über den internationalen Wettbewerb in Zugzwang, ähnliche Reformen durchzuführen. Die Abhängigkeit von Investoren nimmt ab, denn einerseits sinkt der Investitionsbedarf rapide. Andererseits ist eine aufgrund der Arbeitskostenstagnation stabile Firmenlandschaft so attraktiv, dass Investoren sich darum reißen werden, ihr Geld in diesem sicheren Hafen unterbringen zu dürfen.
Mehr Einkommen durch sinkende Zinsen/Lebenshaltungskosten: Ohne fortschreitende Tariflohnerhöhung vermindert sich für die Unternehmen der Zwang, zu investieren und die Produktivität zu steigern. Damit sinkt auf dem Kapitalmarkt die Nachfrage nach Geld, und die Zinsen fallen. Dies führt zu einer Minderung der Lebenshaltungskosten, vor allem der Mieten, was so gut ist wie eine Steigerung der Realeinkommen; diese neuen Spielräume können aber nicht mehr beliebig für umweltgefährdende Produkte/Lebensstile ausgegeben werden. Es entsteht eine Super-Wohlstandsgesellschaft, aber ökologisch ungefährlich.
Vorteil für die Armen: Endlich gibt es eine Rendite...