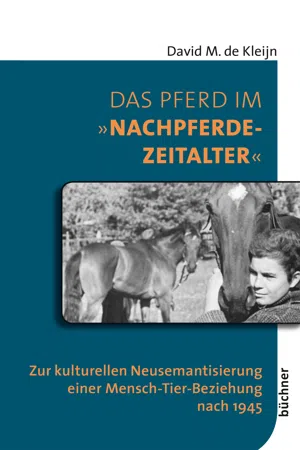![]()
II1945 als Ende des Pferdezeitalters? Persistente und neue Semantisierungen als diskursive Strategien in der Bundesrepublik, »dem Pferde einen Platz im Menschenherzen zu erhalten«1
II.1Das Pferd im bundesdeutschen Kriegsgedenken
II.1.1Pferde in der Erinnerung an ›Flucht und Vertreibung‹
In der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg nahm die aufgrund der deutschen Gebietsverluste im Osten in den letzten Kriegsjahren einsetzende, fürderhin als ›Flucht und Vertreibung‹ titulierte Zwangsmigration Deutscher und Deutschstämmiger eine prominente Position ein. In diesem Zeitraum waren gerade Pferde als Zugtiere und Transportmittel unter dem Eindruck akuten Treibstoffmangels sowie zerstörter Fahrzeuge, Straßen und Bahnstrecken noch einmal zu notwendigen letzten Garanten einer sich vor dem Hintergrund der verdichtenden Frontverläufe, insbesondere für die Zivilbevölkerung, dringlich erforderlichen Mobilität avanciert. Insbesondere in den strukturell stark agrarisch geprägten ›Ostgebieten‹ hatten sie sich, begünstigt durch die dort im landwirtschaftlichen Transportwesen noch dominante Rolle der Pferdehaltung2, als »die wichtigsten Beweger der außerordentlich verbreiteten Trecks mit Evakuierten und Flüchtlingen«3 erwiesen. In den Erinnerungen vieler Geflüchteter und Vertriebener nahmen sie, nicht zuletzt wegen ihrer existenziell notwendigen Funktion als Zugtiere und der ständigen Nähe zu ihnen, mitunter eine exponierte Stellung ein, sodass der wegen ihrer höheren Geschwindigkeit gegenüber anderen Zugtieren vorwiegend aus von Pferden gezogenen Gespannen bestehende Treck »zum Symbol der Flucht aus dem Osten schlechthin«4 avancierte. Konrad Köstlin etwa identifizierte »Pferdewagen, Koffer und Trakehner-Pferde, wie sie in der Muster-Flucht-Biographie der Gräfin Dönhoff figurieren«5 in kombinierter Darstellung als charakteristische Elemente eines »Kanon[s] visueller und akzeptierter Deutungsikonen«6 innerhalb des Themenkomplexes ›Flucht und Vertreibung‹.
In ihrem Selbstverständnis als »das Organ der Propaganda, der Werbung, der geistigen und wirtschaftlichen Durchdringung, der züchterischen und sportlichen Kritik, der Richtunggebung [sic!] und Zielsetzung«7 im Hinblick auf alle pferdebezogenen Themen konnte sich die 1900 begründete und fortan führende Pferdezeitschrift St. Georg, die auch während der Zeit des Nationalsozialismus »das Bindeglied zwischen dem Reichsverband und den Mitgliedern«8 dargestellt hatte und ab 1949 wieder erschien, diesem rezenten Themenkomplex nicht verschließen. So verdeutlicht sich der hohe Grad der Anerkennung der durch Pferde auf der Flucht erbrachten Leistungen etwa am Schlusswort eines anlässlich des Hubertustages9 1950 im St. Georg erschienenen Artikels, den der Verfasser dem Andenken »unserer vierbeinigen Freunde […], deren helles Wiehern heute nicht mehr erklingt«10 und »die in stiller Pflichterfüllung in schwerer Zeit zum besten Kameraden des Menschen wurden«11, widmete. Auf die Beschreibung seiner entbehrungsreichen Erlebnisse an Hubertustagen während des Krieges mit drei verschiedenen, an der Front gefallenen Pferden, ließ er schließlich einen Verweis auf die bei der Flucht mitgeführten Pferde folgen, mit dem er die Erinnerung an sie in das deutsche Kriegsgedenken zu integrieren suchte:
Wir wollen an diesen Tagen auch nicht die unzähligen Pferde vergessen, die bei Regen, Schnee und Kälte die unmenschlichen Strapazen der Flüchtlinge teilten und das letzte dürftige Hab und Gut dieser Heimatvertriebenen über die vereisten Treckstraßen zogen. So soll der Hubertustag nicht nur ein Tag der Freude reiterlichen Erlebens sein, sondern ein Tag des dankbaren Gedenkens für unsere vierbeinigen Freunde, die nicht mehr das vertraute Signal hören ›Halali‹.12
Die durch das gemeinsame Merkmal eines als aufopferungsvoll eingeordneten Leidens respektive Todes begründete semantische Annäherung zwischen Soldatenpferden und zur Flucht eingesetzten Zugtieren wurde hier durch die Beschreibung der erlittenen Beschwernisse sowie die Hervorhebung der erbrachten Leistungen zusätzlich verstärkt und zielte auf die Erzeugung eines solidarisierenden Empfindens simultan und kollektiv erlebter Erfahrungen beim Rezipienten ab. Anhand des Hubertustages, an dem das angeregte Gedenken an die gefallenen Pferde durch unweigerliche Korrelation mit den Flucht- und Kriegserlebnissen ihrer menschlichen Bezugspersonen kollidieren sollte, wurde diese Analogie von den militärischen und zivilen Pferden auf menschliche Zivilisten und Soldaten übertragbar gemacht. Das ihnen allen damit übergestülpte Motiv eines gemeinschaftlichen, multiparallelen Leidenswegs lässt sich in den Kontext eines häufig mit dem »Begriff der ›Schicksalsgemeinschaft‹, der die deutsche Vertriebenenliteratur durchzieht«13, umschriebenen, intentionalen Gruppengefühls einordnen, das mit der postmortalen Glorifizierung vollbrachter Heldentaten angereichert wurde.
Die Parallelisierung von Kriegs- und Treckpferden, von Qual und Leistung verdeutlicht sich umso mehr in der im selben Jahrgang des St. Georg erschienenen Artikelserie »Vergessenes Heldentum im Sattel«, die verschiedenen historischen »Gewaltmärschen«14 zu Pferd in superlativer Akzentuierung neuerliche Ehrerbietung erwies. Nachdem der als ausgeschiedener Oberst ausgewiesene Autor zunächst den binnen viereinhalb Tagen über 380 km zurückgelegten Ritt der 2. Schutztruppenkompanie des Hauptmanns Victor Franke nach Windhoek15 im Vorfeld des Völkermordes an den Herero 1904 als »[e]ine der gewaltigsten reiterlichen Leistungen aller Zeiten«16 bezeichnete, bemerkte er Folgendes:
Auf die unfaßbaren Leistungen der Treckpferde, die wohl die größten Härteprüfungen aller Zeiten waren, ist ebenso wenig eingegangen wie auf die Leistungen von Reiter und Pferd in beiden Weltkriegen. Schmerz und Scheu hemmen die Feder. Außerdem sind von den Leiden und Leistungen des Pferdes auf dieser größten Völkerwanderung aller Zeiten noch zu wenige Einzelleistungen bekannt.17
Die Einreihung der Treckpferde in diese Auflistung reiterlichen ›Heldentums‹ unterstreicht, dass das Augenmerk ihrer Belobung und damit die affektive Qualität ihrer Erwähnung hier auf ihren Verdiensten lag, die hier ausschließlich anhand der zurückgelegten Wegstrecke und des dafür benötigten Zeitraums bemessen wurden. Tierethische Maßstäbe wurden erst rückwirkend angewandt und blieben frei von Vorwürfen, da der Zweckorientierung, die im Gelingen der Flucht lag, absolute Priorität eingeräumt wurde. Auch wenn sie in der Erwähnung des Leidens der Pferde anklingen, bleiben dessen konkrete Ausmaße und Manifestationen doch ungenannt, sodass es lediglich als ein weiterer Faktor zur Illustration equinen ›Heldentums‹ erscheint.
Der Bemängelung, die Treckpferde seien bis dahin zu wenig gewürdigt worden, setzte der St. Ge...