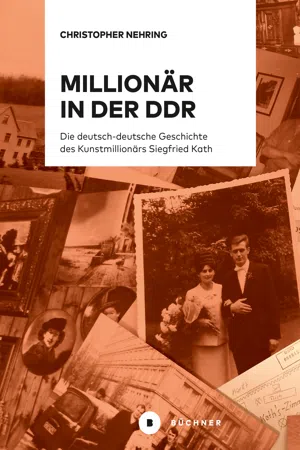
Millionär in der DDR
Die deutsch-deutsche Geschichte des Kunstmillionärs Siegfried Kath
- 200 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Millionär in der DDR
Die deutsch-deutsche Geschichte des Kunstmillionärs Siegfried Kath
Über dieses Buch
Der Antiquitätenhändler Siegfried Kath war der wohl einzige Selfmade-Millionär der DDR und dabei ein Grenzgänger zwischen Ost und West. Wenige Monate nach Schließung der innerdeutschen Grenze wanderte er im Jahr 1961 in die DDR ein – scheinbar aus Versehen. Innerhalb von zehn Jahren baute er sich vom sächsischen Pirna aus ein extrem lukratives Kunsthandelsimperium auf und geriet damit ins Visier des Ministeriums für Außenhandel: Alexander Schalck-Golodkowskis Kommerzielle Koordinierung, die legendäre KoKo. Der Historiker Christopher Nehring hat die Archivquellen zu Siegfried Kath ausgewertet und im familiären Umfeld geforscht. Mit "Millionär in der DDR" legt er die erste Biografie dieser schillernden Figur vor. Vom Tellerwäscher zum Antiquitätenmogul – Kath lebte mitten im Sozialismus den American Dream. Dafür musste er auf drastische Weise bezahlen, als er 1974/75 von der KoKo abserviert, von der Stasi verhaftet und dann abgeschoben wurde. Doch Kath ließ sich nicht lange fernhalten. Schon kurze Zeit später betrat er wieder den Boden der DDR, konnte allerdings weder im Osten, noch im Westen Deutschlands jemals wieder an alte Zeiten anknüpfen. Nehring folgt Kaths Geschichte in all ihren erstaunlichen Wendungen. Ihm gelingen spannende Einblicke in eine unkonventionelle deutsch-deutsche Geschichte, in der die historischen Hintergründe von Bundesrepublik und DDR in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit hervortreten.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Unfassbar Kath, Teil 1
Schicksalsjahr 1961
Zwischen Flucht und Aufbau
1962–1966
Inhaltsverzeichnis
- Siegfried Kath: ein Rockefeller der DDR
- Einleitung: Millionäre in der DDR
- Kindheit 1936–1944
- Prägende Jahre 1945–1961
- Unfassbar Kath, Teil 1 Schicksalsjahr 1961
- Zwischen Flucht und Aufbau 1962–1966
- Griff nach den Sternen: von »Baltimore« nach Pirna 1966–1969
- Aufstieg 1969–1971
- Senkrechtstart zum Ost-Millionär 1972–1974
- Siegfried Kath und die Stasi 1962–1974
- Die Intrige 1973/1974
- »Barocker Prunk«: Landsitz, Sammler und der Neid
- Horst Schuster
- Verhaftet 1974
- Des Teufels Anwalt 1974/75
- Unfassbar Kath, Teil 2 1975
- Neuanfang 1975
- Auf und Ab 1976–1981
- Leidensweg 1981–2008
- Annelies
- Der Fall Siegfried Kath und die Wende 1990–2002
- Millionär und Mensch: ein Fazit zu Siegfried Kath
- Nachweise