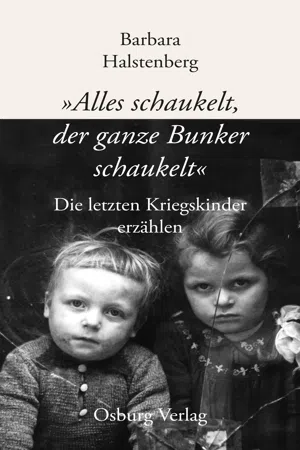![]()
Judenverfolgung
»Musst ja nicht jedem erzählen, dass du Jude bist!«
Kurt Hillmann
(Geboren 1933 in Berlin, Diplomökonom, Außenhandelsvertreter)
Ich bin 1933 in Berlin geboren, im glücklichsten Jahr Deutschlands …
Meine Mutter war Jüdin, mein Vater Arier. Ich wurde als Jude im Jüdischen Krankenhaus geboren, und beschnitten wurde ich auch. Ich war in einem jüdischen Kindergarten und habe eine jüdische Schule besucht. All das brachte es mit sich, dass ich verfolgt wurde. Das ist die Kurzform meiner Geschichte. Meine Erinnerungen an die Kindheit und frühe Jugend waren immer nur davon geprägt, dass ich verfolgt wurde. Ich musste immer vorsichtig sein, wo ich war, mit wem ich sprach, was ich redete – um mich nicht zu verraten.
Äußerlich war ich der Typ eines richtigen arischen Jungen. Groß und blond. Außergewöhnlich! Deswegen hatte ich zunächst keine Probleme. Die bekam ich erst, als ich nicht mehr in die Schule gehen konnte. Auf dem Schulweg verprügelten uns die Jungs von den anderen Schulen. Mein Vater versuchte, mich in einer anderen Schule unterzubringen. Aber einen Juden nahmen sie nicht auf. Ich blieb zu Hause und las viel. So machte ich all die Erfahrungen, die ein Kind als Außenseiter machen kann, ein Kind, das eigentlich gar nicht in die Gesellschaft gehört – das wegmuss … Das habe ich täglich erlebt.
Und weil ich das so erlebt habe, sage ich auch, dass die Generation meiner Eltern und Großeltern Lügner sind. En gros. Alle haben von nichts gewusst danach. Dabei konnten es alle sehen! Alle muss ich in Anführungszeichen setzen. Es gibt sicher ein paar Dörfer, wo die Menschen nichts gesehen haben. Aber das war nicht das Gros. Mit dem Buchenwaldschwur der ehemaligen Lager-Häftlinge vom KZ Buchenwald wurde zum Ausdruck gebracht, dass sich diese Barbarei nicht wiederholen darf und alles dafür getan werden muss.
Wenn ich die heutige politische Situation in Deutschland und Europa sehe, ist der Schwur hochaktuell.
Ich erinnere mich … Meine Mutter handelte auf den Berliner Wochenmärkten mit Wäsche. Manchmal begleitete ich sie, und einmal konnte ich sehen, wie ihr Stand verwüstet wurde. Sie wurde beschimpft. Keiner hat ihr geholfen! Ihr Stand wurde noch zwei- oder dreimal verwüstet, dann ging sie nicht mehr zum Markt …
Wenn man so etwas schon im Kindergartenalter erlebt, prägt das sehr!
Mutter und ich bekamen die Kennkarte mit dem Buchstaben J, und eigentlich hätten wir den Stern tragen müssen. Das hatte Vater aber meiner Mutter und mir verboten. »Das machen wir nicht!«, hatte er verkündet. Also trugen wir den Stern nicht, was kreuzgefährlich war.
In der Zwischenzeit erkrankte Mutter an Lungentuberkulose. Kein Arzt wollte sie behandeln. Nur jüdische Ärzte durften jüdische Leute behandeln, und jüdische Ärzte gab es nicht mehr. Mutter versuchte, in ein jüdisches Heim für Tuberkulosekranke zu kommen, aber es war zu spät. Das Heim war den Juden schon aus den Händen genommen worden. Die einzige Chance für eine Heilung wäre in einem dieser Heime gewesen. Die einzige …
Diese Zeit war schlimm für mich. Mutter konnte zu Hause immer weniger machen. Haushalt, Hauswirtschaft und Kochen fielen ihr schwer. Ich übernahm das Einkaufen. Mutter und ich bekamen jüdische Lebensmittelkarten. Damit durfte ich als Jude nur zwischen vier und fünf Uhr nachmittags einkaufen gehen. Aber die Verkäufer mussten mir als Jude auch nichts verkaufen.
Mein Vater hatte eine Tischlerei. Seine Arbeit war während des Krieges gefragt, denn wegen der Bomben war dauernd etwas kaputt. Dadurch hatte er gute Verbindungen, auch zu einigen Lebensmittelhändlern und Bäckern, für die er arbeitete. Dort tauschte er unsere jüdischen Lebensmittelmarken gegen normale Karten. Das erleichterte mir das Einkaufen. Als Mutter auch zum Kochen zu schwach wurde, holte ich oft Essen aus dem Restaurant. Als sie ganz bettlägerig wurde, kümmerte sich Vater nach der Arbeit um den Haushalt, und ich wischte manchmal Staub in der Wohnung.
All diese Benachteiligungen bekam ich als Kind mit. Bisher habe ich noch kein Wort über das Leben während des Krieges erzählt. Diese Erschwernisse kamen für einen Juden noch hinzu. Die ständige Angst, dass es jeden Moment Fliegeralarm gibt. Nachts Alarm, dann im Dunkeln anziehen, das Köfferchen mit den wichtigen Papieren nehmen und los in den Keller. Wenn ich nachts wegen Alarm aufstehen musste, begann ich am ganzen Körper zu zittern. Nach einer Weile gab es sich dann wieder. Angst war die Ursache. Sie war zweifach da. Einmal als Jude verfolgt zu sein und außerdem die Bombennächte. Wenn Bombenalarm war, durften Mutter und ich nicht in den Keller. Wir mussten auf der Vorkellertreppe sitzen bleiben. Das hat der Blockwart, der frühere Portier, so bestimmt. Er hätte es auch nicht gestatten können, dass wir auf der Treppe sitzen. Die Hausbewohner liefen an Mutter und mir vorbei in den Keller. Wir mussten davor sitzen bleiben. Vater ist nie in den Keller gegangen. Er war im Ersten Weltkrieg in einem Unterstand verschüttet und wollte nicht in den Keller. Unter freiem Himmel fühlte er sich wohler.
Als ich acht oder neun Jahre alt war, begann die Zeit, wo verschiedene Bekannte bei uns Zuflucht suchten. Zuerst tauchte Elvira Zupnick, eine Freundin von Mutter bei uns unter. Sie hatte mitbekommen, dass sie abgeholt werden sollte, und war einfach losgegangen. Ich sollte nachsehen, ob ihre Wohnung bereits versiegelt war, um ihren gepackten Koffer zu holen. Ich fuhr hin – die Tür war bereits versiegelt. Zwei Tage wohnte Elvira bei uns, dann baten mich meine Eltern, Elvira mit dem Zug aus der Stadt herauszubringen. Ich war groß und blond, ein guter Begleiter. Wir fuhren Richtung Norden raus, klingelten bei einem Haus, sie ging rein und ich fuhr zurück. Nach zwei oder drei Wochen stand sie wieder vor unserer Tür. Sie war unterwegs geschnappt und in das jüdische Sammellager in der Großen Hamburger Straße gebracht worden. Dort hatte sie sich mit jemandem aus der Küche angefreundet und herausgefunden, wo die Schlüssel lagen. Schon war sie weg und wieder bei uns. Ich brachte sie wieder fort. Diesmal in ein anderes Haus. Danach hörten wir nichts mehr von ihr.
Kurz nach dem Krieg gehe ich mit einem Schulfreund ins Theater am Nollendorfplatz. Wir wollen die Sonntagvormittag-Vorstellung sehen. Es sind viele Leute da. Wir wollen gerade die Treppe zum Eingang hochlaufen, da sehe ich Elvira Zupnick, erkenne sie … in diesem Gewühl. Sie ist allein, läuft krumm. Ich rufe sie, und nach einer ganzen Weile dreht sie sich um und sagt: »Freu mich, dass ich dich wiedersehe. Aber siehste, sowas kann man aus einem Menschen machen. Mich sieht man hier nicht wieder, ich gehe nach Amerika.« Ich war erschrocken. Wie sie aussah! Vorher groß, hochgewachsen, schlank … hübsch vielleicht. Und nachher gebeugt, krumm, alt …
Als Nächstes suchte eine Frau mit einem kleinen Kind bei uns Schutz. Ich kannte die beiden nicht. Das Mädchen wollte spielen, in der Wohnung umherrennen und mit meinem kleinen Roller durch die Wohnung rollern. Aber wir mussten aufpassen! Über uns wohnte ein strammer Nazi mit SA-Uniform und vielen goldenen Abzeichen. Ich spielte mit dem kleinen Mädchen, um sie ruhigzuhalten. Wir flehten inständig: »Na, hoffentlich geht’s gut!« … Es ging gut.
Nach zwei oder drei Tagen brachte ich auch sie raus aus der Stadt. Wieder in ein anderes Haus. Wir hörten nie wieder etwas von ihnen …
Es kam noch ein Dritter, der Uhrmacher Koplowitz. Er arbeitete als Zwangsarbeiter auf dem Zentralschlachthof im Prenzlauer Berg und freute sich immer, wenn er Schweinebeine mitnehmen durfte. Daraus kochte er Sülze. Nebenbei reparierte er weiter Uhren, um sich etwas dazuzuverdienen. Er wohnte eine Woche bei uns, dann zog er fort. Wohin, weiß ich nicht. Auch von ihm haben wir nie wieder etwas gehört. Verschollen, weg …
Als Erwachsener nach dem Krieg wurde mir klar, dass es ein Netz gegeben hat, in dem sich Menschen untereinander geholfen haben, Verfolgte unterzubringen. Eine Begleitperson wie ich war ideal dafür. Ich fand mich in Berlin gut zurecht und wusste vor allem Bescheid, wie man sich benehmen musste, um nicht aufzufallen. Mutter und Vater hatten mir gesagt: »Musst ja nicht jedem erzählen, dass du Jude bist, du siehst ja, was passiert!«
Na klar sah ich, was passierte! Dauernd. Jeden Tag auf der Straße! Die Lastwagen fuhren vor, die Leute wurden aus ihren Häusern geholt, rauf auf den Lastwagen, mit Koffer, ohne Koffer. Da musste mir gar nicht viel erzählt werden. Die Einstellung »Vorsichtig sein!« bekam ich schnell mit. Ich bin heute noch vorsichtig … Bewege mich so, dass ich keinen hinter mit habe und möglichst alles vor mir. Damals habe ich dafür Antennen entwickelt.
Bei uns zu Hause wurde ganz offen geredet. Mutter und Vater nahmen keine Rücksicht auf mich. Ich wusste, wie sie dachten und was sie redeten, und ich wusste, wie sie handeln wollten. Ich wusste auch, dass Vater ausländische Sender hörte, englische und russische, und dass ich darüber nicht sprechen darf. So vieles, was einem damals in Fleisch und Blut übergegangen ist … Das war alles klar für mich. Auch gut so, muss ich sagen. Manch einer mag das als zu viel für ein kindliches Gemüt empfinden. Das finde ich nicht. Offen und nicht zurückhaltend zu sein, das formt einen Menschen. Die Kinder sollen wissen, was gerade passiert. Sie sollen verstehen, warum und wie sich die Eltern verhalten. Ich wurde nicht erst später überrascht von den Dingen, ich war gleich mittendrin. Ich wusste, dass die Leute abgeholt wurden, dass es keine Ärzte mehr für uns gab und niemand Mutter helfen konnte. Das konnte ich selber spüren.
Ein Beispiel. Ich habe Zahnschmerzen und muss zum Arzt, aber es ist kein Arzt da. Es gibt keinen Arzt, der mich als Juden behandelt. Zwei Häuser weiter wohnen zwei jüdische Studenten, die ihr Zahnmedizinstudium vorzeitig beenden mussten. Sie behandeln heimlich die Juden, die noch da sind. Mutter geht mit mir hin. Die beiden Studenten haben in ihrer Wohnung auf die Toilette ein Stück Stuhl mit Lehne gesetzt. Dort plombierten die Studenten mir die Zähne – auf der Toilette –, damit es nicht so laut war und keiner etwas merken würde. Die Ärzte haben die Juden erst gar nicht in die Praxis gelassen. Wir mussten alleine zurechtkommen.
Ich hatte zwei gute Freunde aus der jüdischen Schule. Der eine, Gerd Abraham, lebte nur mit seinem jüdischen Vater zusammen. Die arische Mutter hatte sich scheiden lassen. Gerd hat mir immer leidgetan. Er war oft alleine, wartete den ganzen Tag, bis sein Vater abends nach Hause kam. Der Vater war in einer Fabrik zwangsverpflichtet. Ich fand es schlimm, dass sich die Mutter vom Vater getrennt hatte. Dadurch hatte sie die beiden quasi zur Abholung freigegeben.
Gerd und ich trafen uns fast jeden Tag. Manchmal gingen wir zum Bäcker in der Jostystraße und kauften uns für fünf Pfennige Kuchenkrümel. Das fanden wir wunderbar! Eines Tages sagte Gerd zu mir: »Weeßte was, du kannst mal vorbeikommen und dir meinen Ball mitnehmen, den schenk ich dir.«
Den Ball hatte ich schon immer bei ihm bewundert. Als ich das nächste Mal zu ihm nach Hause kam, war es schon zu spät. Die Wohnungstür war bereits versiegelt. Sie hatten Vater und Sohn abgeholt … Ende.
Das sind Ereignisse, die muss man erleben, dann sitzen sie tiefer und sind nicht mehr beeinflussbar.
Mein anderer Freund, Lutz Knobloch, kam aus einer großen, gutbürgerlichen Familie. Sie wohnten gegenüber von uns in einem vornehmen Haus in einer großen Fünf-Zimmer-Wohnung. Lutz Knobloch hatte ein Zimmer für sich, wo er seine Hausaufgaben an einem Pult zum Aufklappen mit einem eingelassenen Tintenfass machte. Das beeindruckte mich. Die Familie lebte nach dem jüdischen Ritus. Meine Mutter wollte mich im jüdischen Glauben erziehen und schickte mich bei jüdischen Feiertagen zu der Familie Knobloch, damit ich die jüdischen Traditionen miterleben konnte. Vater wollte das eigentlich nicht. Dass sich meine Eltern wegen Glaubensfragen gestritten haben, habe ich aber nie mitbekommen.
Das Laubhüttenfest bei der Familie Knobloch hat mich besonders beeindruckt. In einem Zimmer hatte die Familie eine Art Hütte gebaut und sie mit grünen Zweigen und Früchten geschmückt. Freitags beim Sabbat oder beim Pessachfest saß die Familie zusammen am Tisch, aß und betete. Auch die Familie Knobloch wurde abgeholt. Als ich sie mal wieder besuchen wollte, war das Siegel an der Tür.
Vor ein paar Wochen habe ich im Buch der 55 000 umgebrachten Berliner Juden nachgeschaut. Ich wollte wissen, ob meine beiden Freunde darunter sind. Ja, die stehen drin – beide Jungs. (Er kämpft mit den Tränen.) Gerd Abraham ist mit seinem Vater in Minsk, die Familie Knobloch ist in Auschwitz ermordet worden.
Ich hatte dann lange keine richtigen Freunde mehr. Erst nach dem Krieg, als ich wieder die Schule besuchte, fand ich neue Freunde.
Noch ein Erlebnis: In unserem Haus im Quergebäude wohnte die jüdische Familie Cohn mit zwei Töchtern. Nette Leute. Eines Tages holte mich der Vater der beiden Mädchen in seine Wohnung. Er wusste, dass ich so gerne las. Ich sollte mir ein paar Bücher von den Kindern aussuchen, sie würden sie sowieso nicht mehr brauchen. Bei dem Wort »sowieso« wusste ich schon: Aha, die werden abgeholt. Und so war es auch. Drei Tage später waren sie weg.
Mutter wollte immer, dass ich nicht alleine bin. Aber sie hatte nur ein Kind. Eines Tages kam eine ältere Dame mit einem Mädchen, Carla Hoffmann, zu uns. Die Eltern von Carla waren bereits ausgewandert und wollten alles vorbereiten, damit Carla und ihre Oma bald nachkommen konnten. Aber dann war es zu spät, sie durften nicht mehr ausreisen. Mutter vereinbarte mit der Oma, dass Carla bei uns wohnen würde. Ich kann nur mutmaßen, aber Mutter wollte bestimmt jemanden für mich haben, damit ich nicht so alleine war. Und dann wollte Mutter immer anderen helfen. So war sie. Sie half sogar den serbischen Kriegsgefangenen, die auf dem Weg zur Arbeit waren, indem sie kleine Pakete mit Stullen vor ihre Füße fallen ließ. Ich war einmal dabei und hatte große Sorge, dass wir von den Bewachern entdeckt würden.
Nun wohnte also Carla bei uns. Sie schlief mit mir in meinem Zimmer, wir verstanden uns gut. Carla war für mich wie eine Schwester. Zunächst ging sie noch auf eine andere jüdische Schule, aber später durfte auch sie nicht mehr gehen. Die jüdischen Schulen wurden alle geschlossen. Carla war vielleicht ein Jahr bei uns. Dann passierte mit ihr das Übliche. Sie wurden abgeholt. Als ich eines Tages nach Hause kam, sagte Mutter: »Die Carla ist wieder zurück zur Oma, weil die Oma nicht alleine gehen will.«
Die Oma hatte eine Benachrichtigung bekommen, dass sie abgeholt werden würde.
Ich wusste, wo die Leute hinkommen, die abgeholt wurden. Sie kommen in ein Konzentrationslager, und dort werden sie umgebracht, das war ganz klar für mich. Jemanden abholen hieß so viel wie umbringen. Und das konnte man sehen. Jeden Tag irgendwo. Das war nicht nachts, das war nicht geheimnisvoll, das war richtig offen. Auch für mich war es eine ständige Bedrohung …
Sie merken daran, wie ich erzähle, dass es diese Erlebnisse sind, die überragend im Gedächtnis geblieben sind. Alles andere, der Krieg...