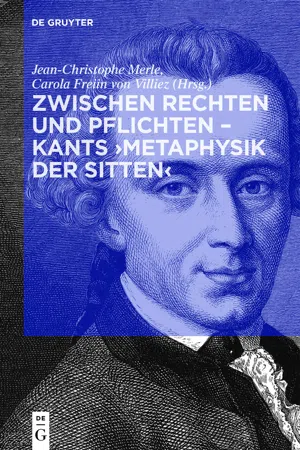
Zwischen Rechten und Pflichten – Kants ›Metaphysik der Sitten‹
- 397 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Zwischen Rechten und Pflichten – Kants ›Metaphysik der Sitten‹
Über dieses Buch
Kant nimmt in der Einleitung zur Metaphysik der Sitten eine Einteilung in innere und äußere Gesetzgebung vor. Beide leitet er aus demselben in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten formulierten kategorischen Imperativ ab, und fügt Letzterem weitere Elemente einer Grundanthropologie hinzu, die das Material für die einzelnen Teile der Rechts- und Tugendlehre darstellen.
Die Zusammenhänge zwischen Rechts- und Tugendlehre sind aber komplexer als die Einteilung in äußere und innere Gesetzgebung es nahelegt. Sie teilen etwa dieselben Anwendungsmethoden und Metaphern, und bei einer näheren Untersuchung der einzelnen Teile erweist sich diese Einteilung als entweder problematisch oder unscharf.
In der Textinterpretation der einzelnen Beiträge kommen die genannten Zusammenhänge und Beziehungen zum Vorschein – insbesondere weil ein Teil der Autoren dieses Bandes zum Kommentar beider Werken beiträgt. Ein weiterer Schwerpunkt dieser Textinterpretationen liegt bei der kritischen Untersuchung des Ertrags dieser Werke für die entsprechenden heutigen Debatten und die Auseinandersetzung mit heutigen im weiten Sinne "Kantischen" Positionen.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Kant und die Zwecke des Lebens
Einleitung
1. Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist. 2. Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um a. jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen; b. jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern; c. einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.
1 Das Leben als ein Geschenk
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Siglen
- Zur Gliederung der Metaphysik der Sitten
- Zum Konzept des Bandes
- Aufklärung, Vernunft und Universalismus
- Zum Rechtsbegriff in Kants Rechts- und Tugendlehre
- Wie kann äußere Freiheit ein angeborenes Recht sein?
- Das „zweideutige Recht“ („Anhang zur Einleitung in der Rechtslehre“)
- Unabhängigkeit und Eigentum in Kants Rechtslehre
- Muss Besitz erlaubt werden? Kant und die Naturrechtstradition
- Kants Privatrecht. Drittes Hauptstück §§ 36 – 40
- Was ist das Besondere an legalisiertem Sex? (Oder, wie kann doppeltes Unrecht Recht ergeben?)
- Staatliche Souveränität und Selbstbestimmung der Völker bei Kant und im Völkerrecht
- „Wahre Republik“: Kants legalistischer Republikanismus im historischen und systematischen Kontext
- Von den Tugendpflichten gegen Andere: Liebe, Achtung und Freundschaft
- Innere und äußere Pflichten, innere und äußere Handlungen: Das schwierige Verhältnis von Rechts- und Tugendpflichten in der Metaphysik der Sitten
- Kants moralische Begründung der Rechtspflichten und das Immanuel-Kant-Problem
- Methodenlehre und kasuistische Fragen in Kants Rechts- und Tugendlehre
- Kants Verbot der Lüge in der Metaphysik der Sitten: Irrweg eines „Moralpathologen“ oder konsequentes moralphilosophisches Denken?
- Pflichten in Ansehung der Tiere
- Kants moralische Amphibolie und die Beziehung zwischen Ethik und Religion
- Kant und die Zwecke des Lebens
- Hinweise zu den Autoren
- Personenregister