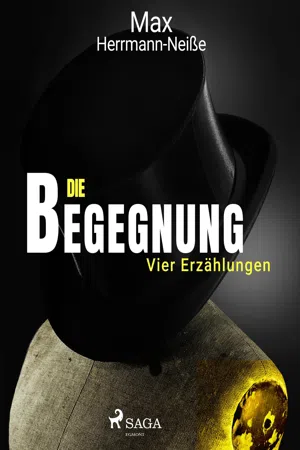
- 138 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Begegnung. Vier Erzählungen
Über dieses Buch
Ein herausragendes Meisterwerk der 1920er Jahre: Der Novellenzyklus "Die Begegnung" besteht aus vier Erzählungen, die das Provinzielle mit aller Macht aufs Korn nehmen. Auch wenn die Kleinstadtmentalität und die damit einhergehenden Eigenheiten im Zentrum der Kritik stehen, so ist doch auch immer eine gesunde Portion Ironie dabei sowie eine zugrundliegende Botschaft von Toleranz und Pazifismus. -
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Die Begegnung. Vier Erzählungen von Max Herrmann-Neisse im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Altertumswissenschaften. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
LiteraturLucie und Maria
1
Als hätte Lucie das vorhergegangene Jahr nicht genügend gründlich erlebt in allem, was es ihr geboten hatte, wiederholte sich das gegenwärtige als sein peinlich genauer Abklatsch. Bis auf die geringfügigste Einzelheit stimmte eines Monats Inhalt mit dem des entsprechenden vorjährigen überein. Da Lucie ein Tagebuch führte, das bis auf Witterung und Temperatur alles genau notiert, konnte sie diese wundersame Entdeckung mit genügend vielen Tatsachen belegen. War nicht am siebenten Juli des Vorjahres, genau wie im diesjährigen, am klarsten Himmel plötzlich ein dunkles Wetter dagewesen, als wüstes Gewitter zur Entladung gekommen und ebenso jäh verschwunden, daß nach fünfzehn, zwanzig Minuten der Himmel wieder weiß und rein sich weitete, als sei nichts geschehen, und derselbe Zug Schwalben, der vorher um den Turm der Bürgerkirche gekreist war, seine selig leichten Kurven zog? Damals freilich hielt sich Lucie in ihrer Heimatstadt auf, die sie seit dem Ableben der Eltern gemieden hatte, während heut der Schwalbenflug um den dürftigen, schwarzen Schornstein glitt, der vor dem Fenster ihrer Berliner Hinterhauswohnung wie ein schmutziger Finger einen sicherlich nicht ganz einwandfreien Eid leistete. Lucie war eben aus dem Büro nach Hause gekommen; sie hatte sich auf dem Gasherde etwas, was schnell fertig wurde, als kümmerliches Mittagsmahl bereitet und dann ihr bißchen Geschirr aufgewaschen. Nun saß sie, um die sechste Abendstunde, erschöpft in dem alten Schaukelstuhle am Fenster. Ihre überanstrengten Nerven konnten nicht zu völligern Schlummer kommen, so wurde sie in einer Art Halbdämmern in die entsprechende Spanne des vorigen Jahres zurückversetzt. Eine sogenannte Freundin, die fünf, sechs Jahre für sie verschollen war, hatte geschrieben; ein überschwenglicher Briefwechsel entlud sein Feuerwerk, zwei Menschen, die sich eigentlich unbekannt geworden sind, entzünden sich aus Fernen aneinander zu unerhörten Monologen, die gefährliche Täuschung einer Gleichgesinntheit macht, daß sie sich in die Arme taumeln. In dem Augenblick, wo eines dem andern schrieb, steigerte sich die Schreibende künstlich zu einer unbedingt Hingegebenen, berauschte sich an der eignen Gefühlsseligkeit und bezog alle Zärtlichkeit auf der Partnerin Brief, der doch nur Folie des eignen enthusiastischen Selbstgesprächs bedeutete. Als dann die Einladung kam, redete Lucie sich ein, nun werde von der Freundin die Heimatstadt als innigere Hut geschenkt, als je durch der Eltern Fürsorglichkeit sie ihr genehm, gemacht war. Und mit den überspanntesten Erwartungen trat sie diese Fahrt an, erregter als eine Braut, die zum Bräutigam reist, durchhastete fiebernd die letzten Stationen wie Traumbilder, in eine simple Dorfhaltestelle Friedewalde eine Magie phantasierend, die den dürftigen Platz mit scheußlich rotem Bahnhofsbau, Güterbaracke und Ölfunze zum Eingang des Paradieses überhob. Als am Bahnsteig der Heimatstadt eine hysterische Person der Lehrerin Maria Gnitschik schluchzend um den Hals fiel, grinste die Eingebornenschar, die lungernd den Inhalt des letzten Abendzuges registrierte.
2
Maria Gnitschik führte ihren Besuch, ohne daß es ihm auffiel, auf dem abgelegenen Promenadenwege hinten um die Stadt herum in ihre Wohnung. Beide schwiegen fast immerzu: Lucie, weil ihr übervolles Herz nicht wußte, womit es zuerst verströmen sollte, und alle die tausend Gefühle, von denen jedes am raschesten als Ausspruch hinauszukommen trachtete, sich so drängten, daß keines die Pforte gewann; Maria, weil sie, von Lucies stürmischer Begrüßung befremdet, überlegte, wie nun ein Übergang in nüchternere Wirklichkeit zu schaffen sei. Aus der Kommißbäckerei schien Lucie noch derselbe Brotgeruch zu wehen, den sie immer auf ihrem Wege zur Schule begeistert eingesogen hatte, und irgendein schattenhafter Alter keifte am Boskett hinter fliehenden Kindern her, wie einst der Parkwächter ihre eignen Kiemmädchenstreiche verzankt hatte; – aber in Wahrheit bestand die Militärbäckerei längst nicht mehr, und der Wächter war geraume Zeit tot. Den Stern jedoch, der als derselbe über dem Kreuz der Gymnasialkapelle flimmerte, sah Lucie nicht, weil sie mit liebkosenden Blicken auf ihre Füße starrte, die nun also endlich wieder einmal Heimaterde berührten. So blieb ihr auch der angestrengt spöttische Zug in Marias Miene verborgen. Im Zimmer war ein hübscher Abendbrottisch gedeckt, die Wirtin, eine allzu freundliche, nicht ganz vertrauenswürdige Beamtenwitwe, aß mit, so kam zwischen den beiden Mädchen immer noch keine rechte Vertraulichkeit auf. Zur Feier des Ereignisses gab es Wein, und als erst ein paar Gläser Lucies Zunge gelöst hatten, fragte die Wirtin den Gast erfolgreich aus, ohne daß Maria in irgendeiner Form vorgebeugt hätte. Allzu spät erhob sich die Witwe, wünschte Lucie eine gute Nacht für das Lager, das sie ihr auf dem Sofa bereitet hatte, und meinte noch anzüglich: »Sie Großstädterin werden ja wohl freilich nicht gewohnt sein, so zeitig schlafen zu gehn; aber wenn man seit früh um halb sieben auf den Beinen ist, ist man abends nicht mehr viel wert! Unsereins muß dahinter her sein, von nichts ist nichts, wir können die Nacht nicht zum Tage machen, da müssen Sie mich alte Frau schon entschuldigen.« Lucie wurde rot, bloß weil sie den Vorwurf unbegründet fand und sich unschuldig verdächtigt fühlte, und Maria grinste hämisch. Daß alles hatte sie sich anders gedacht, empfand Lucie jetzt, folgte aber stumm dem Beispiel Marias, die sich bereits anfing zu entkleiden, sie verstand den Wink und wurde traurig. Gern wäre sie wie früher zu Maria ins Bett geschlüpft und hätte in heißem Geflüster noch die halbe Nacht hindurch ihr Dasein heruntergebeichtet, aber Marias abweisendes Gähnen nahm ihr allen Mut. So packte sie sich ernüchtert aufs Sofa, und selbst, als sie von da aus noch ein paar Worte mit Maria wechseln wollte, schallte es von drüben schroff: »Entschuldige, ich bin furchtbar müde, ich muß auch morgen frühzeitig wieder ins Amt. Aber du kannst natürlich liegen bleiben, solange du magst!« Lucies Mund schloß sich, als ob eine schwere Hand auf ihn gelegt sei, und nicht einmal mehr das pflichtgemäß höfliche »Gute Nacht!« traute sich hervor. Derselbe Stern, der einst in ihr nächtliches Zimmer seinen Gruß gesandt hatte, sah sie jetzt aus dem Spiegel über dem Waschtisch an, aber sie hielt beide Augen krampfhaft zugedrückt, als fürchte sie, sogar in der Finsternis etwas erblicken zu müssen, was sie sich in dieser so zärtlich ersehnten Zuflucht weiß Gott nicht erwartet hatte.
3
Lucie liegt mit geschlossenen Augen wach. Durchs offene Fenster strömen die altgewohnten Geräusche: der bekannte Klang des Glockenschlags der Rathausuhr, das Rangieren der Güterzüge am Konradsdorf er Wege, ja, Lucie glaubt, das Rieseln des Brunnens vom Fischmarkte aus weiter Entfernung herüber zu hören. Ihr ganzes vergangenes Leben wächst wie leibhaftige Hecken um sie auf und streift ihre Wangen. Morgen würde sie das Haus am Ringe wiederschaun, in dem sie achtzehn Jahre zugebracht hatte, sie sah sich zur Schule gehen, vom Vater begleitet, der ihr freundschaftlich in den Rücken puffte: »Grade gehn, Lu!«, sie hätte ihn morden können dafür, daß es auf offnem Markte geschah. Dabei hielt sie damals noch zu ihm, krähte bei jeder wohlverdienten mütterlichen Zurechtweisung herausfordernd: »Ich sag’s Papa!«, petzte Mutters harmlose Vergnügungen, aber als die Achtjährige den Vater einmal dabei überraschte, daß er die junge Assistentin küßte, schwieg sie, ließ sich auch gegen ihn nichts merken und stand weiter auf seiner Seite. Papa hatte Lucies Freiheitsgefühl, das Mama als Trotz verabscheute, eigentlich geweckt und begünstigt. So ängstlich er sonst auf Reputation hielt, hier tat er unbekümmert, was ihm gut dünkte. Kopfschüttelnd erlebte die Schulvorsteherin, daß Lucie Wagner Reitunterricht nahm. Und eines Tages mußte sie den Herrn Doktor persönlich aufsuchen mit der Mitteilung, seine Tochter hätte sich mit einem gleichaltrigen Gymnasiasten in den Wällen herumgetrieben. Auf Dank und Entrüstung war die Lehrerin gefaßt, dieser Vater aber benahm sich höchst seltsam. Er tat nämlich, als geschehe solch unziemlicher Verkehr durchaus mit seinem Wissen und Willen, und schloß die Unterredung ganz ungehörig: »Sollten wir uns nicht erinnern, daß wir’s in unsrer Jugend genau so getrieben haben? Na, und hat’s uns was geschadet?« Dabei klopfte er der entsetzten Amtsperson wie tätschelnd auf den feisten Nacken, komplimentierte sie mit einem sanften Wuppdich zur Tür hinaus, und sein lustig ins Wartezimmer geschmettertes »Der Nächste, bitte!« schmeckte unausstehlich nach Ironie. Noch beim Mittagessen war Papa ganz aufgeräumt, gab mit drastischer Mimik den Vorgang zum besten, trotz Mamas Protest, die vor dem »Kinde« die Autorität nicht erschüttert wissen wollte, und tat die Vorsteherin unwiderruflich mit dem bündigen Resultat ab: »Die alte verrückte Schraube soll vor ihrer eigenen Türe kehren!« Übrigens wurde Lucie bald nachher sowieso von der Schule genommen und erhielt, was sie noch an Kenntnissen bedurfte, durch Privatunterricht übermittelt. Die nächstfolgende Zeit versprühte in ihrer Erinnerung als eine Kaskade unfaßbarer Wunder. Jener Schüler freilich, mit dem die Vorsteherin sie beim Blumenpflücken betroffen hatte, bedeutete nur eine Harmlosigkeit. Damals war man beiderseits noch zu tapsig, unterhielt sich von Schulaufgaben, wenn man überhaupt den Mund auftat, und der Bengel hatte sich nicht einmal getraut, sie bei der Hand zu fassen, nur immer durch waghalsige Kunststücke seine grenzenlose Verehrung bezeugt. Das war nebensächlich gewesen und hatte auch noch die halb kälbrige, halb schwüle Freundschaft mit der Sergeantentochter Maria Gnitschik vertragen. Einmal, als Lucies Eltern verreist waren, sollte die Freundin über Nacht bei ihr bleiben, damit sie nicht ganz allein in der großen Wohnung wäre. Da hatten sich die zwei Mädels über des alten Wagners gut versehenen Likörschrank hergemacht und nach und nach alle Sorten durchprobiert. Maria, die sonst gegen trunkene Männer und Verschwendung keifte, wurde beim unentgeltlichen Alkoholgenuß zugänglicher. Unter der Einwirkung des ungewohnten Getränks kam die verborgne, wahre Natur ihres Wesens heraus, schließlich hatte Lucie, die Arzttochter, noch allerlei von ihr lernen können. Aus Marias Gesicht trat die sonst unterdrückte Fratze, es war, als rächte sie sich für ein Manko. Sie tat sich fast etwas darauf zugute, diese Sache von vornherein als Schimpfliches zu demonstrieren, vor dem sie gleich wären, Lucie so gemein zu machen, daß sie nie mehr wieder wagen könnte, sich vor ihr zu überheben. Mit einem plumpen, ungepflegten Zynismus wurde etwas anstößig gemacht, was unbefangen und freimütig erlebt, nicht unwürdiger zu sein brauchte, als jede Möglichkeit dieses vielfältigen Daseins. In ihrer Trunkenheit hatten sie vergessen, das Fenster zu verhängen: als nun der Morgen auf einmal das Zimmer erhellte, wandten sich zwei nackte Körper wie haßerfüllt voneinander ab, jeder der Außenseite des Bettes zu, und erbrachen sich in einem gleich großen Katzenjammer Leibes und der Seele.
4
Der Doktor Wagner war ein komischer Kauz. Mit seiner Frau kam er ja allerdings nicht zum besten aus, aber sonst blieb »leben und leben lassen!« sein Prinzip. Vom Rheinland ins schlesische Rom verschlagen, mit einer besonders herben Nummer dieses scheinheiligen Landstrichs verehelicht, suchte er soviel als möglich Freude und Profit zu ziehen aus der Position, die ihm diese Siedlung auferlegte. Er tat also nach außen hin Kirchliches gewissenhaft mit, ging an Fronleichnam im Prozessionszuge und war bald der Vertrauensarzt der gesamten Landbevölkerung. Da er das Leben an sich lustig fand und keinen Grund sah, in dieser kurzen Spanne Zeit sich oder andern etwas zu versagen, schrieb er den Gymnasiasten jedes gewünschte Attest und war weiblicher Bedrängnis zu jeder Hilfe erbötig, während seine einheimischen Kollegen borniert auf der Vorschrift bestanden und fanatisch eher den Tod eines geängsteten Mädchens oder einer schwächlichen Frau verantworteten, als den selbstverständlichen Dienst, der einem unerwünschten Bevölkerungszuwachse vorbeugte. Als alter Herr einer farbentragenden katholischen Verbindung brachte er bald in den Ferienbetrieb der Studenten einen ganz anderen Zug, als die verbiesterten und zahmen Amtsrichter und Oberlehrer gewohnt waren. Sein Haus stand den jungen Kommilitonen immer offen, es gab da stets Alkohol die Menge, er arrangierte einen großzügigen Rummel von Festen, die er finanzierte und mit seiner rheinländischen Karnevalserfahrung immer wieder abwechslungsreich zu gestalten verstand, daß das Ferienerlebnis manches Studenten hier in der universitätslosen Kleinstadt üppiger blühte, als die ganze offizielle Zeit im Semester zu Breslau. Natürlich war Lucie der Liebling der Jünglingsschar, dem von allen Seiten überschwenglich der Hof gemacht wurde, und hier geriet sie nun ganz anders, als bei dem naiven Schüler, in den Wirbel sinnlicher Erfahrung. Die medizinische Bibliothek ihres Vaters war ihr nie verschlossen gewesen, später hatte er sie sogar hin und wieder zu Hilfeleistungen bei etwas verfänglichen Operationen zugezogen, weil er meinte, auf diese Art am besten von Anfang an gegen überspannte Vorstellungen und lüsterne Illusionen zu feien und künftige Enttäuschung ein für allemal auszuschließen. Gerade entgegengesetzt fiel die Wirkung aus: Lucie war fest überzeugt, dieser sachlich physiologische Apparat, dieses übersehbare Funktionieren könnte nicht die ganze endgültige Aufklärung bedeuten. Sie erwartete sich ein unnennbares Mehr, etwas Außerordentliches, Mystisches hinter diesen deutlichen Vorgängen, auf die sie demgemäß nicht viel Wert legte. Alles, womit in der Schule ihr Kopf umnebelt worden war, die verblasne, ungescheite Gefühlsduselei der Mutter, die falsche Verklärung der Romane, Dramen, Gedichte, an denen sie sich trunken geschlürft hatte, bestand auf seinem Recht und ließ Vaters Enthüllungen nur gelten mit dem Vorbehalt: dies zugegeben, existiert daneben noch ein verborgnes, mit gar nicht zu beschreibenden Verzückungen gesegnetes Reich. Aus dieser Sehnsucht heraus begann sich in ihr ein Knäuel von schönen Worten zu bilden, von hold sich reimenden und zum leichtesten Silberschmuck verknüpften Wendungen, einzig würdig, das erharrte Wunder an Liebesoffenbarung geziemend zu begrüßen. Als sie diese Strophen und Psalmen aufgeschrieben hatte, war ihr vom Vater geraten worden, ein solches Talent regelrecht zu entwickeln, den Stil zu bilden und sich nach und nach an weniger überschwengliche, desto mehr handwerkliche Zucht erfordernde Themen und Formen zu machen; Maria aber war kaum ernstlich auf die ihr unverständliche, und auch reichlich belanglose, Spielerei und Augenblickslaune eingegangen. Damals schien es Lucie, als verstünde nur die Mutter sie diesmal richtig, denn der war alles, wovon Lucies Verse phantasierten, unbestreitbare Realität, die stellen die wahre Wirklichkeit dar, und was ihr das unergründliche Dasein bis jetzt beschieden hatte: die unerfreuliche Ehe mit dem ihr wesensfremden Manne, die hartnäckigen Störungen, immer wieder durch Dienstboten bereitet, die durchaus in Fragen der Wirtschaft von ihr eine Entscheidung heischten, dies ganze ihr unbehagliche Getrieb, worin Berechnungen, Geld, gesellschaftliche Verpflichtungen und dergleichen überflüssige Bagatellen eine so große Rolle spielten, das mußte ein schwerer Alptraum sein, aus dem sie einst endlich in die gewisse Märchenhaftigkeit erlöst werden würde. Für Lucie ging diese Märchenhaftigkeit prompter in Erfüllung. Diese Füchse und Burschen aus der Bundesbruderschaft ihres Vaters, oft von ihm wirtschaftlich abhängig, zeigten sich ihr natürlich nur von der besten Seite und in glänzendster Form, da sie immer in der kurzen Zeitspanne mit ihr zusammenkamen, die durch Alkoholgenuß und festliche Stimmung die sonst miesen, derben oder dämlichen Bauern- und Beamtensöhne in einen außergewöhnlichen Schwung brachte. Während des Flirtens und Verliebttuns war dann nichts an ihnen zu vermuten von der belämmerten und stieren Chose, die während der übrigen Tagesstunden ihre Existenz darstellte, nichts von der mühsamen Ochserei zum Examen, dem schmierigen Kampf mit Wirtinnen, Pfandleihern, Restaurateuren, der Rivalität untereinander um die Gunst eines alten Herrn oder einflußreichen Gönners, das Gelaufe und Sichdemütigen wegen eines kümmerlichen Stipendiums, die geladne Atmosphäre im Elternhause, wo Vater und Mutter einem immer das kostspielige Studium vorwarfen und zähe Schwestern das an ihre Ausbildung gewandte Kapital verdrossen mit dem verglichen, was dem Bruder Studio zugute kam. Alle galanten Phrasen, die das Mädchen da von animierten Bürschlein vorgebetet bekam, nahm sie unbesehen als echt hin, jede war ein Sprachrohr, ein Abgesandter jener geheimnisvollen Macht »Liebe«, und Lucie kam gar nicht aus der Exaltation heraus, trieb vor Freude zitternd immerzu in einem Flammenmeer von ehrerbietigen, huldigenden, zärtlichen und aufreizenden Ansprachen, Taten, Gesten und Zuflüsterungen. Da diese Leutchen aber es alle im Grunde gar nicht so verwegen meinten, wäre es nie zum direkten, körperlichen Erlebnis gekommen, wenn Lucie nicht eben, auf die Erziehungsmethode ihres Vaters falsch reagierend, diese Seite der Angelegenheit für absolut unwichtig gehalten hätte. So gab sie sich zuerst hin, beziehungsweise nötigte sich auf in der Kolonnade des Gartenrestaurants »Zur Erholung«, dem an sich schüchternen stud. jur. Joseph Jeitner, der nur bis zum Doktor studierte und dann ins Bankgeschäft von Brieger eintrat. Es geschah bei einem Winterfeste, Lucie hatte viel mit dem jungen Grafen Kischka getanzt, dem einzigen Adligen, der nicht Korpsstudent war, weil sein Vater mit Hilfe der Katholischen Partei in den Landtag zu kommen hoffte. Dieser Jüngling hatte ihr zwar auch nach allen Regeln der Courtoisie geschmeichelt, daß sie in tausend Himmeln wolkenleichter Gehobenheit schwebte, aber als sie notgedrungen einmal mit einem andern tanzen mußte und dann zufällig an der Nische bei der Sommerbühne vorbeikam, vernahm sie des Gräfleins Stimme, und zwar ein ebenso herzliches Gebalze, das einem obskuren Schneidertöchterlein, Schwester eines Studenten, galt. Da stürzte sich ihre durch den Grafensohn geweckte Begierde auf ein beliebiges Opfer, zum nächsten Tanze wurde sie von Joseph Jeitner engagiert, nahm ihn im Tanze geradezu orgiastisch her, da er schon viele Liköre mit alten Herrn am Büfett gekippt hatte, fühlte er sich zu Größerem fähig, das heißt, eigentlich war ihm wirklich etwas unwohl, er sagte also, in der Hoffnung, sie würde ablehnen, ob man nicht ein bißchen hinausgehn sollte, sie hing sich gleich in seinen Arm, und man schwankte durch den beschneiten Garten in die Kolonnade. Jeitner war etwas wirblig zumute, er griff nach einem Halt, faßte dabei Lucie zufällig an einer etwas bedeutsamen Gegend, sie mißverstand, erwiderte aus Wut auf den Grafen die vermeintliche Attacke. Jeitner, umnebelt, reagierte, rein automatisch, in der üblichen Weise, und das Unglück war geschehen. Die erhitzte Lucie, durch die Übungen mit Maria vor dem Schmerzhaften solcher ersten Erfahrung gerettet, hatte gleich darauf keine Ahnung mehr, was eigentlich geschehen war, dachte nur enttäuscht, als sie sich die Kleider zurecht strich und den Jeitner, der eine komische Figur machte, ziemlich roh an die Holzwand stieß: »Ist das alles?«, berichtigte sich aber gleich, daß nach der Aufklärung durch ihren Vater sie von diesem Getue eigentlich ja nichts Überwältigendes erwartet hätte. Kam sich auch nicht sonderlich verändert vor, schritt am verdutzten Jeitner vorbei, zurück in den Saal, tanzte hohnlächelnd mit dem Grafensohne, tanzte auch noch mal mit Jeitner, ohne ihm im Gespräch eine weitere Vertraulichkeit einzuräumen, und schlief nach Schluß des Balles so guten Gewissens dauerhaft, wie nur irgend möglich. Den Grafensohn betrachtete sie von da ab nur noch mit einem gewissen charitativen Interesse, und Herr Jeitner wurde so gründlich abgehängt, daß er selbst keine weitere Annäherung mehr versuchte. Übrigens blieb ihm von diesem Erlebnis ein periodisch wiederkehrender Rheumatismus.
5
Der Arzttochter, die an diesen Ereignissen zwiespältig geworden war, trat nun Herr cand. med. Namislow entgegen. Ein Lehrersohn, der das harte Studium Medizin gerade aus einer Art Selbstdisziplin gewählt hatte, um sein weichliches Gemüt an alle Fürchterlichkeiten des Daseins zu gewöhnen, und auch um möglichst viel Elend zu stillen. Übrigens war er unglaubhafterweise Mitglied des Kunstvereins, der heimlich unter den Gymnasiasten bestand, las gern Bücher und hatte Schnitzler zu seinem literarischen Gott gemacht. Daraufhin flog ihm Lucie ohne weiteres zu. Seinen Vater traf ein Schlaganfall, als eine humanere Epoche offiziell einzusetzen schien, mit Elternbeiräten Streitigkeiten wegen des Züchtigungsrechtes zu bestehen waren. Seine Mutter grämte sich darüber, daß ihr die Marktweiber den Titel Frau Rektor nicht mehr spendieren mochten, starb daraufhin an einer undefinierbaren Nervenkrankheit. Da schlang Lucie noch inniger ihre Arme um seinen Hals und setzte es durch, daß er im Hause ihrer Eltern aufgenommen wurde. Der Doktor Wagner, der wohl gemerkt hatte, wie Lucie damals seinem Einfluß entfremdet und der Mutter zugefallen war, willigte ein, um Lucie durch diese Großzügigkeit für sich zurückzugewinnen. Und machte wieder einen Fehler: denn die unumschränkte Selbständigkeit, die er seiner Tochter gab, machte sie auch von ihm selbst unabhängig, auch wider ihn eigenwillig. Sie nahm nun offen die Partei der Mutter, weil sie ja, jetzt selber am ausschließlichen Besitze eines Mannes interessiert, der Mutter Tyrannei besser verstand als Papas verruchte Freizügigkeit. Damals hatte sich übrigens Maria von ihr völlig zurückgezogen, in ziemlich verletzender Weise, durch einen brutalen Brief bescheinigend, sie müsse als zukünftige Lehrerin auf ihren Ruf bedacht sein und könne Lucies Verhalten, mit einem jungen Manne, der nicht ihr offizieller Verlobter sei, unter einem Dache zu leben, nicht billigen. Diesen Brief verheimlichte Lucie ihren Eltern solange als möglich, gebrauchte immer neue Ausflüchte, um Marias Ausbleiben zu erklären, bis eines Abends Papas wissendes: »Nu, wenn schon!« mit einer ganz gleichen Empfindung in ihrer eignen Brust zusammentraf. Allmählich fand der Doktor Wagner an dem jungen Namislow geradezu ein Wohlgefallen, gewöhnte sich mit Freude an den Gedanken, später dem Schwiegersohn die Praxis zu übergeben, denn er nahm diese übliche Fortentwicklung des Verhältnisses als selbstverständlich an, während Lucie sich doch immer nur von der Eingebung des Augenblicks leiten ließ und sich nicht im geringsten gebunden fühlte. Er merkte zunächst auch nichts davon, daß eine bedrohliche Stimmung sich mit ihm und seinem Hause befaßte. Längst war der Zulauf, den seine Sprechstunden fanden, der Kollegenschaft unbequem, und sie wartete nur auf die günstigste Gelegenheit, ihm zu schaden oder am besten ihn ein für allemal zu erledigen. Der Katholizismus, der hier herrschte, war von einer hinterhältigen, sauertöpfischen, mißgünstigen Art, so chokierte des Doktors fröhliche Lebensführung bald die Repräsentanten dieser Stadt. Dazu kam, daß mit dem Umschwung der politischen Verhältnisse in Deutschland dieser Ort, der bisher den Zentrumsleuten unumschränkt gehört hatte, eine größere Anzahl Sozialdemokraten erhielt, und sogar eine sozialdemokratische Zeitung neben das bewährte klerikale Organ trat. Nun befürchteten die Führer der Katholischen Partei, das wenig einwandfreie Privatleben des Doktors könnte der Polemik der Gegner günstige Gelegenheit zu verhängnisvollen Angriffen bieten, und strebten also ihrerseits danach, ihn loszuwerden. Schließlich wendete sich auch die Stimmung innerhalb der Ferienverbindung immer mehr gegen den alten Herrn Wagner. Ein Teil des Klerus begann damals die Antialkoholbewegung zu fördern, um so die allgemeine Zeittendenz zur Mäßigkeit der Kirche zugute kommen zu lassen. Derzufolge schränkte sich auch der studentische Betrieb nach außen hin ein, öffentliche Kommerse und Festivitäten wurden als anstößig und der Sache nicht dienlich verpönt, vom Unwillen über das studentische Korporationswesen suchten die katholischen Verbände ausgenommen zu werden, indem sie freiwillig Askese mimten. Sowieso verlangte die schlimme deutsche Finanzlage von diesen Söhnen der Beamten und schlechtbesoldeten Mittelstandler jede mögliche Einschränkung, und nun begannen die jungen Leute den Doktor Wagner dafür zu hassen, daß er sie erst an eine Lebensführung gewöhnt hatte, die ihnen unter den jetzigen Umständen versagt war. Die jungen Mädchen beneideten Lucie längst um die Vorzugsstellung, die sie innerhalb des studentischen Bundes genoß; die Mütter ärgerten sich daran, daß diese freche Person, die nicht mal das Lyzeum bis zum Schlußexamen besucht hatte, sich so breit machen dürfte, obwohl Lucie ihnen doch nach Festlegung auf Herrn Namislow keine Chancen für ihre Töchter mehr verdarb. Es setzte aber eben, wie gesagt, ein allgemeines Kesseltreiben gegen die Familie Wagner ein, man zog sich von allen Seiten von ihr zurück, und endlich mußte sogar der lebenslustige Doktor merken, wie es um ihn stand. Jetzt, da es seine ganze Existenz und damit die Grundlage seiner rheinischen Fröhlichkei...
Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Kolophon
- Die Begegnung
- Lucie und Maria
- Das Experiment
- Die Klinkerts
- Über Die Begegnung. Vier Erzählungen