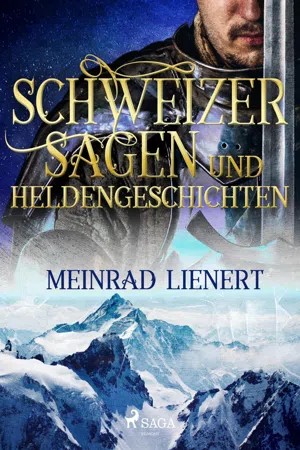
- 297 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Schweizer Sagen und Heldengeschichten
Über dieses Buch
In der Neuausgabe der 1914 erstmals veröffentlichten "Schweizer Sagen- und Heldengeschichten" spuken Geisterpferde durch die Erzählungen, werden Feengrotten und unteriridische Kristallgewölbe in den Berglandschaften entdeckt und Zwergenfrauen und Bergmännlein weisen den Weg. -
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Schweizer Sagen und Heldengeschichten von Meinrad Lienert im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Altertumswissenschaften. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
LiteraturFünfter Abschnitt.
Die Schlacht bei Marignano.
Da die Eidgenossen allezeit ein kriegsbereites, rauflustiges und unternehmendes Volk waren, genügte es ihnen nicht, zu Hause auf ihren Alpenweiden das Vieh zu hirten und zu hüten oder in den Wäldern dem Wolf und Bären nachzustellen oder in den Tälern das Feld zu bebauen und in den Städten und Dörfern ruhsam dem Gewerbe und Handwerk obzuliegen. Sie zogen aus eigenen Stücken in fremde Länder und bekämpften die fremden Völker, wobei sie meistens gut davonkamen und viele Beute heimbrachten.
Besonders gern aber machten sie sich über den stiebenden Steg ins weltverlorene Urserntal hinauf und von dort über das Gotthardgebirge ins Land Italien hinunter.
Und so viele Feldzüge sie ins Welschland taten, fast immer kehrten sie siegreich und beutebeladen heim. Aber die gewonnene Beute, das Gold der Könige und Fürsten, denen sie kriegen halfen, und eine unbändige Kampflust trieben die Eidgenossen nach und nach mehr aus der Heimat und in gefährliche Kriegsabenteuer, als ihrem Lande gut tat. Sie vernachlässigten die Heimat, trübten ihren schönen Frieden und machten, dass Frauen und Kinder zu Haufe immer in Angst und Kummer leben mussten. Vergeblich erhoben sich warnende Stimmen im eigenen Lande gegen diese fortwährenden kriegerischen Auszüge. Und da schickte ihnen Gott eine Niederlage, nach der sie nicht mehr völkerweise, sondern mehr in einzelnen Haufen in fremde Kriegsdienste zogen. Die Eidgenossen benahmen sich aber in dieser Schlacht so heldenhaft, dass sie ihnen fast höheren Ruhm eintrug als ein grosser Sieg.
Es war am 13. Herbstmonat des Jahres 1515, kurze Zeit nach der Schlacht bei Novara, in der die Eidgenossen einen Sieg erfochten hatten, der die Welt mit Bewunderung und den französischen König mit Furcht erfüllte, da zogen sie mit Trommeln und Pfeifen und Hörnerschall zu den Toren Mailands hinaus, dem feindlichen Heere entgegen. Es waren ihrer wohl an die 24000 Mann. Sie brauchten aber nicht weit zu ziehen. Gleich vor der Stadt erwartete sie das viel grössere, mit furchtbarem Geschütz ausgerüstete Heer des französischen Königs Franz I. Jetzt teilten die Eidgenossen ihr Heer in drei gewaltige Haufen. Bevor sie sich aber an den Feind machten, knieten alle nieder zum Gebet. Da stand der Führer der Vorhut, ein Zuger, auf, nahm drei Erdschollen, warf sie über die Köpfe der Krieger hin und rief mit feierlicher Stimme: „Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Vergesset eure Heimat, denn wenn wir nicht siegen, soll hier unser Kirchhof sein. Drum unverzagt! Kämpft würdig der Väter! Gott mit uns! Vorwärts!“
Jetzt rückten sie gegen den Feind vor, warfen die welschen Vorposten, und dann ging der Schlachttanz an, zu dem die französischen Trompeten und die eidgenössischen Heerhörner eine gar schauerliche Musik spielten. Die Franzosen hatten eine gar gute Stellung, und wie nun die Schweizer gegen sie anrückten, donnerten ihre Geschütze Tod und Verderben in ihre wohlgeordneten Reihen. Aber sie taten keinen Wank, rückten immerzu vor. Und nun stürmte eine Schar junger, auserlesener Schweizer, die alle weisse Federn auf den Hüten trugen, voraus, drang zuerst über den breiten und tiefen Graben, den die Feinde gezogen hatten, und nahm in furchtbarem Nahkampfe die ersten Welschen Geschütze. Jetzt kam aber Leben ins französische Heer, das Mitteltreffen rückte vor mit seiner Reiterei und mit den berühmten schwarzen Banden. Nun hatten die Schweizer einen bösen Stand. Ein fürchterlicher Hau, eine entsetzliche Schlächterei ging an, und hin und her, vor und zurück gingen die Wogen der blutigen Völkerschlacht, und bis nach Mailand drang der Lärm des fürchterlichen Kampfes. Endlich ging die Sonne mit blutigem Scheine unter.
Aber die Schlacht stand nicht still. Beim aufgehenden Monde wurde weiter gekämpft. Die grössten Helden von beiden Seiten gerieten aneinander, und selbst den französischen König Franz sah man in seinem blauen Mantel überall, wo es am bösesten herging. Mann gegen Mann zerfleischten und zersetzten sich die Kämpfer. Schon sahen die Eidgenossen die verlassenen feindlichen Geschütze vor sich. Da ging der Mond unter, und es ward plötzlich stock dunkle Nacht, und todmüde zogen sich beide Heere etwas zurück.
Doch die Eidgenossen waren guten Muts. Sie hatten den Feind trotz seiner Übermacht und trotz seiner gefährlichsten Waffe, der furchtbaren Geschütze, zurückgedrängt und hofften so sicher auf den Sieg, dass sie schon Eilboten mit der Siegesbotschaft in die Heimat abschickten. Aber ihre Lage war übel. Sie waren durchnässt, hatten Hunger und froren in der kalten Nacht.
Wie nun die Sonne am Morgen wieder blutrot aufging, brüllte der Stier von Uri mächtig über die weite Ebene und rief die Eidgenossen zum Kampfe.
In drei Haufen rückten sie wieder gegen den Feind, die Urner und Züricher im Mitteltreffen zuvorderst, und warfen die heranstürmenden schwarzen Banden zurück. Doch des Königs Reiterei, vom König selbst geführt, vermochten sie nicht zu werfen, obschon sie dreimal den Angriff erneuerten. Dazu donnerten wieder die feindlichen Geschütze, deren sich die Franzosen in der Nacht heimlich wieder bemächtigt hatten, gegen sie los, ihnen die schlimmsten Verluste beibringend.
Da sanken die grössten Helden der Eidgenossen in dem schrecklichen Ringen. Es sanken der Landammann von Uri, der alte fünfundsiebzigjährige Landammann von Schwyz, der mit drei Pfeilen in der Brust sein Volk noch zum Kampfe anfeuerte. Es fielen die Führer von Graubünden und viel, viel andere Helden. Also wurde das Mitteltreffen der Eidgenossen allmählich zurück gedrängt.
Aber an beiden Seiten, auf dem rechten und linken Flügel, drangen die Schweizer wieder vor und warfen die Welschen zurück. Schon war es Mittag, und die Eidgenossen holten zu einem letzten gewaltigen Vorstoss in der Mitte aus, um den Feind ins Herz zu treffen.
Da ertönte auf einmal der Ruf: „San Marco, San Marco!“ Und jetzt rückte im Sturmschritt das venetianische Heer den Franzosen zu Hilfe. Gleichzeitig liessen die Franzosen die Dämme des Lambroflusses durchbrechen, also dass das Wasser auf die Eidgenossen zuströmte, wodurch sie verhindert wurden vorzurücken, denn nun standen sie bis an die Knie im Wasser.
Nun mussten sie sich, da jede Aussicht auf Sieg geschwunden war, zum Rückzug nach Mailand entschliessen.
Schweren Herzens taten sie sich nach und nach zusammen, nahmen die Verwundeten auf die Schultern, schafften die eroberten Panner und Geschütze in die Mitte und rückten im Viereck, aufrecht und redlich, nach der Stadt Mailand zurück. Bewundernd sah ihnen der französische König von einer Anhöhe aus nach.
Aber die Feinde griffen die Eidgenossen auf ihrem Rückzuge unablässig von allen Seiten an, doch wurden alle ihre Attacken abgeschlagen. Wie nun die Schweizer an den grossen Graben kamen, über den sie tags vorher so siegessicher gestürmt waren, mussten sie haltmachen, um die Geschütze, die Verwundeten und alles schwere Kriegswerkzeug hinüberzuschaffen. Das benutzten die Feinde. Sie warfen sich nochmals mit aller Macht auf die arg bedrängten Eidgenossen, allen voran die feindliche Reiterei. Da mussten die Schweizer noch eine schwere Blutarbeit verrichten, um sich Luft zu machen und den Ubergang über den Graben zu sichern. Manch ein Held sank ihnen hier noch zusammen. Dem Basler Fähnrich riess eine Kanonenkugel beide Beine weg. Er rutschte auf dem Bauche zurück und reichte sterbend das Panner seiner Stadt den Freunden. Der Fähnrich von Appenzell riss, tödlich verwundet, die Fahne von der Stange und verbarg sie, zusammensinkend, im Panzerhemd. Die Fahne von Unterwalden ging in die Feinde, aber ein schweizerischer Feldkaplan hieb sich durch die Feinde nach ihr und entriss sie ihnen wieder. Die Anführer der Züricher und Berner fielen. Gewaltiges, Unsägliches leisteten die arg bedrängten Eidgenossen. Ein Bündner, der Simson geheissen wegen seiner Kraft, erschlug allein siebzehn auf ihn eindringende Welsche. Also wurden auf dem Rückzuge unzählige Heldentaten verrichtet. Noch einmal hörten die Eidgenossen das furchtbare Brummen des Uristiers, dann aber verstummte er für immer, das Horn ging in dem blutigen Hau verloren.
Endlich kamen die Schweizer blutüberflossen, mit zersetzten Fahnen und Gliedern über den bösen Graben. Jetzt blieben die Welschen, ermüdet und froh, dass sie von dem grausigen Kampfe ausruhen durften, zurück und liessen die Eidgenossen unbehelligt ihren bewundernswerten Rückzug bis in die Stadt Mailand fortsetzen, wo sie gute Aufnahme fanden.
Es war eine gewaltige Schlacht, also dass der alte Feldherr der Welschen, Trivulzio, sagte, diese Schlacht sei eine Riesenschlacht gewesen. Er habe achtzehn Schlachten durchgemacht, aber verglichen mit der Schlacht von Marignano seien alle nur Kinderspiele gewesen.
Das Venediger Männlein.
In alten Zeiten kamen oft wunderliche, dunkelhaarige Leute aus dem Welschland auf die Schweizeralpen gestiegen. Sie suchten im Gefelse und in den Wildbächen nach Gold. Man nannte sie nur die Venediger. Auch sah man sie nicht ungern, denn sie waren manierlich und machten den Älplern manche Kurzweil, indem sie von fremden Ländern und ihrer Stadt im Meere erzählten. Nur das bedünkte die Hirten merkwürdig, dass diese Venediger die Tasche, die sie umgehängt hatten, immer voll Goldsand heimtragen konnten, während sie selber trotz allem Suchen kein Körnchen und kein Stäubchen Gold fanden. Doch sie wussten wohl, dass die Venediger mehr konnten als Roggenbrot essen.
Ein solcher Venediger, ein unscheinbares Männlein, kam nun schier jeden Sommer nach Glarus, dem heutigen ansehnlichen Städtlein, das so wohlgeborgen unter dem dräuenden Glärnisch liegt. Von dort stieg er dann, sobald die Sennen mit ihren Kuhherden aufgefahren waren, auf die Hochalpen, wo er mit den Sennen einträchtiglich die Milch auslöffelte und Käse und Zieger ass und auch bei ihnen auf dem Wildiheulager schlief. Während aber die Sennen das Vieh besorgten und Käse und Butter bereiteten, stieg das Venediger Männlein in den Felsen herum und kroch durch die Bäche und las Steine zusammen, die besonders schön glitzerten. In acht Tagen brachte es sieben Säcke solcher Steine zusammen. Waren nun die sieben Säcke voll, so machte sich der Venediger mit einem Male davon, man wusste nicht recht wie. Aber wenn man ihn noch weit fort glaubte, erschien er schon wieder auf der Alp und begann von neuem Steine in seine sieben Säcke zu sammeln.
Die Hirten sahen das sonderbare Treiben des Männleins giltmirgleich an. Eines Tages jedoch stach sie der Schalk. Sie nahmen dem Venediger Männlein heimlich einen seiner sieben Säcke weg und verbargen ihn, wie sie meinten, so, dass er in aller Ewigkeit unauffindbar war. Wie nun aber das Männlein gegen Abend von seiner Goldsucherei zur Hütte zurückkehrte, fuhr es die vor der Sennhütte gemütlich im Gras herumhockenden und liegenden Älpler an: „Ich hab’s wohl gemerkt, ihr habt mir einen Sack samt den Steinen darin versteckt. Wollt ihr ihn wohl holen, oder soll ich ihn holen?“ Die Hirten lachten und sagten: „Hol ihn nur selber!“ Da lief das Männlein zu ihrer Verwunderung einen gar gähen Absturz hinauf und ganz genau an die Stelle, an der die übermütigen Älpler den Sack verborgen hatten. Zornig brachte es ihn samt den darin klappernden Steinen wieder zur Hütte zurück.
Als auf der Alp der Graswuchs kürzer und die Schatten der Berge länger wurden und schon hie und da ein rauhes Schneelüftchen über die obersten Grate pfiff, verabschiedete sich das Venediger Männlein wieder, wie alljährlich. Doch sprach es diesmal freundlich zu den Hirten: „Ich gehe jetzt wieder nach Venedig. Wenn mich einmal einer von euch dort besucht, so schenke ich ihm einen Sack voll lauter lötiges Silber.“
Kaum war das Männlein von der Alp weg, vergassen die Hirten seine freundliche Einladung. Nur einer, der arm war und im Tale nur ein kleines Gütchen hatte, das, von der Alp aus gesehen, ausschaute wie ein Nastuch, behielt des Venedigers Worte sorglich im Gedächtnis. Einen Sack voll Silber hätte er bei seinem kränklichen Weib und seinen vielen Kindern gut anzuwenden gewusst.
Wie nun die Sennten von den Hochalpen zu Tal gefahren waren und die Lärchen und Ahorn überall rot und gelb standen, machte sich der arme Hirte eines Tages still fort, zog über den stiebenden Steg in der Schöllenen und über den Gotthard, bis er endlich nach langem Marsche ans Meer kam, aus dem er eine Stadt mit vielen Türmen auftauchen sah. Das war aber die Meerstadt Venedig, von der ihm das. Venediger Männlein schon so vieles erzählt hatte.
Als er aber in der grossen Stadt ankam, die nur wenig Strassen hatte, weil sie mitten im Meer auf ein paar Sandinseln gebaut war, wurde ihm doch recht übel zumute, denn er wusste ja weder das Haus noch die Gasse, wo das Venediger Männlein wohnte, ja er kannte nicht einmal seinen Namen. Trübselig und bedrückt, ging er durch eine enge Gasse und dachte schon ans Heimgehen, da klopfte ihm jemand auf die Achsel, und wie er sich umschaute, reichte ihm ein kleiner vornehmer Herr die Hand und hiess ihn freundlich willkommen. Sogleich fragte er auch, wie es denn in Glarus stehe, und wie es den Sennen und den Hirten ergehe, wobei er manchen Älpler mit Namen nannte.
Jetzt machte aber der arme Hirte Augen, als er in dem feingekleideten kleinen Herrn das unscheinbare Venediger Männlein erkannte, das mit ihm und seinen Talgenossen den Sommer auf der Alp zu verleben pflegte. Doch wurde er voll Freude, als ihn der kleine Herr gar freundlich einlud, mit ihm nach Hause zu kommen und darin Quartier zu nehmen. Er staunte über das schöne Haus, in das ihn der Venediger führte, denn es war von lauter Marmelstein und die Wände also glänzend, dass man sich davor hätte rasieren können. Und vor den Fenstern lag eine dunkle Wasserstrasse, und darüber schwangen sich schneeweisse Tauben. Jetzt hatte es der arme Hirte gut, denn es wurde ihm alles aufgetischt, was ihn gut dünkte, und ein Wein, der so dick und so rot war wie Blut, und der ihn zu einer heillosen Kraft brachte.
Aber es dauerte nicht lange, so wollte dem armen Glarner Hirten das Wohlleben nicht mehr recht behagen, obwohl er den ganzen Tag in seinem seidenweichen Bette die Zeit hätte verschlafen können. Seine Gedanken waren nur immer bei Frau und Kindern.
Eines Tages sass er vor des Venedigers schönem Marmelsteinhaus, schaute trübselig drein und dachte an die ferne Heimat. Da trat der Venediger aus dem Haus, und als er ihn so niedergeschlagen und gar Tränen in seinen Augen sah, sagte er freundlich zu ihm: „Mir scheint, du langweilst dich hier in Venedig: Oder hast du etwa gar Heimweh?“ — „So ist’s,“ antwortete der Hirte, „das Heimweh plagt mich, ich weiss mir nicht zu helfen.“
Der Venediger lächelte, führte ihn ins Haus und in ein Gemach, in das er vorher noch nie gekommen war. An der Wand aber hing ein prächtiger Spiegel. „Da schau nun,“ redete der Venediger; „wie’s jetzt im Dorfe Glarus steht!“
Und o Wunder! da sah der Glarner Hirte Glarus so deutlich vor sich, als ob das Dorf gleich hinter der Wand stünde. Ausserhalb desselben aber erblickte er sein Heimwesen und sein Häuschen. Sein Weib sass gerade vor dem niedrigen Tätschhäuschen und wusch ihr Kind, und die Augen standen ihr voll Tränen, weil sie ihres fernen Mannes gedachte.
Da sagte der Venediger zu ihm: „So geh jetzt nur wieder heim! Zehrung gebe ich dir in Gold oder Silber. Willst du lieber Gold, so gebe ich dir’s selber. Wenn du aber Silber willst, so kannst du’s in meiner Schatzkammer holen.“ Drauf sagte der Glarner Hirte: „Ich will nur einen Sack voll Silber, wie Ihr’s zu Glarus auf der Alp versprochen habt.“ Und so ging er denn mit Erlaubnis des Venedigers in dessen Schatzkammer und füllte einen Sack mit Silber.
Wie nun der Hirte aus dem Marmelsteinhaus ging und Abschied nahm, sagte der kleine Venediger noch zu ihm: „Gib ja recht acht auf den Sack, dass er dir auf der Reise nicht wegkommt. Und wenn du in einem Wirtshause übernachtest, so nimm ihn mit dir ins Bett und leg ihn unter den Kopf.“ Der Hirte bedankte sich nochmals für alles, was ihm Gutes getan worden war, machte sich aus der Meerstadt davon und wanderte immerzu, immer höher und höher der Heimat zu.
Als er einen ganzen Tag gelaufen war und die Nacht mit einem Male hereinzubrechen drohte, musste er in einem welschen Dörflein übernachten. Da ward ihm schwer, denn er war noch unendlich weit von der Heimat entfernt, und der Sack, mit dem Silber drückte ihn sehr. Doch suchte er eine Herberge, ging zu Bett und legte den Silbersack unter den Kopf.
Wie machte er aber Augen, als er am Morgen zu Glarus im eigenen Laubbette erwachte und in der Stube die Schwarzwalduhr ticken und vor dem Hause seine Ziegen meckern hörte! Er meinte zuerst, er habe am Ende alles nur geträumt und sei gar nie in Venedig gewesen. Doch da merkte er etwas Hartes unter dem Kopf, und da fand er den Sack gehäuft voll von Silber. Wie eilten seine Frau und seine Kinder herbei und durchs Ofenloch hinauf, als sie den Vater in der Stubenkammer jauchzen hörten! Und wie freute sich die arme Frau des seltenen Kopfkissens in ihres Mannes Laubbett, das einen so silbernen Klang gab, wenn man daran klopfte! Der arme Hirte ward dann ein reicher Mann. Seine Urenkel leben heute noch in Ehre und Ansehen in Glarus. Man heisst sie nur die Venedigerleute.
Das Bergmännlein.
Einst war zu Ernen in Wallis ein alter Mann. Der besa...
Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Kolophon
- Vorwort.
- Erster Abschnitt.
- Zweiter Abschnitt.
- Dritter Abschnitt.
- Vierter Abschnitt.
- Fünfter Abschnitt.
- Über Schweizer Sagen und Heldengeschichten
- Anmerkungen