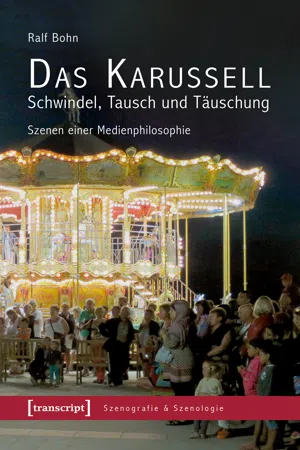
- 400 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Das Karussell ist eine Maschine, in der die Tauschparameter von Sinn und Sinnlichkeit im szenischen Arrangement erprobt werden. Ab dem 19. Jahrhundert wird der Auszug wissenschaftlich-medialer Schwindelmaschinen aus den Laboren der Psychophysik Teil einer psychischen Festkultur, die sich von der physisch orientierten Kirmeswelt absetzt. Ralf Bohn liest Medienszenen des Karussells in Literatur, Film, Architektur, Fotografie und Malerei als Illustrationen von physischem Schwindel, ökonomischem Tausch und medialer Täuschung. Damit zeigt er auf, wie durch Spielorte legitimierter Überschreitung die Tauschökonomie jenseits von Moral und diesseits pathologischer Abgründe ausgetestet wird.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Das Karussell – Schwindel, Tausch und Täuschung von Ralf Bohn im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Stadtplanung & Landschaftsgestaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
II. TEIL: DAS KARUSSELL IM KONTEXT VON MEDIENINSZENIERUNGEN
14.WALTER BENJAMIN: KARUSSELLFAHRENDES KIND – EIN DENKBILD
Die erste Vorstellung der drei Repräsentationen des Schwindels – Schwerelosigkeit, Fliehkraft, instabile Raumorientierung – durch die naiv-infantile Konstruktion des Karussells liefert uns Walter Benjamin, geboren in Berlin 1892, in einem seiner kurzen Denkbilder, die er unter dem Titel KARUSSELLFAHRENDES KIND in der EINBAHNSTRASSE 1928 veröffentlicht hat. Am Denkbild lässt sich eine erste, sehr bildhafte, zugleich aber in Nähe und Ferne dynamisierte Phänomenologie des Karussells entfalten. Dabei soll unterschieden werden, dass wir es bei den Effekten des Karussells nicht zuerst mit den sichtbaren Attraktionen, sondern mit Fühlbarkeiten zu tun haben, die sich der Fremdbeobachtung entziehen – und die ich bislang aus der Distanz meines fotografischen Fetischismus vermittelt habe, um mich eines Körperopfers zu entziehen. Wie das Kind gehorche ich nicht der ökonomischen Zirkulation von Opfer und Gabe, sondern (als Tourist und Urlauber) der Lust. Für Kinder zählt nicht der im Foto erschwindelte Schein medialer Ruhe, sondern die Ekzentrizität des Schwindelgefühls. In dialektischer Weise stehen sich Gefährt und Besitz, Taumel und Ruhe gegenüber.
Sieht man eines der alten Karussells, so Benjamins Darstellung, legen sich die Erinnerungen der Kindheit gleich einem Dunst über die Ebene der Zeichen. Es soll nicht vergessen sein, dass die Karussellpferdchen um 1900 noch auf den authentischen Ritt zu Pferde oder in einer Kutsche vorbereiten konnten. Benjamins Perspektive ist die eines Erwachsenen, der auf seine großbürgerliche Kindheitserfahrung mit und auf dem Karussell zurückblickt und versucht, dem Wert und der Wahrheit von Erfahrung sich anzunähern. Denn Erfahrung ist ein Phänomen der Wiederholung, des Abstandes, der Einübung, und nicht des Schocks von Einmaligkeit.
Wie lässt die Erfahrung des Karussells sich in seinen verschiedenen Annäherungsetappen beschreiben? In erster Linie wohl – dem Vorschlag von Nietzsche folgend und den Gesamtkunstwerken Wagners entsprechend – durch eine ökonomische Balance differentieller Sinneseindrücke (Hören und Sehen) und der theatralischen Bewegungen der Bühnenpersonen. So wird die Trance der emotional fließenden Motivik der Musik Wagners allein durch Bühne und Schauspiel – Sichtbarkeiten – im Zaum gehalten, die sich mit geduldiger Langsamkeit vollziehen. Entsprechend erfüllt sich die Erfahrung des Karussells nicht unmittelbar durch eine Fahrt, sondern in der Erinnerung, die sie als bleibender Wert einer audiovisuellen Körpererfahrung hinterlässt – in der Synthesis der Sinne und somit als Erfahrung. Benjamin reflektiert diese Synthesis – den Kreislauf von Erinnerungsvorstellung und Realattraktion – in einer Verschiebung 30 Jahre später eben als Denkbild. Der Perspektivismus von „Nähe“ und „Ferne“ ist kein optischer wie in der Fotografie, sondern ein lebensgeschichtlicher, der voraussetzt, dass sich Wirklichkeit in der Kindheit nicht vollständig erfüllt hat. Das Denkbild markiert neben der Synthese dialektisch die Differenz von Repräsentation und Präsentation.
Die Erinnerung Benjamins an das Karussell seiner Kindheit ist einerseits mit dem Index der Vergangenheit belastet, andererseits ist die Erinnerung selbst als Andenken gegenwärtig. Benjamin, den man schon sehr früh „den Alten“ nannte, bezieht sich auf dieses gegenwärtige Andenken, d.h. eine mentale Wiederkehr, eine Gabe, die sich nur mit einer Verzögerung, einer Kreditierung von Zeit ergibt. Wir haben es mit einem positiven Aspekt von Vergänglichkeit, der verspäteten Erfüllung der Ereignisse der Kindheit im Modus von Rückerfahrung zu tun. Was daran auratisch ist, wie er später in seiner Analyse der fotografischen Aura feststellt, ist die biografische Wirkung. Der Todessog des Alterns wird gleichsam durch den Wert der Erfüllung der vorhergehenden Präsenz als Erinnerung kompensiert. Denn die Präsenz ist das, was als Gegenwärtiges im Ereignis selbst der Reflexion entgeht. Die Wiederkehr oder Wiederkunft ist in funktionaler Analogie zur sich wiederholenden Kreisbewegung des Karussells gedacht, erwirkt jedoch einen Mehrwert. Erinnerung im dialektischen Denkbild ist das entgegenkommen von Bruchstücken, die sich in der Erinnerung zum Bild der Vergangenheit komplettiert und in höherer Synthese aufgehoben ist. Das Karussell erweckt oft einen seligen Augenblick voller Nostalgie und Kindheitserfahrung.
Der Bezugspunkt ist folgender: Benjamin beschreibt das Erlebnis einer einzigen Karussellfahrt in seinen Phasen als Ablösung, Reise und Rückkehr des Kindes zur Mutter, zugleich dienen ihm die Etappen des Erlebnisses auf einer sekundären Ebene zur Illustration des Lebensweges. Alles unmittelbar Erlebte erfüllt sich erst in der Wiederkunft. Von daher ist die erste Präsenz „Kindheit“ von der zweiten „Denkbild und Gedenken des Erwachsenen“ zu unterscheiden.
Dieser Unterschied ist deswegen bemerkenswert, weil es vom Denkbild KARUSSELLFAHRENDES KIND (bzw. DAS KARUSSELL) zwei Fassungen gibt: eine in der Zeitform des grammatikalischen Präsens, eine andere – mit wenigen Variationen – im Imperfekt. Die zweite Fassung ist in der Sammlung BERLINER KINDHEIT UM NEUNZEHNHUNDERT erst nach Benjamins Tod veröffentlicht worden, geschrieben 1932–34; und eine letzte Fassung stammt von 1938 – die Editionsgeschichte ist, wie bei Benjamin nicht unüblich, verwickelt. Ich will vorwegnehmen, dass Rilke unter der gleichen physiologischen und sprachlichen Differenzierung eine ganz andere Akzentuierung ableiten wird, nämlich eine solche der temporalen Autonomie der Vergegenwärtigung dichterischer Sprache. Gerade der Umstand, dass die Differenz der Zeiten bei Benjamin produktiv wird, dass das Altern positiv aufgefasst wird, macht den eigentlichen Reiz des Perspektivismus Benjamins aus. Benjamins durchaus streng literarisierte Sprachform ist der kritischen Erkenntnis der Zeitvorstellung von Erinnerung gewidmet, nicht der Repräsentation eines Ereignisses oder Sachverhalts. Werden bzw. Zeit sind also evolutiv aufgefasst. Statt einer topologischen behandelt Benjamin eine chronologische Verschiebung. Dadurch bekommt die Fahrt auf dem Karussell einen ganz anderen metaphorischen Ort: den eines Lebensrades. Das Karussell ist kein Gegenstand der Erinnerung, sondern die Erinnerung wird anlässlich des Karussells zum Gegenstand.
Diese orientierende Vorrede soll genügen, um uns für das erste Problem zu sensibilisieren, das ein solch unbedeutender, wenn auch attraktiver Ort wie das Karussell eröffnen könnte, würde man ihm nicht bloß die effektive Verwertung eines spontanen Ungleichgewichtsbedürfnisses zu Zwecken des seelischen Gleichgewichts unterstellen. Es ist gewiss, dass das Kind in seiner vom Wunsch getriebenen Begierde die Realisierung des Ritts durch den Wald der Phantasie als Verlust und Rückaneignung seiner selbst im Spiel erlebt, also als Beginn seiner Subjektivitätsbehauptung. Aber es macht auch spontan die Erfahrung der Distanz und des Verlustes, indem es nach vollzogenem Ritt begeistert das „Noch einmal“ erbettelt. Lust ist hier noch nicht Korrelat des Opfergesetzes. Der Wunsch, der einem zustößt, lässt sich nicht beherrschen. Das ist der Mutter zu zeigen, die aufmerksam dem Rollenspiel folgt und vorher die kleine Münze entrichtet. Hier jetzt Benjamins Denkbild aus der EINBAHNSTRASSE.
KARUSSELLFAHRENDES KIND
Das Brett mit den dienstbaren Tieren rollt dicht überm Boden. Es hat die Höhe, in der man am besten zu fliegen träumt. Musik setzt ein, und ruckweis rollt das Kind von seiner Mutter fort. Erst hat es Angst, die Mutter zu verlassen. Dann aber merkt es, wie es selber treu ist. Es thront als treuer Herrscher über einer Welt, die ihm gehört. In der Tangente bilden Bäume und Eingeborene Spalier. Da taucht, in einem Orient, wiederum die Mutter auf. Danach tritt aus dem Urwald ein Wipfel, wie ihn das Kind schon vor Jahrtausenden, wie es ihn eben erst im Karussell gesehen hat. Sein Tier ist ihm zugetan: Wie ein stummer Arion fährt es auf seinem stummen Fisch dahin, ein hölzerner Stier-Zeus entführt es als makellose Europa. Längst ist die ewige Wiederkehr aller Dinge Kinderweisheit geworden und das Leben ein uralter Rausch der Herrschaft mit dem dröhnenden Orchestrion in der Mitte als Kronschatz. Spielt es langsamer, fängt der Raum an zu stottern und die Bäume beginnen sich zu besinnen. Das Karussell wird unsicherer Grund. Und die Mutter taucht auf, der vielfach gerammte Pfahl, um den das landende Kind das Tau seiner Blicke wickelt.112
Das Brett mit den dienstbaren Tieren rollt dicht überm Boden. Es hat die Höhe, in der man am besten zu fliegen träumt. Musik setzt ein, und ruckweis rollt das Kind von seiner Mutter fort. Erst hat es Angst, die Mutter zu verlassen. Dann aber merkt es, wie es selber treu ist. Es thront als treuer Herrscher über einer Welt, die ihm gehört. In der Tangente bilden Bäume und Eingeborene Spalier. Da taucht, in einem Orient, wiederum die Mutter auf. Danach tritt aus dem Urwald ein Wipfel, wie ihn das Kind schon vor Jahrtausenden, wie es ihn eben erst im Karussell gesehen hat. Sein Tier ist ihm zugetan: Wie ein stummer Arion fährt es auf seinem stummen Fisch dahin, ein hölzerner Stier-Zeus entführt es als makellose Europa. Längst ist die ewige Wiederkehr aller Dinge Kinderweisheit geworden und das Leben ein uralter Rausch der Herrschaft mit dem dröhnenden Orchestrion in der Mitte als Kronschatz. Spielt es langsamer, fängt der Raum an zu stottern und die Bäume beginnen sich zu besinnen. Das Karussell wird unsicherer Grund. Und die Mutter taucht auf, der vielfach gerammte Pfahl, um den das landende Kind das Tau seiner Blicke wickelt.112
Auffällig, dass Benjamin seine Darstellung der Episode einer Karussellfahrt weniger im historischen Rahmen des Karussells als in dem einer durch die griechische Mythologie vermittelten Kulturgeschichte Europas darstellt. Dabei verbinden sich historische, mythische und eben aktuelle Zeiterfahrungen, nicht aber solche, die durch die Schwindelerfahrung sich einstellen mögen. In dieser Hinsicht ist das Denkbild ein Bild, vielleicht schon jenem kleinen „ruckweise“ angetriebenen Lebensrad nachgebildet, wie sie in Benjamins Kinderzeit um 1900 als Wundertrommeln aller Art Vorläufer des Films waren. Es sind Spielzeugmechaniken, die ein sehr rudimentäres Bewegtbilderlebnis liefern und die schon um 1825 mit dem Thaumatrop den Stroboskopeffekt in die Kinderzimmer und Kabinette trugen. Vom Schwindel wird nicht gesprochen. Ist das Karussell zu langsam? Oder sorgt die ruckweise Wendung des Blicks zur Mutter für jenen Gleichgewichtseffekt, den Eiskunstläuferinnen beherrschen, um ihre Pirouetten zu überstehen?
Keine Physiologie, aber eine musikalisch-liedhafte Rhapsodie des Orchestrions sorgt dafür, dass der ganze Platz und nicht nur das Karussell von einem dezenten Rausch befallen wird. Aus dem Diesseits hallt der Ruf Benjamins nach der Möglichkeit, die Dinge so neu wie zum ersten Male, nämlich phantastisch statt in der Disziplin von Erinnerung erfahren zu können. Das geht nur um den Preis des Vergessens und Wiedererinnerns. Mit dem Vergessen würde die Versicherung der mütterlichen Stabilität, dieser „gerammte Pfahl“ der Geburt, ebenfalls verloren gehen. Der Blick der Mutter: Wird sie hier von Benjamin als Zuschauerin, Betrachterin oder Beobachterin gesehen – oder denkt sie gar über ihre eigene Kindheit nach? Wenn das Vergessen ein Rausch ist, dann ist die Erinnerung seine Grenze. Mit der Mutter verbindet sich die Idee von der ewigen Wiederkehr, die der Erinnerung. Vom anderen Pfahl, der Mittelachse des Karussells, die die Bewegung zentrifugal entlässt, ist nicht die Rede. Gerade hier, im Mittelpunkt des Weltgetriebes, dröhnt das Orchestrion als paternales Götterhaupt. Im Zentrum thront die Fiktion einer selbstgewissen Stimme, die das infantile Subjekt lenkt und in die hinein die strudelnden Bilder sich auflösen wollen. Ganz im dionysischen Singsang zu verschwinden, heißt, das Schlaflied der Mutter weiter zu träumen. Sound und Bildertaumel werden beinahe rückstandslos indifferent. Das Karussell gibt einen maschinellen Weg vor, den Sinnenschwindel im Körperschwindel aufzulösen. Es vermittelt wie der Traum zwischen Schlaf und Wachen, Schwindel und Gleichgewicht. Nur nach dieser rauschhaften Entleerung trennen sich die Stasen der Zeit: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Es ist ja doch auffällig, dass Musik einen ungerichteten Raum erfüllt, sodass man sie in den Engen der Gassen zwar hört, ihre Herkunft aber nicht orientiert. Der topografische Raum löst sich in einen atmosphärischen auf. Seine Gleichrichtung durch das mit sinnlicher Überfülle ausgestattete Karussell diszipliniert diesen Raum in einer Art Vorspiel, sodass die Kinder zuerst die Angst der Trennung, dann der Mut anfällt, die Abenteuerreise auf sich zu nehmen. Diese Reise geht nicht von der Mutter zum Vater, sondern von der realen zur medialen Mutter. Denn der Vater – das Zentrum der Bewegung – schleudert die Kleinen von sich weg.
Die gesamte Inszenierung organisiert sich in mehreren realen und virtuellen topologischen Verschiebungen, die erfahrbar machen, warum der sinnlich orientierte Leib ausgreifender ist als der Körper. Zwar wird hier immer wieder die Metapher des Blicks gebraucht – das „Tau seiner Blicke“ –, aber die ist nicht visuell reduziert. Blick heißt: Orientierung des Leibes als Differenz zum Anderen. Verräumlichung ist eben auch Leibhaftigkeit. Die Grenzen meines Körpers sind nicht die...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Editorial
- Titelseite
- Inhalt
- I. TEIL: PARAMETER EINER ÖKOLOGIE DES SCHWINDELS
- II. TEIL: DAS KARUSSELL IM KONTEXT VON MEDIENINSZENIERUNGEN
- III. TEIL: VOM UNAUSLOTBAREN GRUND IN FEST UND SCHWINDEL
- Quellenverzeichnis