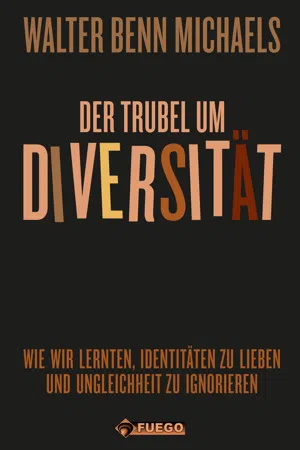![]()
1
Das Problem mit der »Rasse«
Zwei Geschichten: eine vom Ende des neunzehnten, die andere vom Ende des zwanzigsten Jahrhunderts. Zuerst die aus dem neunzehnten: 1892 steigt ein junger Mann in einen Zug von New Orleans nach Covington in Louisiana. Da in diesem Bundesstaat soeben die Rassentrennung in Zügen eingeführt worden ist, kann er sich entweder in einen für Weiße reservierten Wagen oder in einen mit der Aufschrift »Farbige« setzen. Obwohl er sehr hellhäutig ist (nämlich nur zu einem Achtel schwarz, wie sein Anwalt später behauptet, die »Beimischung farbigen Blutes« sei nicht »erkennbar«), wird er, sobald er den Wagen für Weiße betritt, als schwarz identifiziert, und der Schaffner bittet ihn, den Wagen zu verlassen. Als er sich weigert, wird er verhaftet. Da es ihm darum geht, die Politik der Rassentrennung für illegal erklären zu lassen, bittet er um eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof des Staates Louisiana, und nachdem er seinen Fall dort verloren hat, zieht er vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, wo sein Anwalt erklärt, der Staat habe kein Recht, »einen Bürger als weiß und einen anderen als farbig zu kennzeichnen«, die Entscheidung des Schaffners, ihn als schwarz zu kennzeichnen, sei »willkürlich« gewesen.46 Doch er verliert abermals. Es gebe »physische Unterschiede« zwischen Weißen und Schwarzen, stellt das Gericht im Jahr 1896 fest, und sie hätten unterschiedliche »Rasseninstinkte«, die dem Staat Louisiana das Recht gäben, von Weißen und Schwarzen zu verlangen, in unterschiedlichen Wagen zu reisen. Dem Einwand des Richters John Harlan zum Trotz (»Unsere Verfassung ist farbenblind…«) setzt die Entscheidung im Fall Plessy gegen Ferguson die mehr als ein halbes Jahrhundert geltenden Jim-Crow-Gesetze47 in Kraft, denen zufolge Schulen, Krankenhäuser, Wasserspender und schlechthin alles nach »Rassen« getrennt wird.
Nun die Geschichte aus dem zwanzigsten Jahrhundert: 1977 beantragt eine Frau aus Louisiana namens Susie Guillory Phipps (die nie so berühmt wurde wie Homer Plessy, jedoch für Historiker des Rassismus von Bedeutung ist) einen Pass und wendet sich an das Standesamt, um eine Kopie ihrer Geburtsurkunde zu erhalten. 1977 liegen die Dinge um einiges anders als 1896. Die Rassentrennung ist nun ungesetzlich. Niemand, nicht einmal ein Gericht in Louisiana, hat mehr darüber zu entscheiden, ob eine Frau schwarz oder weiß ist, und niemand glaubt mehr an Susie Phipps’ »Rasseninstinkte«; vielmehr erklärt das Gericht die ganze Idee, Individuen solcherart zu klassifizieren, für »wissenschaftlich unhaltbar«. Und die »physischen Unterschiede«, die bereits im Fall Plessy einigermaßen dürftig erschienen (man erinnere sich, dass Homer Plessys »farbiges Blut« nicht erkennbar gewesen sei), sind in diesem Fall aberwitzig unsichtbar. Die hellhäutige und blonde Susie Phipps lebt seit dreiundvierzig Jahren als eine weiße Frau. Ehe die vom Standesamt ausgestellte Geburtsurkunde ihr bescheinigt, eine »Farbige« zu sein, hat ihr das nie jemand gesagt. Als das Standesamt sich weigert, die Geburtsurkunde zu ändern, zieht sie wie Homer Plessy vor Gericht. Und auch sie verliert.48
Dass Phipps nicht so berühmt ist wie Plessy, liegt natürlich daran, dass das gesamte gesellschaftliche System – genannt Jim Crow – in ihrem Fall nicht mehr besteht. Doch etwas Entscheidendes, darum erzähle ich diese beiden Geschichten hier, gilt nach wie vor: nicht der Fortbestand der Rassentrennung, wohl aber der der »Rasse« selbst, die Überzeugung nämlich, wir könnten unterschiedliche Arten von Menschen ausmachen, indem wir sie Rassen zuordnen. Homer Plessy sah aus wie die anderen Menschen in dem ausschließlich Weißen vorbehaltenen Wagen, und dennoch wurde er als Schwarzer identifiziert; ja, um verhaftet zu werden und das neue Gesetz als verfassungswidrig anklagen zu können, musste er sich sogar selbst als solcher identifizieren. Wie sonst hätte der Schaffner wissen können, dass er ihn zu verhaften habe? Susie Phipps hingegen wurde von niemandem – sie selbst eingeschlossen – als schwarze Frau identifiziert, und doch stellte sich heraus, dass auch sie schwarz war. Warum ist Phipps schwarz? Was bedeutet »Rasse«, wenn man zu einer gehören soll, ohne so auszusehen, ohne sich so zu fühlen und sogar ohne es zu wissen?
In einer von Amts wegen rassistischen Gesellschaft wie der, in der Homer Plessy lebte, war diese Frage offensichtlich von Bedeutung: Man kann Schwarze nicht ausschließen, ohne zu wissen, welche Menschen schwarz sind. In unserer Gesellschaft, die sich rühmt, solche Unterschiede nicht zu verachten, sondern zu würdigen, ist sie allerdings ebenso wichtig: Man kann Schwarz nicht gutheißen, wenn man es nicht definieren kann. Die jüngste Geschichte der Rassenforschung hat indes Zweifel geweckt, ob man das definieren kann, und die von Menschen wie Plessy und Phipps aufgeworfene Frage, warum sie einer schwarzen Rasse angehören, allgemeiner gestellt: Gibt es überhaupt etwas wie Rassen? Während diese Frage möglicherweise peinlich ist (denn wenn es keine gibt, welche Unterschiede respektieren wir dann?), wurde die Schwierigkeit, »Rasse« dingfest zu machen, auf mancherlei Weise gelöst, um die zentrale Bedeutung dieser Kategorie aufrechtzuerhalten. Indem sie von einem biologischen in ein soziales Faktum umgedeutet wurde, verwandelte sich die Vielfalt der »Rassen« in eine kulturelle, und es hat sich gezeigt, dass eine Welt kultureller (statt ökonomischer, politischer oder selbst religiöser) Unterschiede vielen höchst attraktiv erscheint. Aus dieser Perspektive kann man sogar sagen, dass der Begriff der Rasse, je unfasslicher er wurde, sich desto besser als Modell im Umgang mit allen möglichen Unterschieden eignete.
Was die Vorstellung von »Rasse« in Amerika betrifft, war es daher von entscheidender Bedeutung, dass die »physischen Unterschiede«, auf die das Gericht im Fall Plessy anspielte, von vornherein gewissermaßen immateriell waren, was bedeutet, dass sie zwar üblicherweise sichtbar waren, das aber nicht unbedingt sein mussten. Hemingway mochte sich lustig machen über die Vorstellung, die Reichen gehörten einer anderen Rasse an, doch hatte auch er eine mehr oder minder orthodoxe Auffassung davon, wer welcher Rasse angehöre und woher man das wissen könne. In »Fiesta« bekommt Robert Cohen in seinem Boxkampf in Princeton seine Nase »plattgemacht«, und zwar eine, wie der Leser weiß, eigentümlich jüdische Nase, und wenn Jake Barnes sagt, sie sei dadurch »verbessert« worden, weiß man, dass Robert Cohen nach dem Boxkampf etwas weniger jüdisch aussieht als zuvor. Aber man weiß auch, dass er noch immer jüdisch ist und dass – »komisch, Sie sehen gar nicht jüdisch aus« – jüdisch aussehen und jüdisch sein zweierlei Dinge sind. Wie wir gesehen haben, wird auch der Unterschied zwischen »Rassen« voll und ganz nach dem Aussehen bestimmt. Wenn jedoch der Unterschied zwischen Menschen in einem gegebenen Fall als vollkommen sichtbar beschrieben wird, wie eben der Unterschied der Hautfarbe, kann das Aussehen trügen. Die Tatsache, dass jemandes Haut weiß ist, macht ihn nicht zu einem Weißen, ebensowenig bedeutet die Tatsache, dass ihre Nase nicht jüdisch aussieht, dass eine Person nicht jüdisch ist. In den 1930er Jahren hat der (schwarze) Schriftsteller George Schuyler ein sehr komisches Buch mit dem Titel »Nicht mehr schwarz« (Black No More, 1931) geschrieben, in dem er ein Verfahren schildert, das schwarze Haut in weiße verwandeln kann. Die »Rasse« aber war somit nicht verschwunden, sie war bloß schwieriger auszumachen. Es mag Gesellschaften geben, in denen das Aussehen tatsächlich die »Rasse« bestimmt. Von Brasilien zum Beispiel wird häufig gesagt, dass dort Kinder unterschiedlicher Hautfarbe (das eine hell, das andere dunkel), auch wenn sie dieselben Eltern haben, unterschiedlichen »Rassen« angehören können. Doch so funktioniert das Konzept nicht in den Vereinigten Staaten.
Hier ist die Hautfarbe nur ein Anzeichen von »Rasse« (das oft zuverlässig ist, manchmal aber auch nicht), und zwei Kinder derselben Eltern, wie unterschiedlich deren Hautfarbe auch sei, gehören immer derselben an. In Amerika war »Rasse« stets etwas Innerliches. Was Homer Plessy und Susie Phipps schwarz machte, war nicht ihre schwarze Haut (die sie nicht hatten), sondern ihr schwarzes Blut. Nur, dass Homer Plessys Blut zum größten Teil natürlich nicht schwarz war. In Louisiana hätte man ihn im Jahr 1896 einen »Achtelschwarzen« genannt, weil ein Teil seiner Urgroßeltern schwarz gewesen war. Und Susie Phipps, so stellte sich heraus, war sogar noch weniger schwarz als Plessy: Ihr schwarzes Blut stammte nicht von Urgroßeltern, sondern von Ur-Ur-Urgroßeltern. Doch das reichte aus. In Amerika galt allgemein die Regel, dass ein Tropfen schwarzen Blutes eine Person schwarz macht, und da es nur eine Ein-Tropfen-Regel geben kann (denn wenn man sagte, ein Tropfen schwarzen Blutes mache einen schwarz und ein Tropfen etwa asiatischen Blutes mache einen asiatisch, was wäre dann jemand, der sowohl schwarz als auch asiatisch ist?), führte diese Regel schließlich dazu, die gesamte amerikanische Bevölkerung in zwei Kategorien zu teilen: schwarz und nicht-schwarz.
Das verhinderte jedoch nicht, dass diese Kategorien manchmal ein wenig grob wirkten und man feinere Unterscheidungen treffen musste. Das taten auch Hemingway und Fitzgerald in den 1920er Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine weitverbreitete Hysterie über die noch weithin unkontrollierte Einwanderung aus Osteuropa in die Vereinigten Staaten, und höchst angesehene Leute schrieben Bücher wie »Die steigende Flut der Farbigen gegen die weiße Weltherrschaft« (The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy, 1920) und »Das Aussterben der großartigen Rasse« (The Passing of the Great Race, 1916). Die »Rasse«, um die es ging, bestand nicht einfach nur aus weißen, sondern aus »nordischen« Menschen: den allerbesten Weißen. Der Erste Weltkrieg, den sie den »weißen Bürgerkrieg« nannten, war eine Katastrophe für die Nordischen. Während all die blonden, blauäugigen Menschen auf beiden Seiten sich an Orten wie Verdun tapfer abgeschlachtet hatten, lauerten die dunkleren Typen – »Alpine« (nicht schlecht, doch nicht so gut wie Nordische) und »Mediterrane« (kaum besser als Juden) – im Hintergrund und warteten nur darauf, dass der Rauch sich verzieht. Und als es soweit war, standen sie glücklich da. Vom »Zuchtstandpunkt« aus, schrieb Madison Grant (nicht nur Verfasser rassistischer Traktate, sondern auch Mitglied des Stiftungsrats des Naturhistorischen Museums in New York und ein guter Freund der Präsidenten von Teddy Roosevelt bis Herbert Hoover), seien die wahren Gewinner des Krieges nicht die Briten und Amerikaner, sondern »der kleine dunkle Mann«, der nun die Mädchen abbekomme.49 Das heißt, er konnte sich mit all den nordischen Mädchen paaren, die der Krieg der Möglichkeit beraubt hatte, sich mit gebührend edlen nordischen Jungs zu paaren (die ihres Edelmuts wegen nun tot waren). Die wachsende Bedrohung glaubte man in einer »Bastardisierung« Amerikas zu erkennen, und das Einwanderungsgesetz von 1924 (das »Gesetz des nationalen Ursprungs« genannt, weil es Einwanderungsquoten nach dem Herkunftsland festlegte, wobei Schweden gut abschnitt) war eine maßgebliche Reaktion auf diese Bedrohung.
Männer wie Grant sorgten sich nicht so sehr um Schwarze, die ihnen noch minderwertiger als Juden und zugleich weniger bedrohlich als diese erschienen. Wenn auch die Schwarzen in der »Rassenskala« ganz unten standen, war allerdings ihr Blut auf seine Art das stärkste, denn im Falle einer Mischung, so wurde allgemein angenommen, genügte bloß ein Tropfen schwarzen Blutes, ungeachtet aller anderen Tropfen, um jemanden schwarz zu machen. Wegen der Ein-Tropfen-Regel verschwand die Kategorie des »Mulatten« seit 1920 aus dem Zensus. Selbst heute, da diese Kategorie auf den Zensusformularen vor kurzem wieder aufgetaucht ist, fällt es schwer, nur teilweise schwarz zu sein. Als zum Beispiel der Golfspieler Tiger Woods, der sich selbst als teils afroamerikanisch, teils asiatisch, teils indigen-amerikanisch, teils weiß beschreibt, anfing, sich »Cablinasian«50 zu nennen, waren viele Schwarze entsetzt, dass er es unterließ, sich als Schwarzer zu erkennen zu geben, und bald darauf gab Tiger Woods nach. Wenn nämlich die Ein-Tropfen-Regel Amerika in zwei Gruppen teilt – schwarz und nicht-schwarz –, so bedeutete nicht-schwarz in der amerikanischen Geschichte letztlich weiß. Jimmy Gatz mag nicht weiß genug gewesen sein für Tom Buchanan, doch seine Söhne wären allemal weiß genug gewesen für Tom Buchanans Töchter. Darum gibt es haufenweise Bücher wie »Wie die Iren weiß wurden« und »Wie die Juden weiß wurden« (und darum sollte nun endlich auch mal jemand »Wie die Asiaten weiß wurden« schreiben). Als Tiger Woods sich nicht mehr als schwarz bezeichnen wollte, bekamen Schwarze den Eindruck, er betrachte sich – so die allein in Betracht kommende Option – als weiß. Trotz gelegentlicher Irritationen durch die oben erwähnten innerweißen Unterschiede diente das rassistische System in Amerika im wesentlichen der Hervorbringung einer einheitlichen »Rasse« sowohl der Weißen von Killarney bis Wilna als auch der Schwarzen, deren Hautfarbe von Ebenholz bis Elfenbein (wie die von Susie Phipps) reicht.
Worin aber besteht diese Einheit? In welcher Hinsicht sind Menschen, die diesen einen Tropfen haben, einander grundsätzlich ähnlich und Menschen, die ihn nicht haben, grundsätzlich verschieden von denen, die ihn haben? Heutzutage reden wir nicht mehr soviel über Blut, sondern über Gene, und wir sind in der Lage, die Abstammung eines Menschen mit einer Genauigkeit zurückzuverfolgen, die selbst die leidenschaftlichsten Anhänger physischer Unterschiede aus dem neunzehnten Jahrhundert verblüfft hätte. Doch hätte es sie ebenso enttäuscht, denn es stellte sich zugleich heraus, dass die meisten Wissenschaftler, je mehr sie über genetische Erbanlangen wissen, die Vorstellung von Rassen desto skeptischer beurteilen. Tatsächlich ist die heute vorherrschende wissenschaftliche Ansicht, dass »Rasse« ein »Mythos« ist. In den Worten R.C. Lewontins hat sie, »wenn auch nicht als soziales, so doch als biologisches Konstrukt ausgedient, da es in Wirklichkeit nichts dergleichen gibt, was die menschliche Gattung grundlegend prägt.«51
Der Grund dafür ist natürlich nicht, dass es keine physischen Unterschiede zwischen Menschen gäbe. Offenkundig haben Menschen unterschiedliche Hautfarben und unterschiedliches Haar, und wir alle haben Vorfahren, die von unterschiedlichen Orten oder zu unterschiedlichen Zeiten aus Afrika kamen. Das Problem besteht darin, dass die genetische Abweichung innerhalb von Bevölkerungsgruppen, die der vermeintlich selben Rasse angehören, oftmals größer ist als die zwischen den Rassen. »Ein Mensch aus dem Kongo und einer aus Mali«, sagt Joseph Graves, »unterscheiden sich genetisch wahrscheinlich stärker voneinander als von einem Menschen aus Belgien.«52 Folglich ergibt es genetisch keinen Sinn, Menschen aus dem Kongo und aus Mali als ein und derselben Rasse zugehörig zu begreifen und die aus Belgien einer anderen zuzuordnen. Einerseits, heißt das, gibt es Menschen, deren Vorfahren aus Belgien, solche, deren Vorfahren aus Mali, und solche, deren Vorfahren aus Thailand kommen; andererseits aber gibt es, zumindest vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, weder eine weiße noch eine schwarze, noch eine asiatische Rasse. Man sollte also nicht glauben, es gäbe keine »physischen Unterschiede« (in diesem Sinne hatte das Gericht im Fall Plessy recht); nur gibt es keine physischen Unterschiede zwischen Rassen.
Jüngste Entdeckungen über eine scheinbare Verbindung zwischen »Rasse« und Krankheit führen einem das schön vor Augen. Viele Jahre lang wurde, zumindest in den Vereinigten Staaten, Anämie, eine Bluterkrankung, üblicherweise mit Schwarzen in Verbindung gebracht. Es stellte sich jedoch heraus, dass wir zwischen Schwarzen und Weißen (zwischen schwarzem und weißem Blut) nicht wirklich unterscheiden können, wenn wir den genetischen Zusammenhang mit den Sichelzellen betrachten. Zum einen gibt es einen solchen Zusammenhang nicht bei allen Menschen, die wir schwarz nennen, da er typischerweise nur bei Menschen vorkommt, deren Vorfahren einst in bestimmten Teilen West- und Zentralafrikas gelebt haben, keineswegs jedoch bei Schwarzen, deren afrikanische Vorfahren anderswoher kommen. Zum andern gibt es Menschen, die wir für weiß halten (z.B. Teile der griechischen Bevölkerung), bei denen ein solcher Zusammenhang nachweisbar ist. Der entscheidende Faktor ist anscheinend die Abstammung von Menschen, die einmal in einer Gegend gelebt haben, in der Malaria grassierte, denn die Sichelzelle besitzt Eigenschaften, die zum Schutz vor Malaria ausgebildet wurden. Demnach sollte man, wie Adolph Reed treffend meint, in einem Land, in dem zum großen Teil Weiße aus dem Mittelmeerraum und Schwarze aus dem südlichen Afrika leben, die Sichelzellenkrankheit als eine weiße Krankheit begreifen.53
Das gleiche kann man aus entgegengesetztem Blickwinkel über andere Gruppen sagen. Das Tay-Sachs-Syndrom ist angeblich eine jüdische Krankheit, doch unter den Juden sind es nur die Aschkenasim (aus Osteuropa), die häufig davon betroffen sind, während zu den häufigen Trägern auch nichtjüdische Bevölkerungsgruppen gehören wie die Frankokanadier aus der Gegend am Sankt-Lorenz-Strom. In einem Land, dessen Bevölkerung aus Frankokanadiern und sephardischen statt aschkenasischen Juden besteht, würde man das Tay-Sachs-Syndrom am treffendsten nicht als eine Krankheit beschreiben, die Juden bekommen, sondern als eine, die Juden nicht bekommen. Stellen wir uns, um es noch deutlicher zu machen, ein von Aschkenasim, Sephardim und Frankokanadiern bevölkertes Land vor. Wenn wir in einem solchen Land die statistische Wahrscheinlichkeit, mit der jemand das entsprechende Gen trägt, als Indiz eines Rassenunterschieds nähmen, hätte die Frage, welcher Rasse jemand angehört, mit der, ob er jüdisch ist, gar nichts zu tun. Herkömmli...