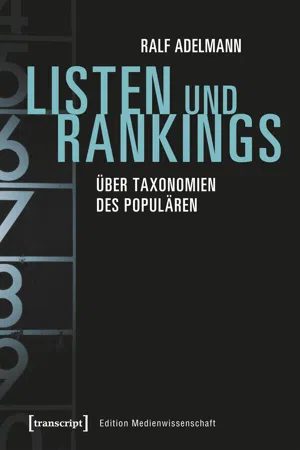
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Bestseller, Blockbuster, Top 100 – Listen und Rankings sind zentrale Ordnungs- und Wissensstrukturen der Populärkultur. Auf Internetplattformen und in Sozialen Medien machen sie populärkulturelles Wissen sichtbar, verfügbar und tauschbar. Ralf Adelmann geht der flüchtigen und heterogenen Wissenskultur dieser Taxonomien des Populären nach und zeigt: Sie arrangieren und strukturieren als mediale Formen populärkulturelle Produkte und deren Rezeption. Sie bieten ebenso kommunikative und mediale Anschlusspunkte für Subjektivierungen und soziale Formationen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Listen und Rankings von Ralf Adelmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Social Sciences & Art Theory & Criticism. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Subjektivierungen und soziale Formationen
Auf den ersten Blick erscheint der thematische Sprung von Listen und Rankings in der Populärkultur zur Erörterung des Subjektbegriffs in den aktuellen kulturwissenschaftlichen Debatten über eine weite Distanz zu gehen. Im Folgenden werde ich dennoch zeigen, dass es – mit der Perspektive auf populärkulturelle Phänomene – einen immanenten Zusammenhang zwischen der Entwicklung bestimmter Subjektdiskurse und der steigenden Bedeutung von Listen und Rankings gibt. Im zweiten Teil dieses Kapitels werden diese Überlegungen am Beispiel von Freundschaftsprozessen online ausgeweitet auf die soziale Dimension der medialisierten Subjektivierungen in der Populärkultur.
Beschreibt die Instabilität des Subjekts eine generelle Entwicklung der Postmoderne, so zeichnet sich Populärkultur gerade durch einen spielerischen Umgang mit modernen Subjektkonstruktionen aus, so dass die populärkulturellen Praxen ein wichtiges Element dieser Subjektkonstituierung geworden sind. Subjektkonstitution und Identitätskonstruktion werden in den Cultural Studies als eng verflochtene Prozesse gesehen. Subjektivität trägt zu einem kohärenten Personenverständnis bei, während Identitätsprozesse als emotionale innere Selbstbeschreibung sowie als soziale Beschreibung von außen funktionieren (Barker 2012: 220).
In seiner Betonung von Prozesshaftigkeit und von Agency schließt der Subjektbegriff der Cultural Studies an die Subjektanalysen von Michel Foucault an (Barker 2012: 238) wie dies Stuart Hall explizit formuliert:
»Ich stimme Michel Foucault zu, dass die Herausforderung ›nicht eine Theorie des wissenden Subjekts, sondern vielmehr einer Theorie diskursiver Praxis ist‹ [(Foucault 1974: 15); R.A.]. Aus dieser Dezentrierung folgere ich nicht, ›das Subjekt‹ aufzugeben oder zu eliminieren, sondern es in seinen neuen, verschobenen oder dezentrierten Positionen ins Paradigma aufzunehmen.« (Hall 2013: 168)
Die Beziehung zwischen den Subjekten und den diskursiven Praktiken werden bei Hall mit der Frage nach der Identität neu verhandelt. Deshalb setzt Hall sehr stark auf die späteren Publikationen von Foucault zu den Technologien des Selbst, in denen »die ›Mächtigkeit‹ diskursiver Formationen nicht ohne die Konstitution der Subjekte zu verstehen ist« (Hall 2013: 182). Aber Hall drängt weiter auf eine Stärkung der Praxen der Subjektivierung und der Identitätskonstruktion gegenüber dem Foucaultschen Ansatz, indem »dieses Verständnis von der diskursiven und disziplinierenden Regulation mit einer Erklärung der Praktiken der subjektiven Selbst-Konstitution zu ergänzen ist« (Hall 2013: 182f.).
Die Prozesshaftigkeit sowie das Zusammenwirken von Handlungsfähigkeit und Subjektkonstitution durch äußere Faktoren lässt sich aus der Perspektive der Cultural Studies insbesondere in der Populärkultur nachweisen. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zu den Untersuchungsfeldern von Foucault, der viel über die politischen und wissenschaftlichen Diskursivierungen des Subjekts und sehr wenig über Populärkultur schreibt (Kellner 2005b: 140). Deren Prozesse sind für die Cultural Studies dennoch konstituierend: Populärkultur basiert auf den Praxen der Subjekte. Zwar gibt es vorgefertigte Identitätsangebote der Kulturindustrie, die zugleich immer auch als emergente Phänomene der populärkulturellen Praxen verstanden und als Identitätsmuster angeboten werden. Ohne Strukturen, welche die Agency der Einzelnen ermöglichen, kann die Subjektkonstituierung nicht erfolgen. In anderen Feldern der Gesellschaft wie der Politik, der Bildung usw. können diese Muster normative Vorgaben des Staates oder eines Gesellschaftssystems sein – wie es schon Williams aus der englischen Wortherkunft ableitet: »a person under the dominion of a lord or sovereign« (Williams 1983 [1976]: 308). Die Frage nach Macht und Herrschaft stellt sich durch ihre Bedeutung für die Subjekt- und Identitätskonstruktion auch in der Populärkultur, aber den Praxen des Einzelnen bzw. seiner Vergemeinschaftung kommt dabei eine größere Bedeutung und Wirkungskraft zu.
Populärkultur und Medien werden in den Cultural Studies immer als Kontexte der Subjekt- und Identitätsbildung verstanden. Ähnlich argumentiert Andreas Reckwitz 2006 in seiner »Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne« (so der Untertitel seines Buches Das hybride Subjekt), indem er explizit auf den Zusammenhang von Medien und Subjektivierungspraxen aufmerksam macht. Eine seiner symptomatischen Beschreibungen widmet sich beispielsweise der »Zerstreuung des Subjekts im Medium des Audiovisuellen« (Reckwitz 2006: 382ff.). Statt seine These eines »hybriden Subjektes« in einer Abfolge unterschiedlicher Subjekttypen seit dem romantischen bürgerlichen Subjekt zu übernehmen, möchte ich auf Basis des Cultural Studies-Ansatzes eine Gleichzeitigkeit von mindestens zwei Subjekttypen feststellen. Dieses doppelte Subjekt ist vielleicht nur als medialisiertes konstruier- und erfahrbar. Eine Seite dieses doppelten Subjektes bildet weiterhin das bürgerliche Subjekt seit dem 18. Jahrhundert (Reckwitz 2006: 109), das weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft und ihren Bedeutungshorizonten spielt. Die andere Seite ist das verteilte, zersplitterte Subjekt, das sich in den Datenbanken von staatlichen wie populärkulturellen Institutionen wiederfindet. Der Status dieses doppelten Subjektes erscheint immer prekär und medialisiert; beide Seiten werden paradoxerweise idealisiert und in medialen Strukturen manifest.4
In den folgenden Analysen sehe ich demnach gleichzeitig zwei konstituierende und doch gegensätzliche Prozesse der Subjektivierung am Werk: Zum einen wird ein kohärentes Subjekt angestrebt, das sich unter anderem über seine Handlungsfähigkeit definiert; zum anderen verteilen sich Subjektfragmente gerade in populärkulturellen Praxen und ihren Medialisierungen.
DAS DOPPELTE SUBJEKT: MEDIALISIERUNG
EINER SUBJEKTKONSTITUIERUNG
Das Subjekt wird in postmodernen Theorien durchgehend als eine Vielheit gefasst: Es kann fragmentiert (Hall 2004), hybrid (Reckwitz 2006), paradox (Hauskeller 2000) und noch vieles mehr sein. Die Perspektive auf größere Gesellschafts- und Zeiträume wie die Moderne oder Postmoderne lässt das Subjekt, die Subjektivierung oder die Subjektkultur modellhafter und überschaubarer erscheinen. Sollen Epochen, Episteme oder soziale Formationen gegeneinander abgegrenzt oder miteinander verglichen werden, leisten die Analysen der jeweiligen Subjektmodelle wichtige Verallgemeinerungen und schaffen großflächige Vergleichsebenen. Dagegen sind die alltäglichen Mikropraxen der Subjektkonstruktion häufig nur partikulär oder widersprüchlich erfassbar. Die Elemente eines Subjektmodells sind beispielsweise bei der vielfältigen Rezeption von Medien nicht trennscharf auffindbar. Dies führt zu langwierigen medienwissenschaftlichen Debatten über aktive und passive Rezeptionshaltungen beim Medienkonsum (vgl. Ang 1996). Unbestreitbar bleibt in diesem Spektrum heterogener Sichtweisen der Subjektkonstitution durch mediale Mikropraxen, dass es zu einem Austausch zwischen den Anforderungen und Möglichkeiten von medialen Formen und den beteiligten Subjekten kommt.
Die Cultural Studies bemühen sich die subjektprägenden Prozesse von Medien kleinteilig als Identitätskonstruktionen zu analysieren. Mit dem hier vorgeschlagenen Modell des doppelten Subjekts wird an einer Brücke zwischen allgemeinen Subjektdiskursen und den spezifischen Wirkungsebenen von Listen und Rankings gearbeitet. Damit werden neben der Bedeutungsgenerierung auch mediale Strukturierungen und Formierungen in die Subjektivierungsprozesse einbezogen. Durch die gleichzeitige Realisierung zweier Subjektmodelle im Mediengebrauch können erst Effekte wie beispielswiese das Vergnügen der Nutzerinnen und Nutzer von datenbankbasierten Medienformen wie Plattformen erklärt werden. An dieser Stelle profitiert der hybride und praxeologische Subjektbegriff der Cultural Studies durch seine Ergänzung über die medientheoretische Bestimmung der Logiken eines Mediums – auch in Abgrenzung zu den Logiken der Subjektwerdung und -fragmentierung anderer Medien. Diese Medialisierung der Subjektwerdung lässt sich am Beispiel der Datenbank als medialisiertes Verfahren zeigen, in denen Subjekte sich jeweils als ein doppeltes konstituieren.
In den Überlegungen zu Datenbanklogiken wird deshalb das Modell eines doppelten Subjektes in unterschiedlichen medialen Formen verfolgt werden. Zuerst werden Subjektdiskurse aus der Datenbankgeschichte gegeneinander abgewogen, um dann an Medienbeispielen zu zeigen, wie sich das doppelte Subjekt jeweils in bestimmten Medienkontexten konkretisiert. Dieses übergreifende Modell eines doppelten Subjektes schließt an ein von Adelmann und Winkler entwickeltes Konzept der kurzen Handlungsketten und der Subjektkonstitution in Computerspielen an (Adelmann/Winkler 2010), das den Ausgangspunkt für eine Übertragung des Konzepts auf alle populärkulturellen Praxen bietet. Denn im Zusammenspiel von medienübergreifend eingesetzten Datenbanklogiken und konkreten medialen Formen präsentiert sich ein Grundmodell, das meines Erachtens über die Subjektkonstituierung in Computerspielen hinausgeht und für das Gegenstandsfeld von Rankings und Listen in der Populärkultur relevante Kriterien der Subjektkonstituierung beschreibt.
Die Überlegungen von Adelmann und Winkler zur Subjektkonstituierung in Computerspielen zielen zuerst gegen Konzepte der Interaktivität als zentrale Merkmale des digitalen Spielens und für einen im Computerspiel erfahrenen, subjektzentrierten Handlungsbegriff (Adelmann/Winkler 2010: 99f.). Interaktivität wird beispielsweise in einem Beitrag von Katie Salen und Eric Zimmerman zum Handbook of Computer Game Studies zu dem Bestimmungs- und Differenzmerkmal des Computerspiels als Medium: »it [interactivity; R.A.] pretty much completely defines the game medium.« (Salen/Zimmerman 2005: 70)
Entgegen dieser weitverbreiteten Auffassung stellen Adelmann und Winkler einen Zusammenhang zwischen einem kohärenten Subjekt und der Computerspielerfahrung durch die Handlungsfähigkeit oder Agency als Zentrum des bürgerlichen Selbstverständnisses her. Die verbindenden Elemente sind hierbei die kurzen Handlungsketten in Computerspielen, die ein kohärentes und handlungsmächtiges Subjektmodell bereitstellen. Insbesondere First Person Shooter, Bewegungs- oder Actionspiele erfordern und ermöglichen der Spielerin oder dem Spieler schnelle Handlungsabfolgen, da ein unmittelbares Verhältnis von Aktion und Reaktion im Computerspiel hergestellt werden kann.5 Im Gegensatz dazu stehen die Subjekterfahrungen der (Selbst-)Disziplinierungen in der modernen Gesellschaft. Handlungsmächtigkeit und Agency werden im Laufe des ›Zivilisationsprozesses‹ gebremst, verzögert und – wie Norbert Elias zeigt – in Bürokratien oder Finanzsysteme ausgelagert, die spontane Affekte, Triebe, Aktionen in lange Handlungsketten und -netze umwandeln (Elias 1976 [1939], 348ff.). Diese langen Handlungsketten verteilen und fragmentieren die Subjekte in die Prozesse einer ausdifferenzierten Gesellschaft, in der Akten, Identifizierungstechniken, Verwaltungsprozesse, Institutionen oder Datenbanken die verteilten Subjekte und ihre Handlungsmächtigkeit organisieren. Computerspiele und darüber hinaus Populärkultur stellen das kohärente und handlungsfähige Subjektmodell zumindest in Teilen weiter zur Verfügung. Auf dieser Handlungsfähigkeit oder Agency im populärkulturellen Kontext bestehen insbesondere die Cultural Studies (Winter 2009: 205). Diese Kontextualisierung von Agency betont Grossberg: »Agency can only be described in its contextual enactments. Agency is never transcendent.« (Grossberg 1992: 123)
Vor diesem Hintergrund des Zusammenhanges zwischen Agency und Populärkultur lässt sich aus der Geschichte der Datenbanken heraus die diskursive Dichotomie zwischen dem kohärenten und dem verteilten Subjekt exemplarisch vorführen. Die Datenbank ist für digitale Listen und Rankings eine grundlegende mediale Voraussetzung und – wie sich später noch zeigen wird – in Kombination mit Plattformen, Apps und Web Sites ein ›Schauplatz‹ des Zusammentreffens von medialen Formen und populärkulturellen Praxen. Im Datenbankdiskurs6, der im Folgenden an exemplarischen einflussreichen Texten erörtert wird, findet sich die zuvor schon thematisierte Dichotomie wieder: Das bürgerliche, kohärente und handlungsmächtige Subjektmodell trifft auf das verteilte und fragmentierte Subjektmodell der Postmoderne. Beide Subjekttypen lassen sich in den Modellen und Praxen des Datenbankdiskurses wiederfinden.
Dieser Widerstreit von Einheit und Zerstreutheit des Subjekts, der die Handlungsfähigkeit unmittelbar wiederherstellt oder zumindest die zeitliche Dehnung und Zerlegung einzelner Handlungsschritte zurücknimmt (Adelmann/Winkler 2010: 106), ermöglicht und entzieht im Datenbankdiskurs Handlungsfähigkeiten, die beide Seiten des doppelten Subjektes unterstützen. Im Datenbankdiskurs wird einerseits ein verteiltes, vernetztes und unsichtbares Subjekt produziert, andererseits kann die Nutzerin oder der Nutzer der Datenbank sich als autonomes und handlungsfähiges Subjekt konstituieren. Dieser Widerstreit zwischen zwei Subjektmodellen – dem kohärenten Subjekt und dem zerstreuten, vermittelten Subjekt produziert das Vergnügen und die Lust, welche die Nutzung von Datenbanken bzw. ihren Back-End-Repräsentationen wie Computerspieloberflächen, Social Network Sites oder Video-On-Demand-Plattformen in verschiedenen medialen Kontexten auszeichnet. Diesen Gewinn an Vergnügen verstehen die Cultural Studies als einen Effekt der Handlungsfähigkeit des Subjektes, die es in populärkulturellen Praxen auch in Auseinandersetzung mit kulturindustriellen Subjektivierungsangeboten finden kann. Als ein zum Teil planbarer und zum Teil ungeplanter Effekt ist die Produktion von Vergnügen als ein Automatismus zu verstehen, der auf emergente Phänomene wie Vergnügen oder Lust im Zusammentreffen von medialen Inhalten und Formen sowie den Nutzungspraxen zielt. Im ethnographisch ausgerichteten Zweig der Cultural Studies werden analoge Prozesse beobachtet. Beispielsweise fasst Johanna Dorer den Erklärungsversuch zum Entstehen von Vergnügen und Lust in Ien Angs Living Room Wars (1996: 170f.) folgendermaßen zusammen:
»Macht müsse im Sinne von Foucault als dezentrales Kräfteverhältnis gedacht werden, wo Mikromächte der Publikumsaktivitäten mit Makromächten der kapitalistischen Postmoderne interagieren, sodass Vergnügen bzw. Lust als Wirkung komplexer Machtformationen verstanden werden kann.« (Dorer 2009: 115)
Damit wird letztlich ein Automatismus angenommen, der im Fall von Ang mit komplexen Machtformationen bezeichnet wird. Die Lösung der Entstehung des Vergnügens wird bei Ang in dieser Machtkonstellation und in einer aktiven Bedeutungsproduktion des Publikums gesucht:
»the significance of the new audience studies should not be sought in their deconstruction of the idea of the ›passive audience‹—that figure of an older, arguably modernist paradigm—but in their exploration of how people live within an increasingly media-saturated culture, in which they have to be active (as choosers and readers, pleasure seekers and interpreters) in order to produce any meaning at all out of the overdose of images thrown before us.« (Ang 1996: 11)
Mit dem Fokus auf das doppelte Subjekt im Datenbankdiskurs wird im Weiteren die Schnittstelle zwischen medialer Formierung und den Praxen der Nutzerinnen und Nutzer weiter betont und mit einer stärkeren Gewichtung der medialen Elemente in den Subjektivierungen der Fokus möglicher Erklärungsmodelle im Vergleich zu einem Cultural Studies-Zugang verschoben.
Subjektivierung in Datenbanken
Vor dem Hintergrund der These eines doppelten Subjektes versprich...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Startpunkte: Taxonomien des Populären
- Thesen
- Listen und Rankings in der Mediengeschichte
- Subjektivierungen und soziale Formationen
- Plattformen und Mobilisierungen
- Populärkultur als Wissenskultur
- Listen und Rankings als Wissens- und Ordnungssysteme
- Literatur