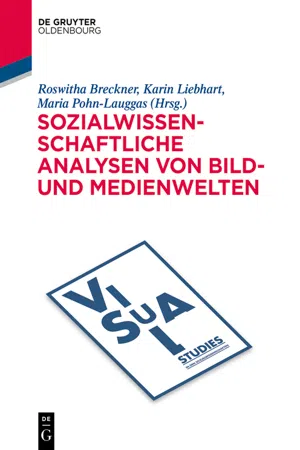
Sozialwissenschaftliche Analysen von Bild- und Medienwelten
- 305 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Sozialwissenschaftliche Analysen von Bild- und Medienwelten
Über dieses Buch
Die Analyse bewegter wie unbewegter Bilder hinsichtlich ihrer sozialen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Rolle gewinnt in den Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeutung. Mittlerweile stehen vielfältige theoretische und methodologisch-methodische Zugänge der Bild- und Filmanalyse zur Verfügung, die sich auch wechselseitig anregen. Zum Teil sind sie im deutschsprachigen und/oder internationalen Wissenschaftsraum bereits etabliert, zum Teil betreten sie auch theoretisches und methodisches Neuland.
In diesem Band stellen Wissenschafter*innen des Forschungsschwerpunktes "Visual Studies in den Sozialwissenschaften" an der Universität Wien verschiedene Ansätze vor, die in den Disziplinen Politikwissenschaft, Soziologie, Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie Kultur- und Sozialanthropologie Anwendung finden. Sie reichen von wissenssoziologisch-hermeneutischen Zugängen und Rekonstruktionen mittels der Dokumentarischen Methode über Multimodalanalyse und ethnographische Analysen sowie Filmanalysen bis hin zu partizipativen Ansätzen und zu einem Visual Essay. Ausgehend von einer theoretischen Standortbestimmung werden in den Beiträgen die jeweiligen Zugänge präsentiert und es wird an einem konkreten Beispiel deren Umsetzung gezeigt. Ziel ist es, konkrete empirische Analysen und deren methodologisch-methodische Grundlagen anhand unterschiedlicher visueller Medien in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten mit verschiedenen thematischen Fokussierungen darzustellen. Der Band enthält Beiträge in deutscher und englischer Sprache und ermöglicht einen anwendungsorientierten Einblick in das breite Feld visueller Analysezugänge in den Sozialwissenschaften.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
Teil IV Bewegtbildanalysen – Geschlechterbilder in Film und Politik
7 Soziologisches Filmlesen. Methodologische Konzeption und Praxisanleitung anhand der Beispielstudie „Sexarbeit in ausgewählten österreichischen Kino-Spielfilmen“
7.1 Einleitung
7.2 Theoretisch-methodologische Verortung des Soziologischen Filmlesens
7.2.1 Gegenstand und Erkenntnisinteresse
- – Was wird gezeigt: In welchen thematischen Kontexten wird das erkenntnisrelevante Thema in den Filmerzählungen aufgegriffen?
- – Wie wird das erkenntnisrelevante Thema verhandelt (das heißt filmisch umgesetzt): In welche argumentativen Zusammenhänge wird es durch (a) die Struktur und bestimmte visuelle Aspekte der Erzählung, (b) die Figurendarstellung, (c) die Handlung gestellt?
- – Welche erkenntnisrelevanten Bedeutungskonstruktionen lassen sich daraus erschließen?
- – Welche Werturteile in Bezug auf das verhandelte Thema werden nahegelegt?
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Danksagung
- Einleitung
- Introduction
- Teil I Visuelle Segmentanalyse – Ein bildhermeneutischer Zugang zu privaten und öffentlichen Bildwelten
- Teil II Dokumentarische Methode in medienwissenschaftlicher Perspektive
- Teil III Ethnografische Untersuchungen visueller Medienpraktiken
- Teil IV Bewegtbildanalysen – Geschlechterbilder in Film und Politik
- Teil V Partizipative visuelle Forschung
- Teil VI Erkundungen mittels eines Visual Essays