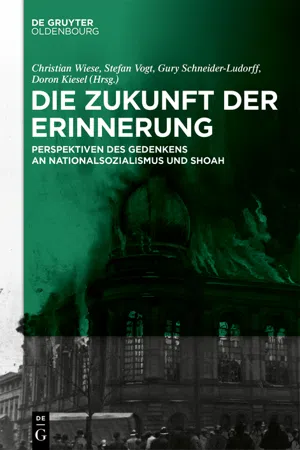Die Frage nach der „Zukunft der Erinnerung“ an den Nationalsozialismus wird in den letzten Jahren immer häufiger gestellt. Die Sorge, die dabei meist mitschwingt, richtet sich auf den endgültigen Abschied von den „Zeitzeugen“, auf den immer weiter wachsenden zeitlichen Abstand zum historischen Geschehen – und sie wird befördert durch aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen. Eine rechtspopulistische Partei sitzt nicht nur in allen Landesparlamenten, sondern auch im Bundestag, selbsternannte „Patriotische Europäer“ demonstrieren in vielen deutschen Städten regelmäßig gegen eine angeblich drohende „Islamisierung des Abendlandes“ („Pegida“) und eine ganze Reihe rassistisch und antisemitisch motivierter Mordanschläge offenbaren eine neue Qualität des Rechtsradikalismus in Deutschland. Vor diesem Hintergrund sind sorgenvolle Fragen nicht überraschend. Steht die deutsche Gesellschaft an einer erinnerungs- und vergangenheitspolitischen Schwelle? Ist die „Erinnerungskultur“ bedroht und entschwindet die Geschichte von Nationalsozialismus und Holocaust aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein?
Implizit oder explizit liegt solchen Fragen oft die Annahme zugrunde, dass die Deutschen nach 1945 zwar nicht sofort, aber immerhin nach einiger Zeit einen Weg der „Aufarbeitung“ und „Bewältigung“ der NS-Vergangenheit beschritten haben, der allen Problemen und Defiziten ungeachtet am Ende doch als Erfolgsgeschichte anzusehen sei. Kein Volk der Welt, so heißt es oft, habe sich derart intensiv mit der eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt wie die Deutschen. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus sei zum festen Bestandteil deutschen Selbstverständnisses geworden, das Bewusstsein für die historische Verpflichtung drückt sich nicht nur in der nicht abreißenden öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion über die NS-Vergangenheit aus, sondern auch in zahllosen Museen, Mahnmalen und Gedenkstätten. Diese Präsenz der Geschichte des „Dritten Reiches“ erscheint rückblickend oftmals als ein Normalzustand kritischer „Erinnerungskultur“, der seit den 1960er-Jahren, seit „Achtundsechzig“, seit den 1980er-Jahren – jedenfalls seit Jahrzehnten erreicht worden sei und der nun bedroht sei.
Blickt man allerdings genauer auf die verschiedenen Phasen des Umgangs mit der NS-Vergangenheit seit 1945, dann fällt es schwer, eine solche Erfolgsgeschichte zu erzählen und eine stabile Form kritisch-reflexiver „Erinnerungskultur“ historisch zu fassen. Im Gegenteil erweist sich die Geschichte der „Aufarbeitung“ und „Bewältigung“ niemals als statisch. Sie war immer umstritten und geprägt von erstaunlichen Ungleichzeitigkeiten, inneren Widersprüchen, überraschenden Blindstellen, unerwarteten Fortschritten und ernüchternden Beharrungskräften. Angesichts dessen verliert die Vermutung, die deutsche Gesellschaft stehe an der Schwelle eines Umbruchs – womöglich gar eines Abbruchs – der Erinnerungskultur, an unmittelbarer Überzeugungskraft.
Dieser Beitrag erhebt nicht den Anspruch, eine neue Deutung des Umgangs der Deutschen mit der NS-Vergangenheit zu bieten, auch keine neuen aus empirischer Forschung gewonnenen Erkenntnisse. Erst recht fällt aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive eine Zukunftsprognose schwer. Im Folgenden wird vielmehr der Versuch unternommen, die Geschichte des Umgangs mit Nationalsozialismus und Holocaust in Deutschland in der gebotenen Kürze zu skizzieren und dabei insbesondere die Ambivalenz der Entwicklung hervorzuheben. Diese Darstellung kann sich auf eine inzwischen breit entfaltete Forschung stützen, die nicht nur die unterschiedlichsten Aspekte des politischen und gesellschaftlichen Umgangs mit der NS-Vergangenheit historisiert, sondern seit Längerem auch die internationalen und transnationalen Bezüge des deutschen Falls berücksichtigt.1 Selbst ein „Lexikon der Vergangenheitsbewältigung“ liegt inzwischen vor.2 Eine Gesamtdarstellung in monografischer Form fehlt allerdings noch immer.
Wie unterschiedlich das Thema der „jüngsten Vergangenheit“ die Deutschen in mehr als sieben Jahrzehnten beschäftigte, zeigt schon die bemerkenswerte Verschiebung der Semantik: Ging es seit den frühen 1960er-Jahren um „Bewältigung“ der Vergangenheit, so sprach man später – im Bewusstsein der Unmöglichkeit einer „Bewältigung“ – häufiger von „Aufarbeitung“ der Vergangenheit. Mindestens im akademischen Diskurs etablierte sich eher der Begriff des „Umgangs“ mit der NS-Vergangenheit. In den letzten Jahren hat schließlich der Begriff der „Erinnerungskultur“, der bis Mitte der 1990er-Jahre kaum nachweisbar ist und seit 2010 in stark steigendem Maße Verwendung findet, eine steile Karriere gemacht.3
„Abrechnung“
Die durchgreifende politische Säuberung, die in den ersten Nachkriegsjahren von den Alliierten vorgenommen wurde, ließe sich als Phase der „Abrechnung“ bezeichnen.4 Tausende Deutsche wurden in Militärgerichtsprozessen zur Verantwortung gezogen. In den drei Westzonen wurden rund 5.000 Angeklagte verurteilt, knapp 500 Todesurteile wurden vollstreckt. Man nahm mittlere und höhere NS-Amtsträger in großer Zahl in „automatischen Arrest“ und verhaftete Zehntausende politisch Belastete.5 Eine sehr große Zahl von Menschen war von diesen Maßnahmen betroffen. Vermutlich kam jeder Deutsche im Familien- oder Bekanntenkreis mit der politischen Säuberung in Berührung. Deren symbolische Spitze bildete der „Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess“, in dem sich von November 1945 bis Oktober 1946 24 noch greifbare Größen des „Dritten Reiches“ vor einem internationalen Gerichtshof verantworten mussten.6 Anschließend stellten die Amerikaner in zwölf sogenannten Nachfolgeprozessen ausgewählte Vertreter einzelner Funktionseliten (Offiziere, Juristen, Mediziner u. a.) vor Gericht. Begleitet wurden diese Prozesse von einer aufwendigen Informations- und Aufklärungskampagne, die auch ihre Wirkung nicht verfehlte: 1946 hielten immerhin 78 Prozent der Deutschen die Verfahren in Nürnberg für „fair“.7
Je deutlicher allerdings wurde, dass die politische Säuberung mit den Nürnberger Prozessen nicht abgeschlossen sein würde, desto mehr schwand die Zustimmung in der Bevölkerung. 1949 konnten nur noch weniger als 20 Prozent der Deutschen die alliierte Politik der politischen Säuberung gutheißen.8 Das Wort von der „Siegerjustiz“ machte die Runde und das der „Kollektivschuld“, die die Sieger den Besiegten vermeintlich zuschrieben.9 Beides war objektiv unsinnig, zeichnete sich die alliierte Säuberungspolitik doch gerade durch das Prinzip individueller Schuldfeststellung aus.10 Die rapide abnehmende Zustimmung hing eng mit dem Anlaufen der individuellen „Entnazifizierung“ der Bevölkerung zusammen.11
Seit Herbst 1945 mussten die Deutschen nämlich in einem Fragebogen Angaben über ihre politische Vergangenheit machen. Auf dieser Grundlage wurden sie dann in fünf Belastungskategorien eingeteilt. In der US-Zone: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Hauptschuldigen und Belasteten drohten bis zu zehn bzw. fünf Jahre Arbeitslager und vollständiger bzw. teilweiser Entzug des Vermögens, Verlust von Pensions- und Rentenansprüchen aus öffentlichen Mitteln und ein mindestens zehn- bzw. fünfjähriges Verbot, einer anderen als „gewöhnlichen“ Arbeit nachzugehen. Mitläufer hatten lediglich Gehaltskürzungen und Strafzahlungen an den Wiedergutmachungsfonds zu fürchten.12
Dass diese massenhafte Entnazifizierung scheiterte, gilt als gesicherte Erkenntnis. Tatsächlich hatte sich das individuelle Überprüfungsverfahren als sehr bürokratisch und aufwendig erwiesen, zunächst vorgezogene minderschwere Fälle wurden vergleichsweise härter bestraft als die aufgeschobenen schwereren Fälle, und schließlich unterliefen die Deutschen selbst das Verfahren, indem sie sich gegenseitig entlastende „Persilscheine“ ausstellten. Ironischerweise gingen die Deutschen aus der „Entnazifizierung“ tatsächlich entnazifiziert hervor: In den Westzonen erwies sich bis Ende 1949: Ganze 0,7 Prozent der behandelten Fälle waren Hauptschuldige und Belastete, 4,1 Prozent waren minderbelastet, hingegen erwiesen sich 27,5 Prozent als Mitläufer und 33,2 Prozent als entlastet. In 34,5 Prozent der Fälle wurde das Verfahren eingestellt.13 Blickt man nur auf die US-Zone, wurden dort 2,5 Prozent der untersuchten Fälle als Hauptschuldige oder Belastete eingeteilt, 11,2 Prozent als minderbelastet, 51,1 Prozent waren Mitläufer und 1,9 Prozent waren entlastet. Die „Entnazifizierung“ schrieb die Unschuld der Deutschen fest, sie war eine „Mitläuferfabrik“ (Lutz Niethammer).14 Zu einer Gesamteinschätzung gehört allerdings auch, dass die harte Säuberungspolitik der Alliierten ein wichtiges Signal setzte: eine irgendwie geartete Fortsetzung nationalsozialistischer Politik oder Ideologie würde nicht geduldet werden. Diese Botschaft war unmissverständlich und eine derart klare Normsetzung war alles andere als überflüssig in einer deutschen Gesellschaft, die noch wenige Jahre zuvor in großen Teilen in – wenn auch im Kriegsverlauf erodierender – Loyalität zum NS-Staat gestanden hatte.
Die nahe liegende Vermutung, dass in den Köpfen der Deutschen das Jahr 1945 keine „Stunde Null“ bedeutet hatte, wurde von Meinungsumfragen bestätigt, denen zufolge etwa die Hälfte der während der Besatzungszeit befragten Deutschen den Nationalsozialismus für eine „gute Idee“ hielt, die nur „schlecht ausgeführt“ worden war.15 Erinnert wurden hier zweifellos in erster Linie die „guten Jahre“ der Vorkriegszeit, von denen sich die Jahre des Krieges noch scharf abh...