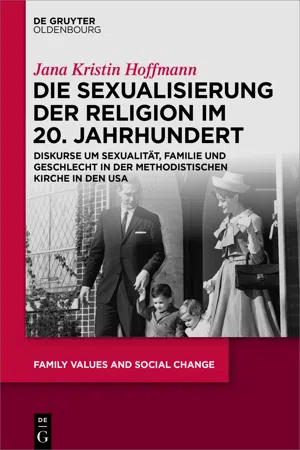1.1 Forschungsinteresse und Forschungsfragen
Vom 30. April bis zum 5. Mai 1961 veranstaltete der National Council of Churches of Christ in the U. S. A. (kurz NCC)1 zusammen mit seinem kanadischen Pendant die erste North American Conference on Church and Family in Green Lake, Wisconsin. Für die Vorbereitungen und Hauptorganisation fiel die Wahl auf zwei bekannte Größen im Feld der Familienforschung und -beratung: das Ehepaar Evelyn M. und Sylvanus M. Duvall. Sie war Bestsellerautorin, promovierte Soziologin und Expertin für Familienentwicklung und Jugendkultur, er ordinierter Pfarrer, Professor für Sozialwissenschaften und Religion, ebenfalls Experte für Familien- und Ehefragen. Unter der Herausgeberschaft der Duvalls und vom YMCA publiziert, entstand in Vorbereitung auf die Konferenz ein Handbuch mit dem Titel Sex Ways – in Fact and Faith. Bases for Christian Family Policy.2 Dieses verschickten die OrganisatorInnen drei Monate vor der Konferenz an alle Delegierten. Das Handbuch enthielt Aufsätze von damals namhaften ExpertInnen aus den Bereichen der Familien- und Sexualitätsforschung, die den aktuellsten Forschungsstand zusammentrugen.3 In den Gastbeiträgen und unter den TeilnehmerInnen der Konferenz trafen sich bekannte VertreterInnen aus verschiedenen Fachdisziplinen sowie renommierte Pfarrer, hohe Kirchenbeamte und VertreterInnen unterschiedlichster religiöser Organisationen.4
Die über 500 Teilnehmenden der Konferenz repräsentierten nicht weniger als 33 Denominationen und 57 Bundesstaaten beziehungsweise Provinzen.5 Ziel der Veranstaltung war es, sich auf eine neue positive christliche Sexualethik zu verständigen, um die Familie als Basis von Kirche und Staat zu stärken und zu unterstützen. Verhütung, Ehescheidung, konfessionelle Mischehen und Sexualverhalten unter Jugendlichen fanden auf der Konferenz ebenso einen Diskussionsraum wie die Themen Abtreibung, Homosexualität und unverheiratete Mütter. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen gesellschaftlich wahrgenommenen Problemen, Transformationsprozessen und wissenschaftlichen Erklärungsmustern sollte schließlich auch zu einer Professionalisierung der protestantischen Kirchen auf diesen Themengebieten führen, sodass anschließend an die Konferenz Kirchenprogramme für Familien und Seelsorge weiterentwickelt und ausgebaut werden konnten.6
Gut ein Jahr später erschien ein weiteres Buch zur Konferenz, diesmal für die Unterweisung der christlichen LaiInnen, welches die wichtigsten Informationen und Ergebnisse zusammenfasste. Für die Herausgeberschaft wählte der YMCA wieder ein bekanntes Ehepaar der damaligen Zeit, Elizabeth S. und William H. Genné. Er war ordinierter Pfarrer der Connecticut Baptist Convention, Autor, Universitätslehrer in Soziologie, Mitbegründer von SIECUS7 und langjähriger Direktor der NCC-Abteilung Sexuality, Marriage and Family Ministries (1957–1976). Sie war Lehrerin und Beraterin für Elternbildung, Autorin, nationales Vorstandsmitglied des YWCA (1957–1979), Expertin für Familienleben, mütterliche Gesundheitserziehung (maternal health education) und Sexualerziehung.8 Die hochkarätige Besetzung mit ReligionsexpertInnen, die verschiedenen Zielgruppen und vielfältigen Publikationen sind ein Beleg für die Bedeutung der Konferenz zur damaligen Zeit.
Die Familienkonferenz von 1961 war nicht der Anfang mainline-protestantischer Sexualitätsdiskurse, sondern ein erstes Zwischenfazit bereits vorangegangener protestantischer Modernisierungsprozesse, die zum Teil bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückgeführt werden können. Eine Tatsache, die auf den ersten Blick vielleicht überrascht, weil religiöse Umdeutungen hinsichtlich Sexualität in der Regel nicht mit den 1950er Jahren oder früher in Verbindung gebracht werden. Diesem neuen, gesteigerten mainline-protestantischen Interesse an Sexualität und den damit zusammenhängenden Auswirkungen auf das kirchliche und gemeinschaftliche Leben wird dieses Buch nachgehen, indem es Sexualitätsdiskurse und Praktiken der Methodistischen Kirche im 20. Jahrhundert in das Blickfeld der Analyse rückt und die mit Modernisierungsprozessen einhergehenden Ambivalenzen aufdeckt. Der empirische Fokus liegt auf den Jahren 1950–1990.
Diese, außerhalb der Forschung über US-amerikanische Religionsgeschichte eher selten wahrgenommene, Familienkonferenz ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert und bietet für die weitere Analyse wichtige Anhaltspunkte. Erstens ist sie zu Beginn der 1960er Jahre ein von Religionsgemeinschaften, Theologen, Sozial- und NaturwissenschaftlerInnen organisiertes, besuchtes und damit interdisziplinäres Forum, dass sich weiträumig mit dem Thema Sexualität und Familie beschäftigte. Dieses Forum versuchte das Verhältnis zwischen religiösen Traditionen und Glaubensregeln, gesellschaftlichen Normen und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszuloten sowie im Kontext von gesellschaftlichen Modernisierungs- und Transformationsprozessen zu verorten und zu bewerten – miteinander, nicht gegeneinander. Zweitens spiegelt die Konferenz das große Interesse von Seiten religiöser ExpertInnen9 und kirchlichen Institutionen an der Sexualitätsthematik, der Lösung damit zusammenhängender gesellschaftlicher Probleme, der Sammlung und Verbreitung von Faktenwissen sowie der Erneuerung theologischen Wissens wider. Drittens verweisen die diskutierten Themenfelder darauf, dass verschiedene Sexualitätsthemen keine Tabuisierung mehr erfuhren, sondern auch in der religiösen Öffentlichkeit eine neue Sagbarkeit erlangt hatten. Auch ging es in der Diskussion weniger um den Geschlechtsakt an sich als vielmehr um Sexualität und ihre Bedeutung im Kontext von Theologie, Ehe, Familie und Jugendlichen, Reproduktion und Generation, die Frage nach richtigem und falschem Sexualverhalten und -verständnis. Damit verbunden wurde die wissenschaftliche und theologische Frage diskutiert, was biologisch / natürlich veranlagt, was Teil der Schöpfungsordnung war und was einer soziokulturellen Prägung unterlag.
Dieser Nexus zwischen Religion und Sexualität war in der US-amerikanischen Geschichte zwar nicht neu, wenn es darum ging, Familienideale, Geschlechtervorstellungen und -beziehungen zu definieren, Reproduktion zu regulieren sowie gesellschaftliche Normen und Wertesysteme zu verhandeln. Dennoch gewann Sexualität, wie die folgende Arbeit zeigen wird, in religiösen Diskussionszusammenhängen im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an neuer Qualität und Komplexität. Diese führten zur Neukonzeptionierung religiöser Vorstellungen von Ehe, Familie, Geschlecht, Sexualerziehung, Reproduktion und Homosexualität – zentrale Diskussionsthemen, die den analytischen Rahmen für dieses Buch bilden. Insofern liegt es im Hauptinteresse dieser Studie, diese Neukonzeptionen aufzuspüren und ihre diskursive Formation und Herstellung zu erklären, Wissensstrukturen und deren Veränderungen sichtbar zu machen und schließlich ihre Bedeutung für die methodistische Religionsgemeinschaft als Teil der US-amerikanischen Gesellschaft offenzulegen. Auch wird durch die Linse von Sexualitätsdiskursen zusätzlich der Frage nachgegangen, ob und wie es zu Neujustierungen innerhalb der religiösen Geschlechterordnung kam und welche theologischen und säkularen Legitimierungsstrategien von Seiten der Kirche als Institution sowie von Theologen und ReligionsexpertInnen hierfür herangezogen wurden. Das Eingangsbeispiel hatte bereits gezeigt, dass es im Interesse der Konferenzteilnehmenden war, Scheidungen entgegenzuwirken und mit Hilfe unterschiedlicher Programme und wissenschaftlicher Analysen den Erfolg von Ehen und Familien zu fördern.
Zudem wird angenommen, dass sich durch die religiöse Teilhabe an gesellschaftlichen Sexualitätsdiskursen die Ausrichtung und gesellschaftliche Stellung der mainline-protestantischen Kirchen veränderte und erheblichen Einfluss auf die Gemeindearbeit nahm. Sexualität als religiöser Bedeutungskomplex hat sich hierdurch, so eine zentrale These dieser Arbeit, sowohl innerhalb einzelner Religionsgemeinschaften als auch zwischen verschiedenen Denominationen und Konfessionen in der Nachkriegszeit als ein wesentliches Distinktionsmerkmal diskursiv formiert und durchgesetzt.