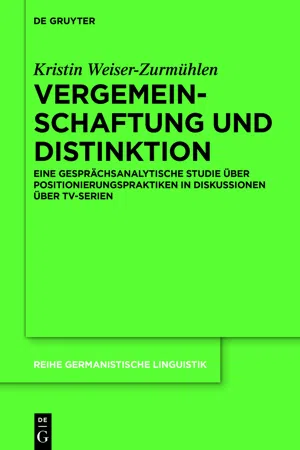Serien bilden einen großen Teil der gegenwärtigen Medienlandschaft und sind längst nicht mehr nur im linearen Fernsehen verankert, sondern auch auf Plattformen und Streaming-Diensten, die eine immer größere und ausdifferenziertere Bandbreite für unterschiedliche Zielgruppen anbieten. Sie sind – nicht nur in Pandemie-Zeiten – ein fester Bestandteil unseres (medialen) Alltags und können uns damit auch gleichermaßen stets mit Gesprächsstoff für Unterhaltungen versorgen. Diese Tatsache ist für die Medienrezeptionsforschung keineswegs unbedeutend, denn wie Bock (2013: 200) in ihrer Studie zur Rezeptionsmotivation von Fernsehserien zeigt, stellt Serienkommunikation einen zentralen Aspekt für den Anreiz, Serien zu konsumieren, dar:
Während die Rezeption zu annähernd gleichen Teilen entweder allein oder mit anderen erfolgt (49,9%) und das eigentliche Schauen somit gern auch allein stattfindet bzw. Gesellschaft bei der Rezeption nicht immer erwünscht ist, so besteht dafür nach der Rezeption umso stärker das Bedürfnis sich über die Serien mit anderen auszutauschen. Der Großteil (91,6%) spricht mit dem Partner, Freunden, Bekannten, Kollegen oder Familienangehörigen über die Serienrezeption.
Bocks Studie bezieht sich zwar nur auf die Kommunikation mit bekannten Personen über die Lieblingsserie, allerdings bieten sich Serien ebenfalls als Gesprächseinstieg oder Small Talk-Thema an, auch für Menschen, die einander (noch) nicht gut kennen. Binotto und Pfister (2015: 35) konstatieren: „Es fällt auf, dass heute Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus und Altersklassen sich kulturell vielleicht am ehesten im Gespräch über Serien treffen. Man erkennt sich gegenseitig daran, welche Serie man schaut“, d.h. man kann mit der oder den anderen Person(en) spontan und unkompliziert Gemeinschaft über einen geteilten Seriengeschmack herstellen – oder eben nicht. Somit lohnt es sich, das Sprechen über Serien in der Interaktion und die dabei stattfindenden Vergemeinschaftungs- und Distinktionsprozesse einer genauen Betrachtung zu unterziehen.
Die vorliegende Studie nähert sich dem Phänomen der Serienkommunikation aus gesprächslinguistischer Perspektive, um genau diese sprachlichen Prozesse des Herstellens von Gemeinschaft und Abgrenzung zu untersuchen. Dabei steht nicht eine einzelne, forscher*innenseitig ausgewählte Serie im Vordergrund, sondern es wird das gesamte Spektrum serieller Formate in den Blick genommen, das Interagierende wählen können, wenn Serien das Gesprächsthema bilden. Damit schließt diese Arbeit unter anderem an Forschungsarbeiten zur literarischen (Charlton und Sutter 2007, Heizmann 2018), Publikums- (Gerwinski, Habscheid und Linz 2018) und Kunstkommunikation (Hausendorf und Müller 2016) an sowie zur kommunikativen Verarbeitung von Medienthemen in der Interaktion (Keppler 1994, Ayaß 2012). An bisherige Erkenntnisse anknüpfend wird davon ausgegangen, dass die Beschaffenheit des thematisierten Mediums Auswirkungen sowohl auf die inhaltliche Gestaltung als auch auf die gesprächsstrukturellen Anforderungen der Interaktion hat, aus denen sich wiederum Vergemeinschaftungs- und Distinktionsprozesse ergeben können.
Das Kontrastpaar „adequation and distinction“ führen Bucholtz und Hall (2005: 599) in ihrem Framework zur Analyse von Identität in Interaktion als eine von mehreren relationalen Achsen an, entlang derer Identitäten konstruiert werden. Wenn der Fokus dieser Arbeit also auf interaktiven Prozessen der Vergemeinschaftung und Distinktion liegt, so werden zwar Identitätskonstruktionen nicht explizit untersucht, beide Aspekte können aber auch nicht losgelöst von Identitätsfragen betrachtet werden. Denn die Kommunikation von Geschmack weist nicht nur einen inhärent interaktiven, sondern auch identitätskonstruierenden Charakter auf: Indem sich Interagierende wechselseitig mitteilen, welche Serien sie (nicht) mögen, zeigen sie ihren Geschmack an – und damit immer auch eine Facette ihres Selbst. So postulieren Bendix u. a. (2012: 313): „‚Du bist, was du magst‘. Geschmacksfragen sind ohne Bezüge auf ‚die Anderen‘ nicht zu klären und damit keineswegs rein individuell oder zufällig“. Die Kommunikation über ästhetische Gegenstände findet also einerseits vor dem Hintergrund von Bewertungsmaßstäben statt, die in soziale und kulturelle Zusammenhänge eingebettet sind, erfordert aber andererseits auch den Abgleich individueller Geschmacksvorlieben.
Aufgrund der Vielfalt seriell organisierter medialer Produkte werden diesbezüglicheWissensbestände undWertungen im Rahmen von Sozialisationsprozessen erworben. So gehen Anders und Staiger davon aus, dass insbesondere Schüler*innen schon früh Rezeptionsmuster zu Serien in verschiedenen medialen Formen wie etwa Bilder-, Kinder- und Jugendbücher, Hörspiele und TV-Formate ausgebildet haben; sie sind also „Serienprofis – ohne es zu wissen“ (Anders und Staiger 2016: 13). Die Autor*innen nehmen diese Prämisse zum Ausgangspunkt für eine Serialitätsdidaktik und plädieren für eine schulseitige Öffnung für Serien als Lerngegenstand und somit dafür, Schüler*innen als Serienprofis einzubeziehen.
Die empirische Grundlage bilden videografierte Interaktionen zwischen Schüler*innen unterschiedlicher Altersstufen und Schulformen, die an einer als Gruppendiskussion zum Thema Serien angekündigten Studie teilgenommen haben. Für die Auswertung der Daten wird eine an die ethnomethodologische Konversationsanalyse (Sacks, Schegloff und Jefferson 1974) angelehnte Vorgehensweise verwendet, die ausschließlich auf der interaktiven Oberfläche erkennbare Handlungen berücksichtigt, dabei sequenziell und mikroanalytisch sowie deskriptiv vorgeht. Damit bedient sich die Methode der gleichen Ressourcen, die Interagierenden auch zur Verfügung stehen: Denn wenn Personen miteinander in Kontakt treten, sind sie ebenfalls auf Beobachtungen und Interpretationen der (sprachlichen) Handlungen der anderen Interagierenden angewiesen, um ihre eigenen Äußerungen und Handlungen dem Kontext entsprechend anzupassen. Im Sinne von Berger und Luckmann (1969) wird somit soziale Wirklichkeit als Konstruktionsleistung gemeinsam Handelnder modelliert. Vor diesem Hintergrund werden auch Geschmack und Expertise als diskursiv hervorgebrachte, dynamische und stets aushandelbare Phänomene verstanden. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit die Aussage von Anders und Staiger dahingehend präzisiert, dass Schüler*innen nicht unbedingt Serienprofis sind, sondern dass sie sich als solche positionieren. Auf dieser Grundlage wird mit dem Konzept der Positionierung ein analytisches Instrument hinzugezogen, mit dem Forschende Identitätskonstruktionen sowie Vergemeinschaftungs- und Distinktionsprozesse erfassen können.
Ziel dieser Arbeit ist es, ein theoretisch und empirisch fundiertes Analysemodell als Heuristik zu entwickeln, mit dem Vergemeinschaftung und Distinktion über das Konzept der Positionierung im Kontext von Serienkommunikation erfasst werden können. Dafür werden in einem ersten Schritt auf lokaler Ebene die epistemischen und evaluativen Positionierungspraktiken analysiert, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwenden, um Vergemeinschaftung und Distinktion in der Interaktionssituation herzustellen. In einem zweiten Schritt wird der Gesprächsgegenstand einbezogen, indem analysiert wird, über welche medien- und rezeptionsbezogenen Aspekte sie Gemeinschaft bzw. Distinktion etablieren, d.h. welche diskursiven Orientierungen globaler Reichweite sich über die Analyse der Positionierungspraktiken rekonstruieren lassen. Im Kontext von Medienkommunikation ist es notwendig, sowohl die Interaktionssituation der Gesprächspartner*innen als auch die Möglichkeiten, die die Medienprodukte für deren Rezeption anbieten, analytisch aufeinander zu beziehen (vgl. dazu auch Keppler 1998: 184). Somit ist die vorliegende Arbeit an der Schnittstelle von Gesprächslinguistik auf der einen Seite und Medienrezeptionsforschung auf der anderen Seite angesiedelt.
Der Text gliedert sich in einen theoretischen Teil, in dem die vielfältigen theoretischen, analytischen und methodologischen Bezüge dargestellt werden, und einen empirischen Teil, in dem die vorliegenden Gesprächsdaten aus verschiedenen Perspektiven mit dem erarbeiteten Instrumentarium analysiert werden. Zunächst werden in Kapitel 2 Gespräche über Serien als Forschungsgegenstand skizziert und in den Forschungsstand eingeordnet. Dabei wird der Forschungsdiskurs um Serialität dargestellt und entlang verschiedener für die vorliegende Studie relevanter Aspekte strukturiert (Abschnitt 2.1). Anschließend wird diese Arbeit im Kontext von Forschung zu Medienrezeption in der Interaktion – d.h. Publikums-, Theater-, Kunst- und literarischer Kommunikation sowie Medienthematisierungen in Tischgesprächen – verortet (Abschnitt 2.2). In Kapitel 3 wird mit dem Positionierungskonzept der analytische Bezugsrahmen skizziert. Dafür werden nach einer kurzen Einführung in die forschungstheoretische und -historische Einordnung des Konzepts (Abschnitt 3.1) zunächst bisher von Forschenden untersuchte Relationen von Positionierungen systematisiert (Abschnitt 3.2). Abschließend wird dargestellt, welches Verständnis von Positionierung der vorliegenden Studie zugrunde liegt (Abschnitt 3.3). In Abschnitt 4 wird schließlich der methodologische Bezugsrahmen der Arbeit etabliert. In diesem Zuge werden die Methode, Analyse und Gegenstand sowie weitere relevante, theoretische Konzepte aus interaktionslinguistischer Perspektive diskutiert. Daher werden zuerst die Prinzipien der Konversationsanalyse als die der Datenanalyse zugrunde liegende Methode erläutert (Abschnitt 4.1), bevor die Konsequenzen für die (Positionierungs-)Analyse von Serienkommunikation miteinander in Beziehung gesetzt und reflektiert werden. Abschnitt 4.2 widmet sich dem epistemischen Recht auf Evaluation, d.h. der Zusammenhang zwischen Bewerten und dem Anzeigen von Wissen (Abschnitt 4.3) wird skizziert.
Ab Kapitel 5 folgt der empirische Teil. Zunächst werden das Studiendesign, der Feldzugang und die Zusammenstellung des Korpus (Abschnitt 5.1) sowie die Vorgehensweise bei der Datenaufbereitung und -analyse (Abschnitt 5.2) erläutert, um anschließend methodologische Reflexionen bezüglich der Datenerhebung und -auswertung vorzunehmen (Abschnitt 5.3). Zusätzlich zu den im Text integrierten Transkripten können die transkribierten Daten als Anhang auf der Webseite des Buches unter https://www.degruyter.com/document/isbn/9783110727845/html als Zusatzmaterial eingesehen werden. Nach einer datenbasierten Einführung in das Konzept der Positionierung, wie es für die vorliegende Studie verwendet wird (Kapitel 6), schließt sich der analytische Teil an, in dem zunächst die Positionierungspraktiken beschrieben werden, mit denen die Teilnehmenden der Studie Vergemeinschaftung und Distinktion herstellen (Kapitel 7). Darin wird analysiert, wie sie mit viel (Abschnitt 7.1) bzw. weniger Wissen (Abschnitt 7.2) in Bezug auf einzelne Serien interaktiv umgehen sowie welche Gruppendynamiken sich diesbezüglich ergeben können (Abschnitt 7.3). Anschließend wird der Blick erweitert und es wird der Gegenstand einbezogen. So ist für Kapitel 8 die Frage analyseleitend, an welchen Vorstellungen sich die Teilnehmenden orientieren, wenn sie sich in Bezug auf Serien positionieren (Abschnitte 8.1, 8.2 und 8.3). In Kapitel 9 wird als ein Ergebnis der Studie das heuristische Analysemodell erläutert und anhand einer Fallstudie zu der Serie Game of Thrones (Abschnitt 9.1) expliziert. Anschließend werden in Kapitel 10 das Modell und die Erkenntnisse der Studie methodologisch, in Bezug auf den Forschungsstand und das Objekt, Wissen und Bewertungen sowie die Positionierungen der Rezipient*innen reflektiert sowie weitere Forschungsperspektiven und didaktische Überlegungen skizziert. In dieser Arbeit wird eine inklusive Sprache genutzt und das Gender-Sternchen bzw. Partizipialkonstruktionen für soziale Kategorien verwendet.