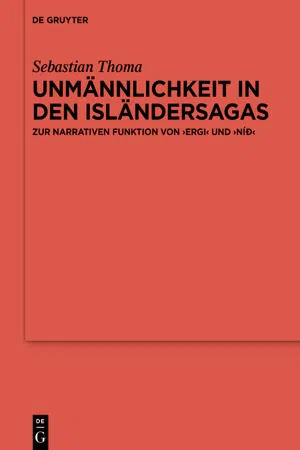Unter den Begriff Isländersagas (isl. Íslendingasögur) fallen je nach Zählweise etwa 30 bis 40 längere Prosaerzählungen, die im Hoch- und Spätmittelalter in Island verfasst wurden und sich mit der Geschichte seiner Bewohner auseinandersetzen.1 Dazu gesellen sich mehrere kürzere Texte, die kaum die Länge einzelner Kapitel überschreiten und demzufolge Íslendingaþættir genannt werden, nach dem isländischen Wort þáttur ›Teil, Abschnitt‹.2 Zeitlich beziehen sich diese Texte auf eine Vergangenheit, die zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift bereits um mehrere hundert Jahre zurück lag, die sogenannte söguöld, die Sagazeit, in der sich schwerpunktmäßig ihre Handlung vollzieht. Historisch reicht sie von der Einrichtung des alþingi, des zentralen nationalen Gerichts, um das Jahr 930 herum bis kurz nach der Einführung des Christentums um etwa 1000. Bisweilen reichen die Erzählungen zurück bis in die Landnahmezeit ab etwa 870.
Als ein zentrales Element ihrer literarischen Tradition verbindet die Isländersagas das Interesse an den Narrativen über soziale Konflikte. So wird als eines ihrer Hauptaugenmerke häufig die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft identifiziert und hervorgehoben.3 Art und Häufigkeit solcher Auseinandersetzungen könnten dazu verleiten, die Isländersagas auf die Formel »Bauern prügeln sich«4 herunterzubrechen, was diesen Texten jedoch nicht gerecht werden würde. Die Thematisierung von Erschütterungen innerhalb eines Sozialsystems allein begründet freilich noch nicht ihre herausgehobene Stellung innerhalb der Weltliteratur, werden soziale Konflikte doch stets »entlang von narrativen Feldlinien choreographiert«.5 Vielmehr hat die Art und Weise, in der die Aufarbeitung dieser Konflikte geschieht, viel Beachtung gefunden. So dienen die Sagas nicht nur dem Erzählen von Geschichten, sondern auch von Geschichte, die durch den Akt des Erzählens entsteht und Wirklichkeit erlangt.6 Eine literarische Besonderheit der Sagas ist ihr oft als »objektiv« beschriebener und bisweilen befremdlich distanziert wirkender Stil.7 Die historischen Rahmenbedingungen auf Island dienten den Schreibern der Isländersagas dabei als Folie für eine literarische Gesellschaft, die für uns heutige Rezipierende seltsam ›anarchisch‹ in dem Sinne anmutet, dass sie auf den ersten Blick ohne staatliche Ordnungsmacht auszukommen scheint. Das ist ein Eindruck, den wir an gegebener Stelle noch etwas relativieren werden, der sich dennoch darin niederschlägt, dass die dargestellte Gesellschaft wie ein sehr fragiles und störungsanfälliges Gebilde wirkt. Daneben fixieren sich die Sagas auf die ›Störer‹, die dieses Gebilde destabilisieren, um im Idealfall eine Veränderung des Gefüges zum eigenen Vorteil zu erreichen.8 Resultat dieser Fixierung ist vor allem die auffällige Häufung von notorischen Störenfrieden und Unruhestiftern unter den Hauptfiguren der Isländersagas. Das vorliegende Buch macht es sich zum Schwerpunkt, eine der »narrativen Feldlinien« von Konflikten in ihrer Inszenierung und ihrer Wirkung auf die handelnden Figuren und die Erzähler durch das Untersuchungscorpus hinweg zu verfolgen: Die Betrachtung liegt auf verschiedenen Aspekten der (literarischen) Instrumentalisierung von Männlichkeitsbildern im Rahmen der beiden Konzepte ergi und níð. Deren Funktionalität und hohe Effektivität beim Management von Konflikten innerhalb der Erzählungen ist nicht zuletzt in den realhistorisch vorauszusetzenden Geschlechterkonventionen und dem etablierten Fehdewesen zu suchen. Vor einer Untersuchung dieser Konzepte im Erzählkontext der Isländersagas müssen jedoch zunächst einige Gesichtspunkte terminologischer, theoretischer und wissenschaftsgeschichtlicher Natur erläutert werden.
1.1 Homosexualität in den Sagas? Vorüberlegungen zu einer ›Terminologie der Unmännlichkeiten‹
Eine Arbeit mit dem gewählten Fokus auf einem so vielfältig auslegbaren Begriff wie ›Unmännlichkeit‹ geriete ohne eine vorweggeschickte ernste Auseinandersetzung mit den in ihr zu verwendenden Begrifflichkeiten schnell auf terminologisch unsicheres Terrain. Das zeigen schon die vorliegenden altnordischen Wörterbücher, die als Übersetzung für den zugrunde gelegten Begriff ergi vornehmlich Wörter aus den Feldern ›Unmännlichkeit‹9 und ›Sexualität‹ anbieten und damit eine enge Interpretationsrichtung vorgeben.10 Zu verlockend ist es, vermeintlich passende Begriffe unreflektiert zu verwenden, die mit diesem Themenfeld in Zusammenhang stehen. Neueren Untersuchungen in geisteswissenschaftlichen Nachbardisziplinen, die sich mit den Abweichungen von den jeweils vorherrschenden sexuellen Normen in der Geschichte auseinandersetzen, ist durchaus eine gewisse Vorsicht in Hinblick auf die zu verwendende Terminologie anzumerken.11 Die möglichen Fallstricke von modernen Assoziationen mit einzelnen Begriffen, die auf einen vormodernen Kontext angewendet werden, ergeben sich schon dadurch, dass die konkrete Untersuchung dieser komplexen Thematik wissenschaftsgeschichtlich eine vergleichbar junge Erscheinung ist. Das gilt vor allem in Hinblick auf gleichgeschlechtliche Lebensweisen und deren Betrachtung aus einem explizit neutralen Blickwinkel, wurden solche Betrachtungen doch erst mit nach und nach durchgesetzter gesellschaftlicher und juristischer12 Enttabuisierung möglich.
Das Ausmaß von bis in die Gegenwart reichenden Stigmatisierungen wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Begriffe unterschiedlichster Konnotationen es zu diesem Themenfeld gibt, und wie stark sie teilweise von den gesellschaftlichen Anschauungen ihrer Entstehungs- und Verwendungszeit geprägt sind. Viele der in den letzten Jahrzehnten gebrauchten Begriffe scheinen wenig tauglich für eine objektive Betrachtung der gemeinten Phänomene zu sein: Dazu gehören vor allem solche Wörter, die nicht allein für den gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr geprägt, aber häufig in diesem Zusammenhang gebraucht wurden, wie ›Sodomie‹13 und ›Perversion‹. Bis heute gebräuchlich ist hingegen der 1869 vom Arzt Karoly Maria Benkert geprägte griechisch-lateinische Begriff ›Homosexualität‹, der eng verbunden ist mit der Entpathologisierung von bis dahin kriminalisierten Menschen.14 Aufgrund dieses klinisch-pathologischen Ursprungs (Benkert ordnete Homosexualität als Krankheit ein) und der Fokussierung auf den Geschlechtsverkehr wird dieser Begriff heute von manchen abgelehnt.15 Doch auch die stattdessen synonym gebräuchlichen Wörter »lesbisch« und »schwul« sind ebenfalls ursprünglich diskriminierend gewesen und behalten teilweise bis heute – vor allem in der Jugendsprache – ihren pejorativen Duktus bei. In Abkehr von der ursprünglichen negativen Bedeutung stellen diese beiden Begriffe als Selbstbezeichnung sehr häufig Bezeichnungen für als politisch empfundene Identitäten dar.16
Diesen gesellschaftlichen Wandel in der Wahrnehmung von Homosexualität als einer eigenen ›Kategorie‹ menschlicher Identität fasst Michel Foucault in einem oft angeführten Zitat zusammen:
Der Homosexuelle des 19. Jahrhunderts ist zu einer Persönlichkeit geworden, die über eine Vergangenheit und eine Kindheit verfügt, einen Charakter, eine Lebensform, und die schließlich eine Morphologie mit indiskreter Anatomie und möglicherweise rätselhafter Physiologie besitzt. Nichts von all dem, was er ist, entrinnt seiner Sexualität.17
Dabei geht es nicht darum, dass ihm zufolge homosexuelles Verhalten in der Vormoderne undenkbar wäre, sondern homosexuelle Identität im heutigen Sinne.18 In Abgrenzung zum fragmentierten Bild von heute oft als homosexuell wahrgenommenen Merkmals- und Verhaltenskategorien im Mittelalter fasst Foucault in Hinblick auf das Bild vom Sodomiten pointiert zusammen: »Der Sodomit war ein Gestrauchelter, der Homosexuelle ist eine Spezies.«19 Damit weist er auf die Probleme hin, die sich bei der Beschreibung des inneren Zustandes vormoderner Subjekte ergeben, da lediglich moderne Subjekte nach unserem Verständnis sexualisiert seien, wobei die von ihm postulierte Trennschärfe zwischen Vormoderne und Moderne durchaus diskutiert wurde.20
Ein Vorschlag zur Überwindung des Abgrundes zwischen dem Foucault’schen Sodomiten und dem modernen Homosexuellen, der eine analytische Beschreibung vormoderner Subjekte zulässt, stammt von David Halperin. Auf der Grundlage bisheriger Forschungen im Bereich der Sozial- und Geschichtswissenschaften skizziert er ein begriffliches Instrumentarium, das zur Annäherung an geschlechtliche Devianz dient.21 Objektiv beschreibbare Abweichungen von der männlichen Geschlechternorm in einem historischen Kontext lassen sich ihm zufolge unter dem Begriff »prähomosexuelle Kategorien« zusammenfassen.22 Der Vorteil einer solchen Kategorisierung ist, dass so mehrere Phänomene begrifflich vereint sind, die nicht alle mit Homosexualität zu tun haben, aber eine Normüberschreitung darstellen, ohne dass der moderne Homosexualitäts-Begriff für diese Abweichungen verwendet und gegebenenfalls in semantischer Hinsicht überstrapaziert werden muss. Sie kommen dem gestellten Problem des vorliegenden Buches, nämlich die Untersuchung von sogenannter ›Unmännlichkeit‹ in einem mittelalterlichen Kontext, wesentlich näher als eine Reduktion der Kategorie ›Unmännlichkeit‹ auf männliche Homosexualität. Ein generelles Problem des Begriffes, wie Halperin ihn fasst, ist, dass viele Aspekte ausschließlich auf Männer zutreffen, so dass seine »prähomosexuellen Kategorien« nicht praktikabel für alle Geschlechter sind. Stattdessen gibt es einen neutralen Begriff, der alle denkbaren geschlechtlichen Abweichungen in sich vereint, nämlich das englische Wort »queer«, das eigentlich eine alte Entlehnung aus dem Deutschen darstellt und der in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts entstandenen wissenschaftlichen Theorie der Queer Studies den Namen gab.23 Ursprünglich bedeutete es so viel wie ›verquer‹ und war »auch als abfälliger, umgangssprachlich Ausdruck für ›schwul‹ u...