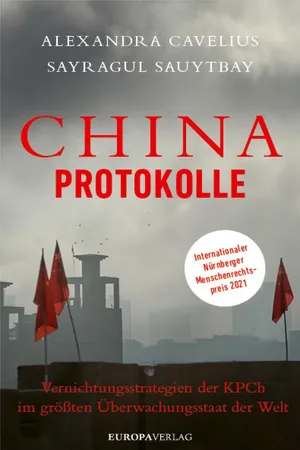![]()
DINA NURDYBAY – HAUPTZEUGIN FÜR KINDERLAGER UND ZWANGSARBEIT
Gefeiert für ihre Kreationen in der Modebranche, beklatscht im Blitzlichtgewitter der staatlich gelenkten Presse und von internationalen Preisen gekrönt: Die 29-jährige kasachische Modedesignerin Dina Nurdybay feierte große Erfolge und kletterte auf der Karriereleiter immer weiter nach oben.
»Ich war modern, aufgeschlossen, multikulturell – mehr Chinesin als Kasachin«, sagt sie über sich selbst und berichtet über ihr regenbogenbunt gefärbtes Haar, das sie nach dem Schaulauf auf dem Catwalk noch ein halbes Jahr lang getragen hat. Völlig überraschend wird sie im Oktober 2017 festgenommen und in elf Monaten durch sieben Lager geschleust, ohne jemals den genauen Grund für diesen Albtraum zu erfahren. »Jeder Tag dort war voller Angst«, blickt sie zurück.
Durch den ständigen Wechsel der Lager erlebte Dina Nurdybay als Zeugin die unterschiedlichsten Schicksale und Perspektiven – ob als Tänzerin in einem Propagandafilm der KPCh, als Putzfrau in einem Kinderlager oder als Zwangsarbeiterin in einer riesigen Industriehalle, eingesperrt mit anderen Näherinnen in einem Eisenkäfig. Sie sah zwölfjährige halb verhungerte Mädchen, die sich für ein Stück Schokolade verkauften, psychisch gebrochene Studentinnen, die das Lager nicht mehr verlassen wollten, und heiratswillige Chinesen, die vor dem Gefängnistor auf die entlassenen Frauen warteten.
»Das Lager war die Hölle! Was aber danach folgte, war noch schlimmer«, beschreibt Dina den einsetzenden Psychoterror der Kader.
Dina Nurdybay
Mitten aus dem Leben gerissen: erfolgreich, multikulturell, modern
Elf Monate lang hat mich die chinesische Regierung in sieben verschiedenen Lagern eingesperrt, in meinem Landkreis Nilka, im Kasachischen Autonomen Gebiet Ili in Xinjiang. Von heute auf morgen bin ich mitten aus meinem Leben herausgerissen worden.
Damals war ich 24 Jahre alt, eine sehr erfolgreiche Modedesignerin, hatte viele Preise und Wettbewerbe gewonnen, arbeitete mit den bekanntesten Künstlern, Theater- und Opernhäusern in der Landeshauptstadt Urumqi zusammen und hatte gerade meine Geschäfte weiter ausgebaut. Unter meinen Freunden, Bekannten und Mitarbeiterinnen waren Chinesen, Uiguren, Dunganen, Kirgisen und natürlich auch Kasachen wie ich. Ich fühlte mich wohl und glaubte, in einer modernen, multikulturellen Gesellschaft zu leben.
Da ich oft im Fernsehen auftrat und alle großen Medien über mich berichteten, war ich eine angesehene Persönlichkeit. Im Alter von zehn Jahren hatte ich bereits angefangen, Chinesisch zu lernen. Ich schätzte chinesisches Essen und meine chinesischen Kollegen, deshalb habe ich mich regelmäßig mit ihnen in China-Restaurants getroffen.
Manche meiner uigurischen Mitarbeiterinnen waren strenggläubige Frauen mit Kopfbedeckung, die fünfmal täglich ihre Gebete verrichtet haben. Untereinander haben wir uns aber nicht an unserer Glaubensrichtung, sondern an unseren Leistungen gemessen und uns gegenseitig respektiert.
Im Spaß haben mich die Uigurinnen oft aufgezogen: »Du bist viel zu modern und zu modebewusst. Du bist keine Kasachin mehr, du bist fast schon chinesisch.« Vor dem ersten Bissen am Esstisch hatte ich höchstens mal »Bismillah« gesagt, das war auch schon alles mit meiner Religiosität. Ich habe gerne schicke Kleider und dazu hohe Schuhe getragen.
Trotz meiner Erfahrungen im Lager bin ich bis heute noch weit davon entfernt zu behaupten, dass Chinesen schlechte Menschen sind. Allgemein gibt es für mich nur gute und schlechte Menschen auf der Welt.
Gäbe es aber eine Rangordnung für schlechte Regierungen, stünde die KPCh als schlechteste an erster Stelle.
Nichts mitbekommen vom geplanten Vernichtungsfeldzug
Vor meiner Inhaftierung hatte ich nur beiläufig gehört, dass Uiguren »zum Studienzweck« fortgezogen seien. Ich hatte keine Ahnung, dass bereits ein Vernichtungsfeldzug Pekings gegen uns Muslime im Gange war. Von morgens bis spätnachts bin ich in meiner Schneiderwerkstatt gestanden, habe Modelle entworfen und war völlig in meiner eigenen Welt versunken. Für mich als Kasachin stand stets der Erfolg und die Unterstützung meiner Familie im Vordergrund, daher lautete mein Motto: »Wenn du einen Tag freinimmst, hast du Tausende andere verloren.« Beruflich ging es bei mir immer um alles oder nichts, um Konkurrenz oder Wettbewerb, aber nie darum, das Leben zu genießen. Meine Arbeit war meine ganze Leidenschaft.
Die Auflagen für muslimische Geschäftsleute hatten sich in meiner Heimatstadt zunehmend verschärft. Fragte man bei den Behörden nach den Gründen, so hieß es, dass seien die Regeln der freien Marktwirtschaft, Verwaltungsmaßnahmen oder schlicht »die neue Geschäftsordnung«.
In meinen Läden musste ich seit 2016 Alarmsysteme installieren und eine Reihe von Propagandaplakaten und Partei-Anweisungen aufhängen, darunter: Stets der Kommunistischen Partei treu dienen und nicht politisch aktiv werden; außerdem musste ich vor dem Laden eine chinesische Fahne aufhängen. Erst im Lager habe ich verstanden, dass all diese bürokratischen Maßnahmen bereits der Beginn eines geplanten Völkermords waren.
Wir Kasachen in Xinjiang waren bekannt als braves, angepasstes Volk, wir wollten in Frieden leben und hatten mit Politik nichts am Hut. Hätte ich vorher von der drohenden Gefahr Wind bekommen, wäre ich rechtzeitig ins Ausland nach Kasachstan abgehauen. Ich hatte meinen Pass, genug Geld, und meine Eltern waren dorthin bereits umgesiedelt.
14. Oktober 2017: »Wir holen dich ab!«
Bis Mitternacht hatte ich noch einige Bestellungen von Großabnehmern abgearbeitet, anschließend fiel ich todmüde ins Bett. Am Morgen darauf, am 14. Oktober 2017, entdeckte ich auf meinem Anrufbeantworter viele verpasste Anrufe der örtlichen Polizeistation. Auf einmal klingelte wieder das Telefon. »Bleib, wo du bist! Wir holen dich ab.«
»Es geht sicher um meine Reisegenehmigung«, vermutete ich. Nach fünf Jahren Schufterei hatte ich nämlich endlich die Zusage für einen staatlich geförderten sechsmonatigen Aufenthalt zum Erfahrungsaustausch mit anderen bekannten Designern, nahe Peking, bekommen.
Kurz darauf erschienen zwei kasachische Sicherheitsleute in meinem Haus, legten mir zu meinem Erstaunen Handschellen an und brachten mich im Auto zur Polizeidirektion in meiner Stadt Nilka. »Was ist los?«, fragte ich verstört. »Als wir das letzte Mal dein Handy überprüft habe, gab es ein kleines Problem«, beruhigte mich einer, »in spätestens zwei Stunden haben wir das geklärt.«
Der Raum in der Polizeistation war voller Monitore, Kameras und Computer. Etwa eine halbe Stunde wartete ich alleine an einem Tisch und verfolgte auf den Bildschirmen, wie sie gruppenweise sehr viele Männer und Frauen im Hof sortiert und in Handschellen in verschiedene Autos geladen haben.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, warum dort so viele Menschen waren. Erst später habe ich erfahren, dass die örtlichen Behörden Geldprämien dafür erhalten haben, wenn sie regelmäßig eine Liste verdächtiger Menschen bei der Polizei abgaben. Den Polizeibeamten wiederum war egal, wer in welchem Lager landete. Hauptsache, ihre Zahlen stimmten.
Während ich da in Handschellen im Büro saß, rekonstruierte ich krampfhaft, was in letzter Zeit vorgefallen war. Am 8. Februar 2017 war ich, wie so oft, auf Besuch zu meinen Eltern nach Kasachstan gereist. Etwa sieben Monate später hatte mich die Polizei im September einbestellt, um mein Handy an ihrem Computer auszulesen. Da sie nichts Auffälliges entdeckt hatten, hatten sie mich aber wieder gehen lassen.
Einige Tage später jedoch nahmen sie mehrere Fotos von mir in der Polizeistation auf. Einmal frontal und einmal von der Seite, jeweils vor einer weißen Wand. »Warum braucht ihr das?«, fragte ich. »Nur so …«, sagten sie. Das waren Leute, die ich aus meiner Stadt kannte, deshalb wagte ich noch mal nachzuhaken: »Sagt doch …« Daraufhin rückten sie damit heraus, dass sie die Daten aller jungen Leute sammelten, die über die Grenze gereist waren.
Mit einem Mal schreckte ich aus meinen Erinnerungen hoch, weil hinter mir ein lauter Befehl ertönte: »Alle Frauen raus!« Zwei Sicherheitsleute brachten mich in den Hof und erklärten mir: »Das Gespräch findet im Bezirkszentrum statt.«
Unterwegs gabelten sie eine weitere Frau auf. Die Bäuerin kam direkt aus dem Stall, ihre Kleidung war verdreckt. Sie hieß Kargul und war zwischen 30 und 40 Jahre alt. Als sie ihr Handschellen anlegen wollten, hat ihr Schwiegervater voller Bitterkeit gesagt: »Sie wird euch schon nicht weglaufen.« Es war Vormittag, gegen 10:30 Uhr.
Auf der Fahrt stellte diese Bauersfrau immer wieder Fragen an die Polizisten: »Wie lange bleiben wir weg? Ich muss meine beiden kleinen Kinder von der Schule abholen.« Ich rutschte hin und her und war ebenfalls sehr nervös, weil ich wichtige Termine hatte. Der kasachische Sicherheitsbeamte neben mir reichte mir sein Handy und meinte: »Es kann sein, dass dein Aufenthalt viel länger als geplant sein wird.« Deshalb sollte ich dringende Arbeiten schnell telefonisch erledigen.
Sofort habe ich meinen Freund verständigt, ihn gebeten, die Stoffe zu bestellen und alles Weitere zu regeln. »Eventuell bin ich eine Weile weg.« Daraufhin gab er zurück: »Denke jetzt nicht an deine Arbeit, Dina, sondern nur an dich …« Gleich darauf sprang er in seinen Wagen und folgte dem Polizeiauto, um zu erfahren, wo sie mich hinbrachten.
»Ich muss zurück ins Geschäft«, dachte ich verbissen. Vom Staat hatte ich 2016 einen Förderkredit erhalten, den ich binnen zwei Jahren zurückerstatten musste. Das erste Jahr hatte ich längst erfolgreich abbezahlt, aber wie sollte ich im zweiten Jahr meine Schulden tilgen, wenn sie mich jetzt längere Zeit festhielten?
Seit etwa zehn Jahren entwarf ich eigene Modelle, kaufte Stoffe, schnitt und nähte. Dabei hatte ich mich auf Tourismusprodukte sowie die Nationaltracht der Kasachen für Liebhaber, Tänzer und Künstler spezialisiert und sogar mein eigenes Label gegründet. Zwei große Läden hatte ich in Nilka aufgebaut, einen 400 m2 großen Raum gemietet, dort Nähmaschinen aufgestellt und 30 Näherinnen, fünf Designer und zwei Führungskräfte beschäftigt. Sogar aus Kasachstan hatte ich Bestellungen entgegengenommen von Sängern, die bei uns Konzerte gaben. Meine verzierten Decken und Teppiche waren beliebte Hochzeitsgeschenke. Im Monat verdiente ich umgerechnet rund 17 000 US-Dollar.
Niemals hatte ich Einschränkungen seitens der chinesischen Behörden erlebt, weil ich kasachische Nationaltrachten herstellte. Das war auch gar nicht verboten. Im Nachhinein aber habe ich überlegt, ob mir die Kader deshalb nationalistische Gedanken unterstellt haben.
Während ich im Lager war, haben sie mich enteignet, meine Werkstatt auseinandergenommen, einen Schuldenberg unter mir aufgetürmt und mich am Ende darauf sitzen lassen. Dann haben die Kader alle meine wichtigen Social-Media-Accounts gelöscht, die ich beruflich genutzt hatte. Alle Fotos weg. Als hätte ich nie existiert.
Zwölf Tage: Wie die Hühner auf der Stange
Als sich das schwarze Eingangstor hinter mir schloss, parkte mein Freund auf der gegenüberliegenden Seite und wartete. Wie eine Herde Schafe trieben uns die Sicherheitsbeamten ins Gefängnis in einen dunklen Saal hinein, der bereits mit Männern und Frauen vollgestopft war. Die Bauersfrau neben mir hat angefangen zu weinen. »Ich war schon mal an diesem Ort, hier kommt man nur schwer wieder raus.«
Die Wachen verteilten uns nach Wohnort und Geschlecht, dann befahlen sie uns: »Gebt euren Schmuck, Gürtel und alle metallhaltigen Sachen ab!« Ich legte Ohrringe und Ringe ab, dazu auch ein Halscollier mit wertvollen Steinen, das ich nie wiedergesehen habe.
Während sie den Männern Säcke über die Köpfe zogen, erhielten wir Frauen rosafarbene Sportanzüge, in die wir sofort hineinschlüpfen sollten. Danach pferchten sie mich mit etwa 30 anderen Frauen in einen düsteren, feuchten Raum. Das Fenster war zugeklebt. Über der Tür war ein Spalt, der schwaches Licht hereinließ.
Vor Kälte zitterte ich, weil ich nur T-Shirt und eine Hose anhatte. Zum Glück hatte mein Freund als erfolgreicher Händler überall Kontakte und nutzte diese aus, um mit dem Personal vor Ort zu sprechen. Am dritten Tag ist es ihm gelungen, mir eine Jacke und einen Pullover zukommen zu lassen.
Ab dem zweiten Tag reichten sie uns etwas zu essen. Zu fünft oder zu sechst teilten wir uns ein Brot und löffelten Brühe. Nach einigen Tagen teilte man uns erneut in Gruppen mit jeweils zwölf Personen auf und steckte uns in andere dunkle Räume. Tagsüber hockten wir zwölf Frauen wie die Hühner aneinandergereiht auf breiten Holzbänken, wo unsere Füße herunterhingen. Am Ende der Bank erledigten wir unsere Bedürfnisse in einen Eimer. Abends legten wir uns auf der hinteren Seite der Holzbänke zum Schlafen. Die ersten Nächte habe ich kein Auge zugemacht.
Zu dieser Zeit fand in Peking der 19. Parteitag statt. Von den Wachen erfuhren wir, dass wir alle aufgrund unserer Verbindungen ins Ausland eine Gefahr fü...