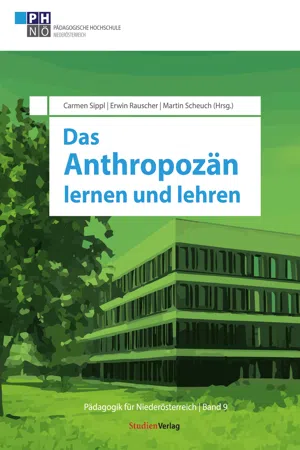![]()
III. DAS ANTHROPOZÄN …
LERNEN & LEHREN
– oder:
Gegen den Strom führt immer zur Quelle
![]()
Heidelinde Balzarek
Das Anthropozän im Fokus des ästhetisch-künstlerischen Forschens
1. Ästhetisch-künstlerisches Forschen
1.1 Verortung des Begriffs in der Didaktik
In unterschiedlichen Diskursen und Debatten werden Kunst und Wissenschaft, im konkreten inhaltlichen Kontext in diesem Beitrag die Naturwissenschaften, als ein Gegensatzpaar dargestellt und durch ihre Verbindung konterkariert. Beide Bereiche verfügen über gemeinsame Schnittmengen und bilden Synergien, die in diesem Beitrag unter dem Aspekt der ästhetischen/künstlerischen Forschung betrachtet werden. Beiderseits lässt sich das Interesse an Erkenntnisgewinn und Wissensvermehrung fokussieren, wobei sich Wissen in diesem Fall sinnlich und körperlich manifestieren kann und sich in Folge als ein fühlbares und gefühltes Wissen etabliert.1 Lyotard prägte den Begriff des „dichten Wissens“, auf den Christoph Schenker Bezug nimmt2. Dieses „Wissen als Bildung“ ist nicht mit Wissenschaft zu egalisieren und ist nicht auf Erkenntnis reduziert, sondern durch ein dichtes Geflecht von Kompetenzen charakterisiert, was einen besonderen Angelpunkt in der Pädagogik darstellt. Diese Kompetenzen meinen ein Denken, Machen und Handeln, die sich nicht nur am Kriterium der Wahrheit, sondern ebenso an den Kriterien der Gerechtigkeit und des Glücks, der Richtigkeit (Schönheit, Interessantheit) und der Effizienz orientieren.3 Im Zusammenhang mit dem Anthropozänkonzept soll dieses Wissen in Folge durch ästhetisch-künstlerisches bzw. kulturelles Forschen etabliert werden, das die Mensch-Natur-Beziehung betrifft.
Seit 2012 existiert eine Definition für ästhetisch-künstlerisches Forschen, die in einem Thesenpapier im Rahmen einer Tagung mit dem Titel Forschung zwischen Kunst und Wissenschaft. Herausforderungen an Diskurse und Systeme des Wissens im Haus der Kulturen der Welt in Berlin festgelegt wurde, um eine Basis für Förderstrukturen in diesem Bereich zu konstituieren.4 Aus pädagogischer Sicht lässt sich auf das Konzept der ästhetischen Forschung nach Helga Kämpf-Jansen auf Grundlage der „Fünfzehn Thesen zur Diskussion“5 Bezug nehmen, das in den letzten Jahren kontinuierlich in der Unterrichtsrealität erprobt, umgesetzt und weiterentwickelt wurde und wird und damit das Fach „Bildnerische Erziehung“ eine Vorreiterrolle innerhalb der Unterrichtsentwicklung einnehmen lässt. Durch das ästhetisch-künstlerische Forschen wird es möglich, sich mit künstlerischen Methoden und Techniken über individuell differenzierte Zugänge transmedial naturwissenschaftlichen Themenfeldern anzunähern, diese aufzugreifen, zu analysieren und unter Umständen zu verinnerlichen. Diese Praxis ermöglicht die Manifestation eines theoretischen Fundaments aus künstlerischer Perspektive für eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Anthropozän.
1.2 Fachspezifisches Wissen und künstlerisch-technische Kompetenzen
1.2.1 Individualisierter Zugang
Die konstruktivistische Didaktik bildet die Basis für das ästhetisch-künstlerische Forschen. Jede/r Lernende bringt ihre/seine eigene Wirklichkeit in das Studium mit ein. Aufgrund von biografisch unterschiedlicher Sozialisation durch kulturelle, religiöse, soziale und familiäre Prägungen werden unterschiedliche Themen der Naturwissenschaften und Kunst fokussiert oder vorgegebene Fragen aus divergenten Perspektiven betrachtet. Was bezeichnet das Anthropozän? Welche Auswirkungen lassen sich auf Mensch, Klima, Umwelt, Tiere, Organismen, … feststellen? Welches menschliche Verhalten ist für die Mensch-Natur-Beziehung förderlich? Welche Materialien belasten die Umwelt? U.v.m. Aufgabe ist es, die eigenen Vorstellungen zu reflektieren und individuelle Zielvorstellungen zu entwickeln. Die Heterogenität, die ebenso auf den Ebenen der Vorkenntnisse, der handwerklichen Fertigkeiten und der Reflexionsfähigkeit gegeben ist, sollte im Idealfall mit Hilfe einer Diagnosematrix oder eines Kompetenzrasters mit definierten Kriterien bereits in der Eingangsphase festgestellt werden. Dieser Schritt ist von elementarer Bedeutung, denn es wird der jeweilige Stand der Wahrnehmungssensibilität oder Reflexionsfähigkeit der Lernenden bestimmt.
1.2.2 Basiswissen und Kompetenzentwicklung
Die Studierenden an Hochschulen und Universitäten zeichnen sich durch eine Vielfalt an Kompetenzen aus, die sie durch heterogene Bildungsbiographien erworben haben. Im konkreten Fall des Curriculums der Primarlehrerausbildung muss bereits in den ersten Semestern genügend Raum und Zeit für den Erwerb eines breiten fachspezifischen Basiswissens in den Fachbereichen Bildnerische Erziehung und in den Naturwissenschaften angelegt werden, um bei den Studierenden durch diese praktische, künstlerisch-ästhetische Intervention einen eigenständigen Zuwachs an Kompetenzen evozieren zu können.6
1.2.3 Individualisiertes Lernen im Prozess
Die unterschiedlichen Herangehensweisen der Studierenden setzen eine fundierte Kenntnis von bildnerischen Kommunikationsformen, von künstlerischen Techniken, vom Einsatz unterschiedlicher Materialien und von Medien voraus, um auf ein umfangreiches Repertoire von Ausdrucksformen zugreifen zu können. Des Weiteren wäre eine kontinuierliche und vertiefte Auseinandersetzung mit Kunstgeschichte, aktuellen zeitgenössischen Kunstkonzepten und künstlerischen Strategien einzelner Künstler/innen eine ideale Voraussetzung. Das heißt, dieses Arbeiten verquickt traditionelle ästhetisch-praktische Verfahren wie Skizzieren, Modellieren, Malen, Drucken, Fotografieren und Experimentieren mit Entwicklung visueller Konzepte und Modelle, mit der Durchführung aufwendiger Filmprojekte, mit Konservierung, Restaurierung und Dokumentation.7 Ebenso ist eine fundierte fachliche Orientierung in den Naturwissenschaften notwendig.
1.2.4 Variation im Lernsetting
Die Zentralaufgabe von Unterricht und Lehre ist die individuelle Förderung des einzelnen Lernenden. Das Setting und die Organisation von Lernarrangements bzw. Lernbuffets soll die Selbstständigkeit der Studierenden unterstützen. Das Arbeiten in einer Werkstattoder Studiosituation oder in einer in Stationen organisierten Form wirkt auf ein kreatives Arbeitsklima. Die Lehrkraft sollte keine konkreten Ratschläge erteilen, sondern durch passende Fragen die Studierenden zu weiterführenden Fragestellungen und Aktionen motivieren. Die Studierenden nehmen eine fragende und entdeckende Position ein, die sie zu einer innovativen Wahrnehmung von Dingen und Phänomenen alltäglicher Erfahrung bringt. Ebenso setzen sie sich mit künstlerischen Strategien und Kunstkonzepten auseinander, die in ihre praktische Arbeit einfließen können. Fragen der Selbstorganisation bestimmen die nächsten Schritte wie die Planung, die Organisation von Arbeitsabläufen, den zeitlichen Rahmen der Fertigstellung, die positive Inklusion von Zufallsergebnissen betreffend. Durch solch offene Aufgabenstellungen lässt sich der Heterogenität in Lerngruppen gerecht werden und individuelle Förderung ist gegeben.8
1.2.5 Forschendes Lernen im Prozess
Im Fokus dieses methodischen Ansatzes im hier vorgestellten Beispiel steht der Prozess, also die künstlerisch-ästhetische Auseinandersetzung in Bezug zu Thematiken aus den Naturwissenschaften. „Ästhetik“ setzt Kämpf-Jansen nicht mit der philosophischen Kategorie des „Schönen“ in Verbindung, sondern bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung: sinnliche Wahrnehmung. Diese Forschung soll ausgehend von Themenfeldern der Naturwissenschaften „ästhetische Verhaltensweisen, Handlungs- und Erkenntnisformen“ ermöglichen. Damit bietet sich für die Studierenden ein vielfältiger, handlungsorientierter Umgang mit unterschiedlichsten Dingen an, wie z.B. Sammeln, Ordnen, Dekorieren, Arrangieren, Dokumentieren, Präsentieren. Grenzen von Kunst, Musik, Literatur und Film werden ausgelotet und es entstehen intermediale Produkte, welche die Perspektive über die Fachgrenzen in die Naturwissenschaften erweitern. Genauso kann von naturwissenschaftlichen Inhalten ausgegangen werden und diese können in künstlerisch-ästhetischer Form umgesetzt werden. Fragen nach Bedeutung und vertiefender Betrachtung werden aufgeworfen, die Beziehung von Mensch und Natur wird beleuchtet und im Prozess bearbeitet. Wie sich eine Fragestellung weiterentwickelt, ist von den Forschungsansätzen und deren Fortschritten abhängig. Jeder Arbeitsprozess verläuft individuell, manchmal fließend, dann wieder mit zahlreichen Brüchen. Die Konstitution und Orientierung des Individuums im Hier und Jetzt, im Anthropozän, sind ebenso Bestandteil der Auseinandersetzung wie auch zeitgeistige Fragen, z.B. die nach Erinnern und Vergessen und nach ästhetischem Denken.
1.2.6 Die Bedeutung der Sozialformen im Lernprozess
Von großer Bedeutung ist es, welche Sozialform in der Forschungsarbeit praktiziert wird. Die Studierenden müssen in ihrem Studium Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit erfahren, damit sie nicht nur die theoretischen Zugänge kennen. Es ist ratsam, die Sozialformen bewusst einzusetzen und auch thematisch einzugrenzen. Wissenschaftliche Methoden wie Erforschen, Recherchieren, Analysieren, Kategorisieren, Kommentieren, Einordnen und Vergleichen fließen ein. Kontexte der eigenen Forschung sind zu erarbeiten. Welche kunstgeschichtlichen, kunstwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Aspekte fundieren die Arbeit? Lassen sich Bezüge zu ausgewählten Werken der Kunst herstellen? An Bekanntes wird angeknüpft und individuell Neues entdeckt, während des Arbeitsprozesses können sich Flow-Phasen9 bei den Studierenden einstellen, die eine Form von Glücksgefühl zur Folge haben. Im Zentrum steht die Visualisierung subjektiver ästhetischer Erfahrungsund Erkenntnisprozesse und nicht ein Produkt traditioneller ästhetisch-praktischer Verfahren.10
1.2.7 Emanzipatorische Leistungsfeststellung und Beurteilung
Die dem Lernprozess immanenten Auseinandersetzungen zwischen Lehrenden und Lernenden und der Lernenden untereinander sind etablierte Elemente des künstlerisch-ästhetischen Forschens, um bei den Studierenden eine Haltung der Selbstorganisation und Selbstevaluierung zu entwickeln. Diese können im analogen Dialog, aber auch über digitale Kommunikationsebenen stattfinden. Die unterschiedlichen Arbeitsphasen werden nach gemeinsam erarbeiteten Kriterien bewertet. Individuell kann die Prozessdokumentation erfolgen. Ob in Portfolioform11, Prozess- oder Tagebuchform12, in digitaler oder analoger Form sollten die Studierenden für sich selbst frei entscheiden und begründen können. Zu Beginn kann von der/dem Lehrenden eine spezielle, einheitlich definierte Dokumentationsform für die gesamte Lerngruppe festgelegt werden. Eine individuelle Präsentation des Arbeitsprozesses innerhalb der Arbeitsgruppe kann ein weiteres Beurteilungskriterium für diese Methode sein. Im Idealfall sollte das ästhetisch-künstlerische Forschen mit einer Ausstellung der Arbeiten oder einer anderen Form der Präsentation in den digitalen Medien abschließen. Natürlich erfordert diese gemeinsame, abschließende Aktion eine umsichtige Planung, die oftmals gruppendynamischen Prozessen unterworfen ist. Die Rahmenbedingungen sowie die Verantwortlichkeiten sind festzulegen und performative Aspekte zu berücksic...