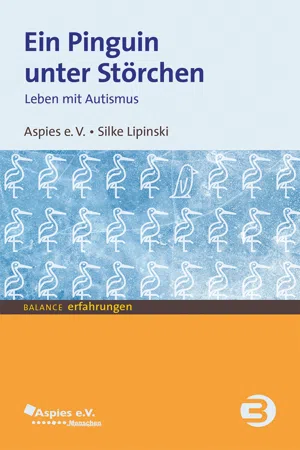![]()
Ein Pinguin unter Störchen
Tobias
Wenn ich Autismus in einem Satz zusammenfassen müsste, dann wäre es dieser: Autismus bedeutet für mich, ein Pinguin zu sein in einer Welt voller Störche.
Wenn ich genauer beschreiben soll, was Autismus für mich bedeutet, dann wird es schwieriger. Vor allem, weil ich seit dem letzten schweren Shutdown massive Probleme mit verbaler Kommunikation habe. Aber auch, weil das eine weitere Sache ist, die Autismus für mich bedeutet: Dieses ständige Spannungsfeld von entweder du erklärst dich deiner Umwelt, obwohl du gerade keine Energie für solche Erklärungen hast – oder du erklärst dich nicht und wirst erst recht nicht verstanden.
Ich bin 23 Jahre alt und hab schon im Kindergarten gemerkt, dass ich irgendwie anders bin als die anderen Kinder. Die anderen Kinder haben das natürlich auch gemerkt, genauso wie die Erwachsenen. Nur, dass die Erwachsenen es nicht wahrhaben wollten und deshalb so getan haben, als wäre ich normal. Aber ein Pinguin wird kein Storch, wenn man lange genug ignoriert, dass er nicht fliegen kann.
Ich rede nicht gerne über die Zeit vor der Autismus-Diagnose, die ich mit 21 dann endlich bekam, auch wenn es ziemlich viel zu erzählen gäbe. Aber ich verbinde mit dieser Zeit nicht so viele positive Gefühle. Es ist ein bisschen paradox, wenn Tierquälerei eine Straftat ist und gesellschaftlich geächtet wird, aber man Kinder, die einfach anders sind, immer wieder dazu zwingt, sich zusammenzureißen und sich anzupassen. Einen Menschen mit Asperger-Syndrom dazu zu zwingen, sich um jeden Preis »normal« zu verhalten, ist, als würde man einen Pinguin dazu zwingen, zu fliegen. Kein Mensch käme auf die Idee, einen Pinguin von der Klippe zu stürzen, damit er endlich anfängt zu fliegen. Ich und viele andere Menschen mit Autismus werden täglich von dieser Klippe gestürzt und gezwungen, normal zu sein und sich anzupassen. Und das ist weder gesund noch spaßig noch fair.
Manchmal bin ich wütend, dass so viel so lange so schiefgelaufen ist. Dass es so lange gedauert hat, bis ich erkennen konnte, wer ich bin. Bis ich akzeptieren konnte, dass ich bin, wie ich bin. Und dass es wohl noch eine Weile dauern wird, bis auch andere mich so akzeptieren werden, wie ich bin. Manchmal finde ich es traurig, dass das Leben sich so oft wie ein Kampf anfühlt. Ein Kampf, den außer mir kaum einer sieht. Denn kaum jemand rechnet damit, dass jemand, der mit 16 Jahren ein Einserabitur gemacht hat, an den acht Minuten Straßenverkehr auf dem Weg zur Hochschule scheitern kann. Oder dass jemand, der mit zwanzig Jahren sein erstes Buch geschrieben hat, spätestens nach zehn Minuten Small Talk Kopfschmerzen bekommt.
Von außen wirke ich manchmal wie der totale Überflieger. Und ja, vieles fällt mir ziemlich leicht. Ich denke schnell, ich habe ein außergewöhnlich gutes Textverständnis und lese Mathebücher, als wäre es Unterhaltungsliteratur. In vielen Univorlesungen hatte ich Topnoten, obwohl ich gar nicht in den Vorlesungen war, und wenn ich dann doch mal ein Seminar besuchte, weil es Anwesenheitspflicht gab, dann konnte es schon passieren, dass ich mir mit dem Dozenten eine ziemlich krasse fachliche Diskussion lieferte, während der Rest einfach zuschaute oder sogar teilweise mitschrieb. Das ist die eine Seite von mir. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Das ist dann der Typ, der, wenn er von der Hochschule kommt, erst mal in sein Bett fällt und eine Stunde schlafen muss, selbst wenn es erst morgens um elf ist. Das ist der Typ, der die Krise kriegt, wenn sich die Verpackung seiner Lieblingskekse ändert oder jemand anders auf »seinem« Parkplatz geparkt hat (der als solcher natürlich gar nicht gekennzeichnet ist). Das ist der Typ, der keine Überraschungen mag, selbst wenn sie positiv sind. Und der Typ, der total gerne zum Fußballtraining gehen würde, aber völlig gestresst ist von den Spielpausen, in denen man am Spielfeldrand sitzt und irgendwie rumredet. Das ist der Typ, der manchmal lieber tagelang hungert, als einkaufen zu gehen, und der Typ, der Angst hat, irgendwann nicht mehr die Kraft zu haben, den Alltag zu bewältigen, und dann vom Einserabiturienten zum Langzeitarbeitslosen zu werden.
Es gab eine Zeit, in der ich Bundeskanzler werden wollte oder zumindest Bundestagsabgeordneter. Aber wie soll ich in einer Stadt wie Berlin zurechtkommen, wenn schon ein durchschnittlicher Supermarkt in der Lage ist, mich sensorisch bis an den Rand eines Nervenzusammenbruchs zu treiben?
Ich habe wirklich viele Begabungen und Talente und ich habe ein Feuer und eine Energie in mir, die andere umhauen können. Wenn ich von einer Sache begeistert bin, wenn ich wirklich etwas will, dann kann mich fast nichts mehr aufhalten. Ich sage: fast. Denn was andere Menschen selbst mit größter Anstrengung nicht schaffen, schafft mein Autismus immer wieder. Mein Autismus, der mir einfach den Strom ausschaltet, wenn ich mehr will, als mein Reizverarbeitungssystem verkraftet. Overloads. Shutdowns. Zusammenbrüche. Völliges Verstummen. Handlungsunfähigkeit. Massive Anspannung bei gleichzeitiger Bewegungsunfähigkeit. Einmal ist das Ganze sogar so eskaliert, dass ich deswegen in der Notaufnahme gelandet bin.
Mittlerweile erkenne ich die Warnzeichen und Stoppschilder, die mein Körper und mein Gehirn mir zeigen, wenn ich kurz vor einem Overload stehe, aber Erkennen bringt gar nichts, wenn man nicht entsprechend handelt. Ich weiß, wie wichtig es wäre, auf diese Warnzeichen entsprechend zu reagieren, Termine abzusagen, mich zurückzuziehen, aber ich tue es selten – und wenn, dann meistens zu spät. Und das aus dem einfachen Grund: weil es mir immer noch schwerfällt zu akzeptieren, dass mein Autismus eben auch eine Behinderung ist. Weil ich nicht langsamer machen möchte. Weil ich keine Schwäche zeigen möchte. Und weil wir in einer Welt leben, in der Autisten selten das Verständnis bekommen, das sie brauchen.
Was für andere leicht ist, ist für mich schwer. Und umgekehrt. Meine Kommilitonen kämpfen mit Hausarbeiten, Klausuren, Fachartikeln oder organisatorischen Sachen. Ich kämpfe mit Einkaufen, ausreichender Ernährung, sensorischer Überlastung, Straßenverkehr, Kommunikation – und einer Welt, die denkt, dass Flügel automatisch Flugfähigkeit bedeuten.
»Du bist doch nicht behindert!« Das ist ein Satz, den ich immer wieder höre, auch wenn ich offiziell als schwerbehindert gelte. Aber das wollen die meisten in meinem Umfeld nicht wahrhaben. Und ich eigentlich auch nicht. Und so fliegt der Pinguin immer wieder auf den Schnabel, hangelt sich von Erschöpfungsdepression zu Erschöpfungsdepression. Von Shutdown zu Shutdown. Aber es wird besser. Ich werde mutiger. Und ich passe besser auf mich auf. Noch vor einem Jahr war es mir peinlich, mit meinen grünen Schallschutzkopfhörern aus dem Baumarkt in Bus oder Bahn zu sitzen, jetzt ist das für mich ganz normal. Ich fange an, mein Leben pinguinfreundlich zu gestalten. Weil ich nicht möchte, dass irgendwann der Tag kommt, an dem der Pinguin nach einem weiteren Flugversuch abstürzt und nicht mehr aufstehen kann.
Das Berufsziel, Bundestagsabgeordneter zu werden, habe ich mittlerweile schweren Herzens aufgegeben, jetzt will ich Lehrer werden. »Du bist Autist und willst dann auch noch Lehrer werden? Wäre nicht irgendwas in der Forschung passender für dich? Irgendwo in irgendeinem einsamen Labor?« So etwas hörte ich während des Studiums ziemlich häufig und interessanterweise ausschließlich von Leuten, die mich noch nie haben unterrichten sehen. Leute nämlich, die mich vor der Klasse erlebt haben, sind meistens ziemlich angetan von meiner unkonventionellen und authentischen Art, Unterricht zu machen.
Ich fühle mich wohl, wenn ich vor der Klasse stehe. Weil es für mich viel einfacher ist, vor Gruppen zu stehen, als in Gruppen zu agieren. Ich will Lehrer werden, weil mir das Unterrichten Spaß macht, weil ich mit Gruppen zu tun haben kann, ohne Teil der Gruppe sein zu müssen. Und weil ich die Hoffnung habe, einigen flugunfähigen Vögeln unter meinen Schülern die Unterstützung geben zu können, die ich damals gebraucht hätte. Trotzdem war ich natürlich vor dem Praxissemester extrem aufgeregt. 13 Wochen Schule, Hospitieren, eigener Unterricht. Würde ich das hinkriegen? Ich hab bereits vor Beginn des Praktikums das Gespräch mit dem Ausbildungsleiter gesucht, weil ich weiß, dass ich im zwischenmenschlichen Bereich nicht immer ganz einfach bin. Ich hab mich also mit ihm getroffen und quasi so eine Art »Bedienungsanleitung« für mich geschrieben, was er beachten sollte, was ich brauche, damit es funktioniert. Ich weiß noch, wie ich total aufgeregt mit ihm im Besprechungszimmer saß und mir das alles total peinlich war. Und ich hatte einfach nur Angst, dass er irgendwas sagen würde wie: »Na, wenn das alles so schwer ist für Sie, dann gehen Sie doch nach Hause!« Aber dieser Satz kam nicht. Stattdessen lächelte er und sagte: »Das wird eine gute Herausforderung für uns alle.«
Vier Monate später saß ich wieder mit ihm im Besprechungszimmer, hatte über hundert Stunden hospitiert und mehr als vierzig Stunden eigenständig unterrichtet. Ich war an meine Grenzen gestoßen, hatte mich vor großen Pausen geflüchtet und den Wandertag geschwänzt. Aber ich hatte auch viele tolle Erlebnisse mit Schülern und Kollegen. Flowmomente, soziale Erfolgserlebnisse und Stunden, in denen der Funke von mir auf die Schüler übersprang. Und was sagte der Ausbildungsleiter: »Ob Sie genug Energie für den Schuldienst haben, können Sie nur selbst entscheiden. Aber Sie wären eine Bereicherung für jede Schule. Gerade, weil Sie nicht so sind wie die meisten anderen.«
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, vierzig Jahre lang im Schuldienst zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, alleine zu wohnen (Familie gründen schaffe ich sich...