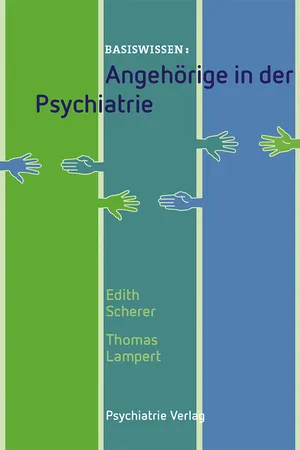
- 152 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Angehörige in der Psychiatrie
Über dieses Buch
Angehörige sind längst im psychiatrischen Alltag angekommen, aber die konkrete Arbeit mit ihnen fordert professionell Tätigen einiges ab: eine klare Haltung, einen konstanten Perspektivwechsel und Sicherheit im kommunikativen Umgang.
Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Angehörigen als Mitverursacher von Störungen sind immer noch groß und verstärken die Unsicherheit im Umgang mit Familienmitgliedern, Partnern oder engen Vertrauten. Gefühlte Defizite und wenige qualitative Standards in diesem Arbeitsbereich sorgen für Unsicherheiten bei der Kommunikation von Bedürfnissen und Absprachen, gerade im Mehrpersonensetting.
Das Buch bietet grundlegende Hilfe: Es formuliert praxisbewährte Leitlinien für den Arbeitsalltag, arbeitet systemische Grundlagen ab und widmet sich in einem Extrakapitel dem Thema »Kinder als Angehörige«.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Angehörige in der Psychiatrie von Edith Scherer,Thomas Lampert im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medicine & Medical Theory, Practice & Reference. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Die Zusammenarbeit mit Angehörigen
»In der Zusammenarbeit zwischen der Psychiatrie und Angehörigen sind drei Strategien beobachtbar: Abgrenzung, Instrumentalisierung und Einbindung« (HOFF 2014).
Abgrenzung
Die Strategie der Abgrenzung betont die »Störung der Therapie« durch Angehörige als Außenstehende. Während ab Ende der Vierzigerjahre bis in die Achtzigerjahre mit dem Konzept der schizophrenogenen Mutter oder später im Suchtbereich mit dem der Koabhängigkeit der leere Flaschen entsorgenden Ehefrau den Angehörigen zumindest indirekt eine Teilschuld an der psychischen Erkrankung angelastet wurde, sind die Stimmen heute verhaltener. Die Belastungen der Familien werden zwar inzwischen durchaus gesehen, dennoch hat jeder schon einmal die Kommentare eines Kollegen hinter vorgehaltener Hand gehört: »Kein Wunder, dass die krank ist – bei den Eltern!« Dieser historische wie auch gesellschaftliche Hintergrund der Stigmatisierung von Angehörigen hält sich hartnäckig bis in die heutige Zeit.
Psychische Erkrankungen werden von Angehörigen selbst oft mit Willensschwäche und einem Versagen der Eltern in ihrer Elternrolle – besonders der Mütter – impliziert. Eine mögliche Folge ist die Verunsicherung und Zurückhaltung der nächsten Bezugspersonen, der Störenfriede, die Mitverantwortung tragen an der Erkrankung des Patienten. Eine restriktive Auslegung des Begriffes der therapeutischen Beziehung untermauert dieses Erleben zusätzlich, überstrapaziert den Begriff der Patientenautonomie und betont letztlich einen falschen Machtanspruch des Therapeuten, dass ein Patient »sein« Patient sei.
Mit der Ausgrenzung der Angehörigen wird die Bedeutung der sozialen Ebene deutlich unterbewertet, gar missachtet. Therapierelevantes Potenzial liegt brach, negative Auswirkungen auf die familiären Beziehungen nach einem Austritt aus der stationären Behandlung sind wahrscheinlich, da Konflikte, Erwartungen, Bedürfnisse, Grenzen nicht kommuniziert wurden und einzelnen Familienmitgliedern tendenziell lediglich monadische Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen.
Instrumentalisierung
»Die Strategie der Instrumentalisierung wiederum ernennt Angehörige zu Kotherapeuten. Die unkritische Überdehnung des Therapiebegriffs und des zugrundeliegenden therapeutischen Prinzips erklärt alles zur Therapie« (HOFF 2014). Vieles wirkt therapeutisch, jedoch nicht alles ist »Therapie«. So besteht ein Unterschied, ob dem Ehemann einer Patientin aufgetragen wird, Grenzen zu setzen, weil es für die Patientin wichtig ist, oder der Ehemann darin bestärkt wird, eigene Grenzen und Bedürfnisse besser zu erkennen und diese dann auch mitzuteilen, weil die Bindung zwischen den beiden Partnern dieses Veränderungspotenzial zulässt und unterstützt. Angehörige zu Kotherapeuten zu ernennen stellt wiederum einen überhöhten Machtanspruch des Therapeuten dar, als seien Angehörige seine Mitarbeiter. Diese Pseudodelegation von Verantwortung führt zu negativen Auswirkungen auf familiäre Beziehungen nach dem Klinikaufenthalt, wenn die Macht des therapeutischen Kontexts außer Kraft ist.
Einbindung
Die Einbindung von Angehörigen in die Behandlung ist ein gezielter Einsatz eines wichtigen therapeutischen Prinzips, des Einbezugs der sozialen Ebene. Dieser Schritt bezeugt den Respekt für die Bedürfnisse und Belastungen von Angehörigen. Die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten entlasten das gesamte System und haben letztlich positive Auswirkungen auf die Interaktion und familiären Beziehungen nach einer Behandlung oder Psychotherapie.
MERKE→ Die aktive Einbindung der Angehörigen in den Behandlungsprozess entlastet meistens alle Beteiligten, immer vorausgesetzt, der Erkrankte möchte dies und stimmt der Schweigepflichtentbindung zu.
Aktiver Einbezug der Angehörigen
Jede Anstrengung, Angehörige respektvoll in die Hilfe einzubeziehen, ist begrüßenswert. Mit dem Einbezug von Angehörigen kann eine psychiatrische Behandlung als eine Dienstleistung am »System« verstanden werden. Während in einer Therapie unter Ausschluss des Umfelds Informationen zum Problemverständnis nur aus der einen Sicht zur Verfügung stehen, ergründet dessen Einbezug eine reiche Quelle an Information, Problem- und Lösungsverständnis. Der aktive Einbezug der Angehörigen kann einerseits als Wertschätzung der Bereitschaft zur Zusammenarbeit verstanden werden, andererseits betont er die Kundenorientierung mit der Berücksichtigung der Wünsche von Patient und Umfeld.
Die Leipziger Angehörigenstudie (JUNGBAUER u. a. 2001) befasst sich mit der Frage, was Angehörige von Menschen mit einer psychischen Erkrankung brauchen. Nebst den Bedürfnissen nach Aufklärung, Information und längerfristigen Kooperationen wünschen sich Angehörige eine aktive, verständnisvoll, freundliche Kontaktaufnahme seitens der Fachleute.
Der aktive Einbezug signifikanter Bezugspersonen in den Behandlungsprozess ist indes nicht lediglich abhängig von der schulenspezifischen Ausrichtung einer Institution oder des einzelnen Therapeuten. Oft ist es eine Frage der Aufmerksamkeit, des Bewusstseins und der Ressourcen, ob weitere Personen einbezogen werden. Gerade im akutpsychiatrischen Stationsalltag verhindern Hektik, knappe zeitliche Ressourcen und eine Fülle von Problemen sowie verschiedene Schauplätze in der Arbeit mit dem Patienten den Gedanken an einen aktiven Einbezug. Angehörige bleiben außen vor.
Diesem Umstand ist eine psychiatrische Klinik in der Schweiz in Sankt Gallen entgegengetreten und hat einen Angehörigenbrief in den Prozessablauf des Aufnahmeprozederes integriert. So werden Patientinnen und Patienten in den ersten fünf Tagen systematisch über den Versand eines Angehörigenbriefes informiert, der nach Entbindung der Schweigepflicht durch ein internes Sekretariat versandt wird. In dieser schriftlichen Entbindung geben die Patienten Name und Adresse derjenigen Personen an, die den Brief erhalten sollen, vor allem wird die Ablehnung des Versands dokumentiert.
Einladung
Im Brief, der vom Chefarzt der Klinik unterzeichnet ist, wird auf die Wichtigkeit des Einbezugs und der Abhängigkeit dieses Schrittes vom Einverständnis des Patienten hingewiesen, insbesondere ob der Einbezug frühzeitig oder erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Weiter sind im Brief die Namen des Einzeltherapeuten sowie der zuständigen Pflegefachperson vermerkt und die Direktnummer der Behandlungsstation, und zwar verbunden mit der Einladung, sich bei Fragen zu melden. Vonseiten der Patienten ist die Akzeptanz des Versands eines solchen standardisierten Briefes an die eigenen Angehörigen hoch. 57 Prozent der befragten Patientinnen und Patienten stimmten dem Versand zu, nur 27 Prozent lehnten die Kontaktaufnahme zu Angehörigen grundsätzlich ab (LAMPERT 2016). Anfängliche Befürchtungen der Stationsteams, mit Telefonanrufen überhäuft zu werden, zeigten sich in der Praxis als unbegründet – eine Häufung von Anrufen ist nicht feststellbar.
Dieses »Einladungsschreiben« betont die Wichtigkeit des Einbezugs von Angehörigen in die Behandlung, das Interesse am Erleben aller Beteiligten und dient gleichermaßen der Senkung von Hemmschwellen, sich beim Behandlungsteam zu melden.
»Schwierige« Angehörige
In unserer modernen westlichen Gesellschaft wird Autonomie als hohes Gut betont. Menschen wird zugestanden, das eigene Leben selbstbestimmt, selbstständig und unabhängig zu führen. Auch in der psychiatrischen Versorgung wird die Autonomie des Patienten als oberstes Prinzip geachtet, und zwar nicht nur, wenn Urteilsfähigkeit besteht. Dies bedeutet, dass psychisch erkrankte Personen keine globale Inkompetenz attestiert wird, sondern immer auch Ressourcen vorausgesetzt werden. Sogar das bloße Ablehnen medizinischer Maßnahmen muss nicht automatisch Irrationalität oder Urteilsunfähigkeit bedeuten, denn das individuelle Wohl besteht nicht aus medizinischer Normalität. »Gesundheit« ist entsprechend nicht für jedes Individuum der einzige und höchste Wert des menschlichen Lebens.
Die Sorge um einen wichtigen Menschen, Unverständnis, Ungeduld, die Betonung eigener Erfahrungen im Sinne einer induktiven Betrachtung von Veränderungsprozessen, Patentlösungen … ja, mannigfaltig sind die Gründe, weshalb Angehörige – mehr oder weniger vehement – alternative Behandlungsmaßnahmen und -ziele ins Feld führen.
Die beschriebene ethische Grundhaltung bezeichnet die Basis für die Gestaltung therapeutischer Prozesse mit entsprechenden Zielen und Maßnahmen. Die Mitteilung dieser grundlegenden Prämissen und den daraus entstehenden Spannungsfeldern ist Voraussetzung für ein Verständnis der geplanten Hilfeprozesse. »Nun ist mein Sohn bereits seit zwei Monaten in der Klinik und es scheint ihm immer schlechter zu gehen! Es geht einfach nicht vorwärts. Keine Therapien, keine Planung. Und immer sollen wir Geduld haben.«
Ungehörige Angehörige?
Nur weil sich Angehörige beschweren, sind sie noch nicht »ungehörig«, schwierig oder querulantisch. Oft fehlt es Angehörigen an Wissen und Verständnis zu Krankheitsbildern oder psychiatrischer Versorgung. Die Vermittlung von Informationen, Regeln, Hintergründen und Modellen kann diesem Umstand entgegentreten. Auch können belastende Phasen der Bewältigung, beispielsweise die fehlende Akzeptanz der Erkrankung eines wichtigen nahestehenden Menschen, die Dünnhäutigkeit Angehöriger und somit die Gefahr einer emotionalen Überreaktion verstärken. In diesem Zusammenhang steht oft auch die Frage: »Mad or bad?« »Wenn er nur wollte, dann könnte er am Morgen auch aufstehen! Er hat es gestern doch versprochen.« Auswirkungen der Krankheit werden als solche nicht erkannt und führen zu Konflikten. Zugegeben, diese Fragestellung ist letztlich nicht schlüssig zu beantworten, doch kann die Einführung der Fragestellung des Nichtkönnens versus des Nichtwollens als grundsätzliche Haltung – unter Berücksichtigung der Krankheitssymptomatik – die Problemstellung entschärfen.
In der Koexistenz von Psychiatrie und Angehörigen bestehen typische Spannungsfelder (HOFF 2014). Ein Mangel an Information über die Krankheit, die Therapie und den Gesundheitszustand des Patienten, auch infolge des Problems der Verschwiegenheitspflicht, bes...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Die Autoren
- Impressum
- Inhalt
- Einleitung
- Angehörige und der gesellschaftliche Kontext
- Belastungen von Angehörigen
- Die Zusammenarbeit mit Angehörigen
- Kinder als Angehörige
- Angehörigenarbeit außerhalb der Behandlung
- Eine psychiatrische Arbeit für alle – Schlussbemerkung
- Internetadressen
- Ausgewählte Literatur