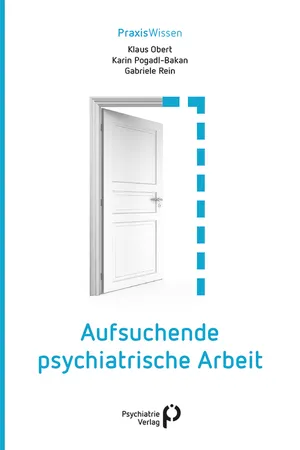
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Aufsuchende psychiatrische Arbeit
Über dieses Buch
Die aufsuchende psychiatrische Arbeit bietet niederschwellige und flexible Hilfe, sie ist aber immer auch ein Eingriff in die Privatsphäre von Klientinnen und Klienten. Entsprechend sensibel sollte das professionelle Vorgehen ausfallen.
Kompakt und strukturiert beschreibt dieses Buch Rollen, Aufgaben und Herausforderungen der aufsuchenden psychiatrischen Arbeit. Die Anlässe für einen Hausbesuch werden dargestellt, ebenso werden Tipps für den Umgang mit angespannten oder aggressiven Situationen und für die Selbstsorge gegeben.
Das Sich-Einlassen auf die Häuslichkeit der Menschen ist einerseits mit Unsicherheiten und Unvorhersehbarem verbunden, weckt andererseits aber auch Neugierde und Zufriedenheit in der Arbeit. Menschen werden nämlich dort unterstützt, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben. Das Helfen geschieht also da, wo es sich unmittelbarer und direkter auf die Förderung von Lebensqualität auswirkt!
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Aufsuchende psychiatrische Arbeit von Karin Pogadl-Bakan,Gabriele Rein,Klaus Obert im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Médecine & Théorie, pratique et référence de la médecine. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Die Durchführung
des Hausbesuchs
Anfragesituationen und Kontaktaufnahme
Hilfeanfragen an die jeweiligen »Bausteine« der Sozialpsychiatrie erfolgen vor allem, wenn es sich um Erstanfragen handelt. Das betrifft allen voran die Sozialpsychiatrischen und Gerontopsychiatrischen Dienste. Diese beiden Dienste übernehmen mit ihren Funktionen und Aufgaben in der Regel die regionale Basisversorgung für (chronisch) psychisch kranke Menschen. Die Anfragen sind vielfältig und vielschichtig. Sie erfolgen aus dem Netz der psychiatrischen Hilfen (Kliniken, Nervenärzte, Institutsambulanzen), der nicht psychiatrischen Hilfen (Allgemeinärzte, niedergelassene Psychotherapeuten, Allgemeiner Sozialdienst, Wohnungslosenhilfe, Job-Center, Sozialamt, Beratungsstelle etc.) der Kirchengemeinden, aber auch direkt aus dem Sozialraum der Betroffenen (Angehörige, Nachbarn, Freunde, Bekannte).
Die große Mehrheit der Anfragen geschieht telefonisch, deutlich seltener schriftlich oder durch direkte Kontaktaufnahme in den Beratungsstellen. Bei der Annahme einer Anfrage geht es um das Erfassen, das Verstehen und das Aufspüren dessen, was der Fall ist. Diese Tätigkeit erfordert eine umfassende Kompetenz sowohl hinsichtlich des Wissens um das Versorgungsnetz als auch hinsichtlich der Anforderung an Vermittlungs- und Methodenkompetenz (Telefondienst und Hintergrunddienst).
Hier interessiert uns in erster Linie die Entscheidung, warum ein Hausbesuch mit seiner Vorbereitung, Planung und Durchführung notwendig ist und welche Schritte genau zu erfolgen haben. > Anlässe, Seiten 26 ff.
Spontanes Handeln oder geplante Termine?
Sofortiges Eingreifen
Selbstverständlich kann ein sofortiges, rasches Handeln auch in den Räumen der Beratungsstelle selbst erfolgen, zum Beispiel wenn die Polizei mit einem wohnungslosen psychisch kranken Menschen »vorbeikommt«, eine Mutter mit ihrem Sohn ohne Ankündigung »hereinschneit« oder ein psychisch Kranker auf Druck seines Hausarztes den Kontakt unmittelbar herstellt und Ähnliches.
In der Mehrzahl der Situationen, in denen sofortiges Eingreifen angezeigt ist, handelt es sich jedoch um Hausbesuche. Entweder sprechen alle Hinweise und Anzeichen eindeutig für die Entscheidung zu einem Hausbesuch oder die Informationen und Hinweise sind so diffus, dass aus einer Situation der Unklarheit und Unsicherheit heraus ebenso umgehendes Handeln vor Ort angezeigt ist. Dabei stellt es hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit und Plausibilität keinen Unterschied dar, ob die Anfrage vom Amt für öffentliche Ordnung, der Polizei, dem niedergelassenen Nervenarzt, von den Nachbarn oder den Angehörigen an die ambulante Arbeit herangetragen wird.
BEISPIEL
Die Frau von Herrn Beck ruft nach Empfehlung ihres Pfarrers aufgeregt und hoch emotionalisiert im Sozialpsychiatrischen Dienst an. Sie berichtet, dass ihr Mann zu Hause angetrieben, angespannt und alkoholisiert aufgetaucht sei. Er spreche von irgendwelchen Anrufen in Rom und in seinem Heimatland, die er zu erledigen habe. Er sei dazu auserkoren, den Widerstand im Heimatland zu organisieren. Als er erneut wieder das Haus habe verlassen wollen, habe sie ihn aufzuhalten und mit ihm zu reden versucht. Sehr abrupt und vehement habe er sie vor den Augen der beiden Kinder zur Seite gestoßen und Drohungen bezüglich einer Bekannten geäußert, die er jetzt besuchen wolle. Frau Beck habe Angst vor ihm, auch wegen der Kinder. Ihre Bekannte habe sie schon informiert, damit diese die Wohnung verlassen könne.
Nach kurzer Rücksprache mit einer Kollegin des Sozialpsychiatrischen Dienstes entscheiden sich die Mitarbeiter dazu (auch aufgrund gewalttätiger Übergriffe in jüngerer Vergangenheit, von denen Frau Beck berichtete), sofort mit der Polizei Herrn Beck zu suchen. Es bestehe nach den vorliegenden Erfahrungen eine akute und nicht ungefährliche Situation, lautet die Begründung. Mit der Polizei fahren zwei Mitarbeiter zur Wohnung. Auf der Straße vor dem Haus treffen sie Herrn Beck bereits an. Er ist ihnen nicht unbekannt, weil ihn ein Mitarbeiter schon einmal in der Klinik gesehen hat, allerdings lehnte er den Kontakt in der Klinik vehement ab. Durch gutes und geduldiges Zureden lässt er sich nach kurzer Rücksprache mit der Institutsambulanz schließlich von der Polizei und den Mitarbeitern freiwillig in die psychiatrische Klinik bringen. Er ist sichtlich erschöpft und weinerlich und meint, dass er nun nichts mehr für sein Land tun könne.
Bei regelmäßigen Besuchen in der Klinik entsteht Schritt für Schritt über das Zuhören und die Klärung der im Vordergrund stehenden Probleme eine Vertrauensbeziehung zu ihm wie auch zu seiner Frau.
Hier wird deutlich, wie in einer akuten und heiklen Situation, in der fremdgefährdendes Verhalten droht beziehungsweise auch schon stattgefunden hat, sofort gehandelt werden muss. Die vorliegenden Informationen, die eindeutig auf eine manifeste Gefährdung des Wohles Dritter hinweisen, erfordern die Hinzuziehung der Polizei. Das Beispiel belegt jedoch auch die immer wieder zu machende Erfahrung, dass trotz einer zwangsweisen Unterbringung, die durch die sozialpsychiatrischen Hilfen eingeleitet und auch begleitet wird, der Kontakt aufrechterhalten werden kann. Dies gelingt, wenn nach Abklingen der akuten Symptomatik der Prozess und die Ereignisse, die zur Unterbringung führten, mit Empathie und Transparenz nachbesprochen und bearbeitet werden.
BEISPIEL
Der Vater von Herrn Kaufmann meldet sich telefonisch ebenso angespannt wie besorgt beim Sozialpsychiatrischen Dienst. Sein Sohn, Mitte dreißig, sei vor rund drei Monaten in einer psychiatrischen Klinik weit entfernt untergebracht gewesen, nachdem er im Zustand einer akuten paranoiden Psychose gegenüber einer anderen Person tätlich geworden war. Nach etwa sechs Wochen sei er in die örtliche psychiatrische Klinik verlegt worden. Nach der Entlassung habe Herr Kaufmann mit der Unterstützung des Vaters eine Wohnung gefunden und bezogen. Nach und nach sei er erneut akut paranoid geworden, fühle sich vom Geheimdienst verfolgt und sei davon überzeugt, dass der Vermieter seiner Wohnung, der unter ihm wohne, und ein weiterer Mieter im Hause die Aktivitäten der Verfolger unterstützen würden. Deswegen war es auch schon zu lautstarken und fast tätlichen Auseinandersetzungen gekommen. Der Vermieter hätten ihm (dem Vater) telefonisch mitgeteilt, dass sie wegen dieser Vorfälle und des Rückstandes zweier Monatsmieten eine Kündigung mit Räumungsklage in die Wege leiten würden. Sämtliche Versuche, mit seinem Sohn vernünftig zu reden, seien gescheitert. Er wisse nicht mehr weiter und bitte um Unterstützung und Hilfe.
Die Schilderung der Situation lässt ohne Zweifel auf eine akute Erkrankung schließen. Nach den Angaben des Vaters sind Selbst- und Fremdgefährdung nicht mehr auszuschließen. Die Mitarbeiterin versichert ihm, dass sie sich umgehend wegen der drohenden Räumungsklage und der Verschlechterung des Gesundheitszustandes mit seinem Sohn in Verbindung setzen würde. Der Vater ist damit einverstanden, dass sie sich bei der Kontaktaufnahme auf ihn beziehen könne. Er bedankt sich für die schnelle Unterstützung.
Die Mitarbeiterin entschließt sich, parallel zu Herrn Kaufmann – nach Abwägung des persönlichen Datenschutzes und dem Schutz des Allgemeinwohls – auch mit dem Vermieter Kontakt aufzunehmen, um mehr über die aktuelle Situation zu erfahren und ein umfassenderes Bild als Grundlage für eine situationsangemessene Entscheidung herzustellen.
Der Vermieter bestätigt die Informationen des Vaters und ist fürs Erste einmal beruhigt, dass der Dienst mit einbezogen wurde. Er würde sich melden, sollte erneut irgendetwas vorfallen. Gleichzeitig entschließt sich die Mitarbeiterin nach reiflicher Überlegung, prophylaktisch mit dem Amt für öffentliche Ordnung Kontakt aufzunehmen. Sie vereinbart mit dem Amt, Herrn Kaufmann gemeinsam einen Besuch abzustatten, falls er keinen Kontakt zulasse. Da zu Herrn Kaufmann einige besorgniserregende Polizeiberichte vorliegen, ist das Amt für öffentliche Ordnung sehr alarmiert und hält den Kontaktaufbau für dringend erforderlich.
Nach der schriftlichen Ankündigung öffnet Herr Kaufmann zur Überraschung der Besucher die Wohnungstür und bittet sie hinein. Ein Gespräch über die psychische Erkrankung ist allerdings überhaupt nicht möglich. Herr Kaufmann hat zwar ein großes Bedürfnis, seine »Geschichte« loszuwerden, das Hinterfragen seiner Fantasien und Wahnideen ist in den ersten Gesprächen jedoch nicht einmal ansatzweise möglich und würde sofort wieder zur Beendigung des Kontakts führen. Selbst nach geraumer Zeit gestaltet sich das Gespräch zu diesem Thema immer noch äußerst schwierig. Der Versuch, ihm nahezulegen, dass Medikamente helfen könnten, sich weniger belastet und gequält zu fühlen, die vorsichtig vorgebrachte Ansicht, dass seine Ideen eventuell in Verbindung mit seinem Innenleben zu sehen seien, führt zum abrupten Abblocken des Gesprächs. Er wisse sicher, dass er nicht psychisch krank sei.
Nur die drohende Räumungsklage und die noch bestehenden Schulden bei früheren Bekannten ermöglichen zu Beginn den Zugang zu Herrn Kaufmann und schließlich einen sukzessiven, tragfähig werdenden Kontakt. Auch in den späteren Phasen bleibt Herr Kaufmann ausschließlich über Hausbesuche erreichbar.
Zwar liegt auch in diesem Fall potenziell fremdgefährdendes Verhalten vor und das Risiko krankheitsbedingter tätlicher Übergriffe kann nicht ausgeschlossen werden, jedoch ist im Unterschied zum vorhergehenden Beispiel ein sofortiges Handeln nicht unbedingt angezeigt. Nach Informationen der Umgebung besteht keine unmittelbare Bedrohung. Allerdings erfordern Gefühl und Wahrnehmung in Verbindung mit der gemeinsamen Reflexion im Team eine doch zügige Abklärung mit dem Amt für öffentliche Ordnung.
BEISPIEL
Der Hausarzt von Herrn Stark ruft in großer Sorge in der Beratungsstelle an, weil er einen Hausbesuch machen wollte und Herr Stark ihm nicht geöffnet habe, was äußert ungewöhnlich sei. Er fragt den Mitarbeiter nach seiner Einschätzung, weil er ihn schon seit längerer Zeit kennt. Herr Stark äußert in seinen paranoiden Verkennungen immer mal wieder sehr ernst zu nehmende suizidale Äußerungen. Zudem leidet er an Diabetes.
Da Herr Stark bei vereinbarten Terminen eigentlich immer öffnet, jetzt aber trotz mehrerer Anrufe über den ganzen Tag hinweg nicht ans Telefon geht, entscheidet sich der Mitarbeiter zu einem Hausbesuch. Trotz intensiven Klingelns öffnet Herr Stark nicht, sodass der Mitarbeiter letztlich entscheidet, die Polizei und die Feuerwehr hinzuzurufen, um die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Überrascht, konsterniert und gleichzeitig sehr ärgerlich öffnet Herr Stark die Wohnungstür, als sich die Feuerwehr an der Tür zu schaffen macht, und fragt, was sie denn wolle. Ebenso überrascht, aber doch letztlich froh, dass nichts passiert ist, bittet der Mitarbeiter die Einsatzkräfte, sich wieder zurückzuziehen und ihn mit Herrn Stark allein zu lassen, um die Situation zu erläutern und zu klären. Aufgebracht und ärgerlich schimpft jener, dass es den Mitarbeiter doch nichts angehe, »wenn er verrecke«, doch dieser antwortet, er habe sich ernsthafte Sorgen um ihn gemacht. Diese Äußerung, dass überhaupt jemand um ihn in Sorge sei, überrascht Herrn Stark und stimmt ihn nachdenklich, konziliant und wieder friedlicher.
Unabhängig von der Organisation oder der Person, die sich an das Hilfesystem wendet, kennzeichnen sich alle Situationen, wie sie in den Beispielen dargestellt sind, vorrangig dadurch, dass es sich auf der einen Seite um eine besorgte und überforderte Umgebung handelt, auf der anderen Seite um psychisch erkrankte Menschen, denen es schwerfällt, Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Gleichzeitig handelt es sich gerade zu Beginn um eine bedeutsame Phase, die ganz entscheidend dafür ist, ob ein Kontakt und in Folge eine Beziehung entstehen können. Dabei spielt der Hausbesuch eine herausragende Rolle.
Zudem kommt die Dringlichkeit der Situation hinzu, in der umgehendes Handeln erforderlich ist und die wichtige und wesentliche Abklärung, ob eine akute Selbst- und / oder Fremdgefährdung vorliegt. Dies kann oftmals nur durch einen Hausbesuch geklärt werden.
Sorgfältig vorbereitetes Handeln nach Terminvereinbarung
Deutlich entspannter und gelassener sind jene Situationen, in denen kein akuter Handlungsbedarf besteht, allerdings bedeutet das nicht gleichzeitig, dass die betreffenden Personen (direkt Betroffene oder soziale Umgebung) nicht unter der Situation leiden wü...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Die Autoren
- Impressum
- Inhalt
- Mit Zuversicht und kritischer Selbstreflexion – Einleitung
- Hilfe bringen – Chancen und Risiken des Hausbesuchs
- Anlässe für einen Hausbesuch
- Die Durchführung des Hausbesuchs
- Umgang mit angespannten und aggressiven Situationen
- Die Beendigung des Hausbesuchs
- Die Arbeit mit dem Umfeld
- Selbstsorge
- Die Beendigung der ambulant aufsuchenden Arbeit
- Ausgewählte Literatur