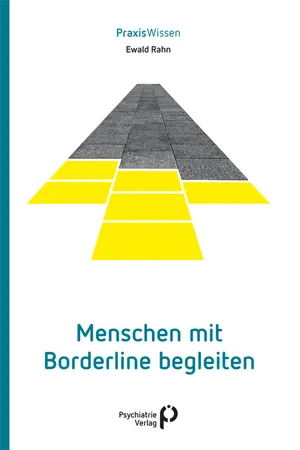
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Menschen mit Borderline begleiten
Über dieses Buch
Bestimmte Verhaltensmuster der Borderline-Persönlichkeitsstörung stellen die Beziehung zwischen Betroffenen und Helfenden immer wieder auf die Probe. Wie eine auch langfristig wirksame Begleitung gelingen kann, zeigt Ewald Rahn praxisnah und begegnungsorientiert.
Ein schneller Wechsel von hohen Nähewünschen zu radikaler Distanz, von Idealisierungen zu tief kränkenden Abwertungen löst auch aufseiten der Helfenden heftige Emotionen aus. Dieses Buch veranschaulicht die Empfindungen und Verhaltensmuster der Betroffenen und vermittelt wichtiges Know-how zur professionellen Beziehungsgestaltung, denn nicht nur die Betroffenen müssen lernen, mit innerlich erlebtem Stress und heftigen Emotionen besser umzugehen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Menschen mit Borderline begleiten von Ewald Rahn im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Medizinische Theorie, Praxis & Referenz. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Der Blick auf die Störung
Störungsaspekt und Beziehungsgestaltung
In der Zusammenarbeit mit Borderlinekranken spielt die gemeinsame Erarbeitung eines abgestimmten Störungskonzepts eine zentrale Rolle. Nur wenn die Abstimmung gelingt und es zu einem gemeinsamen Verständnis der Erkrankung kommt, können Lösungsstrategien erarbeitet werden. Das gemeinsame Erarbeiten ist auch deswegen erforderlich, weil die Überwindung der Störung selbstverständlich von den Betroffenen selber geleistet werden muss. Eine misslingende Zusammenarbeit kann darüber hinaus sogar Schaden anrichten.
In der Vergangenheit war aber ein gemeinsames Krankheitsverständnis nur schwer zu erreichen, zu sehr fielen die subjektive Erfahrung der Betroffenen und die theoretischen Vorstellungen über die Erkrankung auseinander. Die tradierten therapeutischen Strategien bei dieser Erkrankung fruchteten nicht, sodass sich das Krankheitsverständnis aus professioneller Sicht im Laufe der Zeit mehrfach entscheidend wandelte. Heute fällt es vielen Professionellen noch immer schwer, sich von diesen Konzepten zu lösen. Viele halten die Borderlinestörung nach wie vor für eine tief verankerte Charakterstörung mit eingeschränkten Veränderungschancen und ausgesprochen negativen Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Auch für die Betroffenen war ein gemeinsames Störungsverständnis innerhalb ihres sozialen Umfeldes zunächst nur schwer zu erreichen, weil die Störung im subjektiven Erleben anders wahrgenommen wird als von der Umgebung. Die innere Sicht auf die Erkrankung ist geprägt von Unsicherheit, Angst, Ratlosigkeit und Selbstzweifeln, aber auch von innerem Weggleiten, von Anspannung, innerer Leere und Gefühlschaos. Die Betroffenen fürchten, den Kontakt zu sich selbst zu verlieren, haben Angst vor dem Alleinsein und sind sehr damit beschäftigt, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Von der Umgebung werden hingegen oft die Selbstverletzungen, die Wut und das ausagierte Gefühlschaos wahrgenommen. Dieser äußere Eindruck von Stärke bildet einen Kontrast zum inneren Gefühl der Schwäche.
Eine gewisse Annäherung im Blick auf die Störung ergab sich aus Beobachtungen zur Stressanfälligkeit von Borderlinekranken. Immerhin konnten die spontanen Verhaltensänderungen und Schwankungen darauf zurückgeführt werden. Besonders anschaulich werden die Auswirkungen der stressbezogenen inneren Anspannungen für das subjektive Erleben im folgenden Text (entnommen aus: Blum u. a. 2009):
BEISPIEL
»Ich habe die Krankheit, die man Borderline-Störung nennt. Ich hasse dieses Etikett. Kurz vor welcher Grenze (engl. »borderline« = Grenze) befinde ich mich? Vor der zum Wahnsinn? Ich würde meine Krankheit eher als Störung der emotionalen Intensität bezeichnen. Das klingt humaner und es umschreibt besser, wie sich diese Krankheit anfühlt. Die Bezeichnung »Borderline« verbreitet dagegen Schrecken und führt zu einer Reihe herablassender Kommentare, die sich hinter dem nervösen Gelächter derjenigen verbergen, bei denen ich Hilfe suche. Sie glauben, ich würde den Ärger nicht wahrnehmen, der sich in ihnen aufbaut. Stattdessen nennen sie mich manipulativ. Ich glaube, sie haben wirklich keine Ahnung, wie sie mit mir umgehen sollen, und das macht sie wütend. Meine Krankheit zwingt sie dazu, sich mit ihren eigenen Ängsten davor, hilflos und unfähig zu sein, auseinanderzusetzen. Lassen Sie mich von meiner Krankheit erzählen, wie genau sie sich anfühlt. Ich ziehe den Begriff Krankheit vor, im Gegensatz zu psychischer Störung oder Ähnlichem. Ich muss mich dann nicht mehr so schämen. […] Wenn ich es so betrachte, muss ich mich nicht so fühlen, als wäre ich schuld oder als könnte ich etwas daran ändern, wenn ich nur wollte. Es eine Krankheit zu nennen erlaubt mir, mich gleichwertig zu anderen Menschen zu fühlen, nur muss ich mit den Symptomen meiner Krankheit umgehen, wie andere das auch tun. Ich glaube, ein Teil meines Gehirns ist kaputt. Es ist der Teil, der meine Emotionen reguliert.
Es ist wie eine Schleuse eines Dammes, der eine tobende Strömung zurückhält. Eine Schleuse kann in mehreren Abstufungen geöffnet sein. Entweder ganz, halb, ein Viertel und in vielen, vielen Positionen dazwischen. Abhängig davon, wie weit die Schleuse geöffnet ist, strömt das Wasser heraus, es kann regelrecht herausbrechen, oder aber es tröpfelt heraus, usw. Nun, meine emotionale Schleuse ist eben kaputt. Meine Schleuse kennt nur zwei Positionen: vollkommen offen oder vollkommen geschlossen. Meine Emotionen strömen entweder ungehemmt heraus oder stauen sich gefährlich an. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Wenn meine Emotionen herausprusten, scheine ich alles um mich herum zu zerstören. Ich sage wirklich schlimme Dinge zu den Menschen, auch zu jenen, die mir am meisten bedeuten. Ich schreie, ich tobe und finde kein Ende. Es ist schrecklich für die, die meine Emotionen treffen. Es ist allerdings noch schlimmer für mich, denn ich werde nicht blind gegenüber dem Schmerz, den ich durch mein Verhalten verursache, und trotzdem kann ich nicht aufhören. Ich kann nur zusehen, wie all das bösartige Schwarz aus meinem Inneren um sich greift und alles, was davon berührt wird, vernichtet. Ich kann keine Freundschaften aufrechterhalten, meine Familie will nichts mehr mit mir zu tun haben und ich kann keine Stelle lange behalten. Schlimmer noch, ich hasse mich selbst in einem derartigen Maße, dass ich vollkommen hoffnungslos und depressiv geworden bin.
Zu anderen Zeiten, wenn die Schleuse geschlossen ist, ist es auch nicht besser. Der reißende Strom will stets herausbrechen. Die Intensität, mit der er gegen die Schleuse drückt, nimmt von Mal zu Mal zu. Aber die Schleuse will sich nicht öffnen und ich habe keinen Schlüssel. Der Fluss tobt, prügelt und schreit im Inneren. Ich muss ihn herauslassen, aber ich weiß nicht wie. Ich gerate in Panik. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche Hilfe. Ich rufe nach jemandem, der mir helfen soll. Bis dahin schlägt der Fluss schon so laut an die Schleuse, dass ich weder meine eigenen Gedanken hören kann, noch was andere zu mir sagen. Es dröhnt einfach in meinen Ohren, es zirkuliert durch meine Adern, es durchbohrt mein Herz. Es möchte raus. Ich muss es rauslassen. Ich sehe ein Messer oder Streichhölzer. Ich weiß, wenn ich mir ein kleines Loch oder einen Schnitt zufüge, kann der Fluss entkommen. Ich rufe ein letztes Mal um Hilfe. Es hat keinen Sinn. Ich muss schneiden. Nach einigen Minuten ist es vorbei. Der Fluss liegt wieder ruhig da.
Die stillen Zeiten des Flusses sind die angenehmsten und manchmal auch die grausamsten. Wenn es still ist, fange ich an, ein Leben aufzubauen. Ich schließe Freundschaften, bekomme einen Job, rede mit meiner Familie. Die Dinge scheinen sich wieder zu bessern und die Leute beginnen, mir zu vertrauen. Oder sie denken vielleicht, dass ich tue, was ich tun sollte. Vielleicht auch, dass ich mich nun anständig benehmen möchte. Manche kommen zu einer verheerenden Annahme bezüglich meiner Krankheit. Sie glauben, ich könnte sie kontrollieren. Ich habe Neuigkeiten für diese Leute. Der Fluss hat seinen eigenen Willen. Es ist, als wäre ich von einem Dämon besessen, den ich weder bekämpfen noch ignorieren kann. Ich muss lernen, damit zu leben.«
Die Stressanfälligkeit und die daraus entstehenden Stressreaktionen sind Grund für viele Auffälligkeiten, die der Borderlinestörung zugeschrieben werden. Das gilt für einfache Stressreaktionen, etwa die Selbstverletzung und noch viel mehr für komplexere Reaktionen und Verhaltensprogramme. Letztere prägen oft den Erstkontakt mit Borderlinekranken. Mit dem Stress verbundene Phänomene werden deswegen auch von vielen als die Kennzeichen der Störung betrachtet. Immerhin erklären die Stresssymptome eine in der Begegnung bedeutsame Erfahrung, nämlich die der großen Instabilität und Unberechenbarkeit. Sie sind die Auslöser für die starken Kompetenzschwankungen bei den Betroffenen.
Die Stressreaktionen sind allerdings eine Folge der Stressanfälligkeit, sie sind zudem gelernt und eben nicht störungsspezifisch. Für ein gemeinsames Störungsverständnis greifen sie zu kurz, zumal die Frage unbeantwortet bleibt, was die Stressanfälligkeit überhaupt begründet. Das entspricht auch den subjektiven Erfahrungen, die von den Betroffenen selbst geäußert werden. Sicher ist, dass die Erkrankung vor allem das innere Erleben prägt und dabei vor allem die wirksamen Gefühle, die in Ausmaß und Intensität als besonders erlebt werden. Davon wird im subjektiven Erleben das Selbstbild geprägt, aber auch die zwischenmenschlichen Beziehungen werden beeinflusst. Hier treffen sich die subjektiven Wahrnehmungen der Betroffenen und die Beobachtungen der Helfer, sodass eine gemeinsame Sichtweise auf diesen drei Säulen ruht:
- Bei der Borderlinestörung kommt es zu starken und intensiv wahrgenommenen Emotionen,
- in der Folge kommt es episodisch zu starken inneren Spannungen und einem hohen Stressniveau mit ausgeprägter Instabilität des Verhaltens, was zur Entstehung verschiedenster Symptome beiträgt,
- die Erkrankung prägt sowohl das Selbstbild als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Das theoretische Modell der Borderlinestörung
Die Borderlinestörung ist keine Erscheinung der Neuzeit. Es gibt aus dem 18. Jahrhundert Fallberichte, die allerdings unter dem Oberbegriff Hysterie zugeordnet waren. Der Begriff »Borderline« stammt allerdings aus dem 20. Jahrhundert und war zunächst für Varianten der Schizophrenie vorgesehen. Es handelte sich dabei aber um einen rein technischen Begriff, der keine Rückschlüsse über die damit gemeinte Störung erlaubte. Tatsächlich gibt es keine Verwandtschaft zwischen der Borderlinestörung und psychotischen Störungen. Auch hat sie nichts mit »Grenzverhalten« zu tun. > Grenzen, Seiten 94 ff., 118
Mittlerweile wird die Erkrankung den Persönlichkeitsstörungen zugeordnet. Hier gehört sie zu den sogenannten Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen werden heute als Funktionsstörungen (auch Fertigkeitsstörungen) verstanden und keineswegs als Merkmal abweichender Charaktereigenschaften. Weil wir im Alltag im Umgang mit »dem Anderen« und auch uns selbst zu einer ganzheitlichen Sicht neigen, kann der Begriff Persönlichkeitsstörung daher als Störung der Person als Ganzes missverstanden werden. Tatsächlich wird in zwischenmenschlichen Beziehungen grundsätzlich davon ausgegangen, dass bestimmte Eigenheiten relativ stabil sind. Eine solche Reduktion einer Person auf bestimmte Eigenschaften hat im Alltag Vorteile, weil so das Verhalten als berechenbar angenommen und damit in sozialen Beziehungen Sicherheit geschaffen wird. Diese Vorstellung hat auch Auswirkungen auf das Selbstbild, weil Menschen von der Zuverlässigkeit eigener Eigenschaften sehr profitieren. Dieses pragmatische Vorgehen bewährt sich bei spontanen Reaktionen im Alltag, ist aber als Erklärung einer Krankheit untauglich, weil es eine differenzierte Betrachtung der Probleme nicht fördert, sondern geradezu verhindert. Viele Helfer erliegen im Umgang mit Borderlinekranken den Gefahren dieser Perspektive. Es wird wie selbstverständlich von den Borderlinern gesprochen, die auf Spaltung aus sind, Therapeuten verschleißen und ständig Grenzen überschreiten.
ABBILDUNG 1
Dimensionales Persönlichkeitsmodell
| Fünf-Faktoren-Persönlichkeitsmodell (Costa & McCrae) |
| Extraversion |
| Neurotizismus |
| Verträglichkeit |
| Gewissenhaftigkeit |
| Offenheit für neue Erfahrungen |
Wie irreführend ein solcher Ansatz ist, lässt sich auch mithilfe des in der Psychologie entwickelten mehrdimensionalen Persönlichkeitsmodells zeigen. Dieses Modell orientiert sich an fünf Eigenschaftsebenen (siehe Abbildung 1). Die Ausprägung der Eigenschaften auf diesen Ebenen lässt sich relativ zuverlässig ermitteln. Bei der Betrachtung aller fünf Ebenen entsteht dadurch ein Persönlichkeitsprofil. Auch hier wird der Mensch nicht vollständig abgebildet, die Einordnung ist aber zuverlässiger als in einem ganzheitlichen Modell. Wird dieses Modell bei Borderlinekranken angelegt, so stellt sich heraus, dass sie in ihren Profilen eine ähnlich hohe Variabilität aufweisen wie andere Menschen auch. Sie haben also gar kein übereinstimmendes Persönlichkeitsprofil.
Ebenso können die Phänomene im Rahmen von Stress nicht als Maßstab herangezogen werden, weil sich unter Stress (Bedrohung) menschliches Verhalten immer auf wenige Reaktionsmuster (Kampf, Fluchtkampf und Todstellen) reduziert.
Will man das Phänomen »Persönlichkeitsstörung« also verstehen, ist es hilfreich, die Bedeutung von Potenzialen zu betrachten. Menschen verfügen nämlich berei...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Der Autor
- Impressum
- Inhalt
- Erschreckte Distanz, erstaunte Anziehung – Einleitung
- Spannungsfelder im Verlauf der Beziehungsgestaltung
- Der Blick auf die Störung
- Häufigkeit, Erscheinungsformen und Verlauf der Erkrankung
- Problematische Verhaltensmuster im Rahmen der Borderlinestörung
- Entwicklung einer helfenden Haltung
- Hilfreiche therapeutische Strategien
- Umgang mit den Partnern und der Familie der Betroffenen
- Behandlungs- und Betreuungssettings
- Ausgewählte Literatur