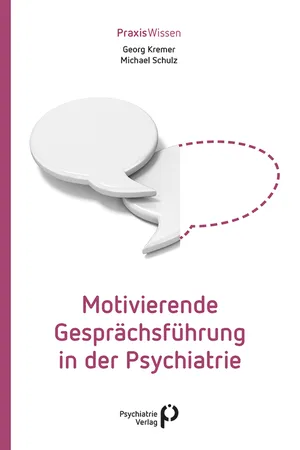
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Motivierende Gesprächsführung in der Psychiatrie
Über dieses Buch
Entschieden gegen die Unentschlossenheit
Es ist eine alltägliche Erfahrung, dass Klientinnen und Klienten therapeutische Maßnahmen nicht oder nur teilweise umsetzen. Wenn zunächst vereinbarte Ziele später nicht eingehalten werden, kann es sein, dass im Vereinbarungsprozess nicht alle relevanten Motive berücksichtigt wurden und nicht erkannte Ambivalenzen im Spiel waren. Ein erfolgreiches Kommunikationskonzept sorgt in diesen Situationen für Klarheit und Entschlossenheit!
Dieses Buch nimmt klassische akutpsychiatrische Situationen in den Fokus. Konkrete Beispiele zeigen: Ob es um das Gestalten von Beziehungen geht, soziale Probleme, das Einhalten von Regeln, die Einnahme von Medikamenten oder auch um Suizidalität – mit den Grundelementen und Strategien der Motivierenden Gesprächsführung lassen sich Widerstände aufgreifen und gemeinsam getragene und erreichbare Ziele finden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Motivierende Gesprächsführung in der Psychiatrie von Georg Kremer,Michael Schulz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Medizinische Theorie, Praxis & Referenz. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Praxis der Motivierenden Gesprächsführung in der Psychiatrie
Luc Ciompi hat einmal in einem Interview gesagt, man müsse die Patienten lieben, um ihnen helfen zu können. Das ist vielleicht etwas viel verlangt, aber wenn wir davon ausgehen, dass Liebe nicht mehr und nicht weniger bedeutet als eine Form affektiver Zuwendung zum anderen, die über eine Mittel-Zweck-Abwägung hinausgeht, wenn wir uns gleichzeitig klarmachen, dass viele unserer Patienten in ihrer Lebensgeschichte an genau diesen Qualitäten menschlichen Miteinanders eklatanten Mangel erlebt haben, so erschließt sich die hohe Bedeutung einer von Respekt getragenen therapeutischen Grundhaltung. Die »liebenswerten« Seiten der Patientinnen und Patienten zu entdecken ist nicht immer leicht und gelingt auch nicht immer auf Anhieb. Ohne diesen wohlwollenden Blick auf das Gegenüber aber, und das wollte Ciompi vermutlich sagen, kann Helfen nicht gelingen. (Nach-)Reifung wird erst auf der Basis einer positiven, erwartungsfreien Wertschätzung möglich.
In diesem Kapitel werden wir einige typische Situationen des psychiatrischen Behandlungsalltags – sei es ambulant, teilstationär oder stationär – beleuchten. Wir haben solche Beispiele ausgewählt, die die Prozesse und Kernkompetenzen Motivierender Gesprächsführung deutlich machen und das Spektrum der potenziellen Interventionen möglichst umfassend abbilden.
Beginnen wollen wir jeweils mit einem Fallbeispiel, dem wir dann einige Hinweise zu idealtypischen Interventionen im Sinne der Motivierenden Gesprächsführung folgen lassen. Dabei werden wir auch auf Herausforderungen und Grenzen Motivierender Gesprächsführung eingehen.
Erstkontakt in der psychiatrischen Institutsambulanz
Herr B., ein 22-jähriger unverheirateter Mann, kommt mit Überweisung der Hausärztin in die psychiatrische Institutsambulanz. Die Mutter, bei der er lebt und die ihn auch zum Erstgespräch begleitet, berichtet, dass er in letzter Zeit seltsam geworden sei. Er spreche viel mit sich allein, sei sehr aggressiv geworden und habe sich mehr und mehr zurückgezogen, weil alle Menschen schlecht über ihn reden würden. Er höre auch nur noch bestimmte Musik, von der für ihn besondere Botschaften ausgingen. Er sei ein Einzelkind, sei noch nie in psychiatrischer Behandlung gewesen, die Trennung der Eltern und den Auszug des Vaters, als er elf Jahre alt war, habe er immer noch kaum verwunden. Schon während der Schulzeit, vor allem aber nach dem Abitur habe er nichts mehr unternommen, habe seine Hobbys aufgegeben und eigentlich nur noch zu Hause »rumgehangen«. Sie glaube, dass er viel Cannabis rauche, vielleicht auch noch andere Drogen nehme. Die diensthabende Ärztin sucht nach den ersten »schwallartigen« Schilderungen der Mutter das Gespräch mit dem Sohn.
REFLEXION UND BESTÄTIGUNG Sie greift die aktuelle Situation auf, spricht mögliche unangenehme Gefühle an und hebt gleichzeitig positiv hervor, dass der Sohn mitgekommen ist: »Herr B., das ist bestimmt keine schöne Situation jetzt, mit der Mutter in die psychiatrische Ambulanz zu kommen. Umso mehr schätze ich es, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Wie geht es Ihnen denn jetzt, nach den Schilderungen Ihrer Mutter?«
OFFENE FRAGEN UND ZUHÖREN Es ist nicht hilfreich, in einer frühen Phase des Erstkontakts typische diagnostische Fragen zu den psychotischen Symptomen oder den Konsumgewohnheiten zu stellen, die den Raum für den Patienten sehr schnell sehr eng machen. Stattdessen empfiehlt es sich, mit einer Reihe offener Fragen zu beginnen: »Wie denken Sie darüber, was Ihre Mutter gerade alles erzählt hat?« oder »Wie sieht denn ein typischer Tag bei Ihnen aus?«. Je nach Antwort können unterschiedliche Interventionen im Sinne des reflektierenden Zuhörens ein Bemühen um Verständnis signalisieren und eine gute Basis der therapeutischen Beziehung schaffen.
BEISPIEL
Variante 1:
HERR B. »Meine Mutter versteht mich nicht.«
ÄRZTIN »Sie hat keine Ahnung, was wirklich in Ihnen vorgeht?« Oder: »Und das ist schade.«
Variante 2:
HERR B. »Ich bin nicht verrückt.«
ÄRZTIN »Sie wehren sich gegen einen solchen Vorwurf.« Oder »Es ist nicht so, dass Sie keine Probleme im Leben sehen, aber mit so einem Stempel wollen Sie nicht versehen werden.«
Reflektierendes Zuhören verfolgt scheinbar keine Richtung, doch wie man an diesen kurzen Beispielen sieht, thematisiert man entweder die intrapsychische oder aber die soziale Dimension des Ganzen inklusive der Behandlungsbeziehung. Dies geschieht immer in einer begleitenden, nicht einer drängenden oder verhörenden Form.
Behandler haben oft die Sorge, dass sie für reflektierendes Zuhören zu wenig Zeit haben und dann nicht die nötigen Informationen bekommen. Das Gegenteil ist der Fall: Gutes reflektierendes Zuhören erzeugt deutlich mehr Bereitschaft zur Exploration aufseiten des Patienten. Die einzige Aufgabe der Behandler besteht darin, die Informationen zu sortieren und zu gewichten.
INFORMATIONEN GEBEN Sowohl Mutter als auch Sohn kennen die psychiatrische Diagnostik und Behandlung nicht, sind nicht vertraut mit der Nomenklatur. Hier ist es in einer frühen Phase des Kontakts wichtig, Informationen über das Diagnose- und Behandlungsspektrum zu geben: »Am Beginn steht die Diagnostik. Ich würde mir deshalb gerne zunächst einmal ein Bild darüber verschaffen, wie Sie, Herr B., über Ihr Leben denken, wie es verlaufen ist, wo es rund läuft, wo nicht, was Ihre Zukunftsideen sind. Dabei hätte ich auch eine Reihe Fragen zu den Punkten, die Ihre Mutter genannt hat. Dieses Gespräch würde ich gerne mit Ihnen allein führen, wir könnten dazu einen Termin in der nächsten Woche vereinbaren. Im Anschluss daran würde ich Ihnen eine Rückmeldung über meine Einschätzung geben und mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen. Gegebenenfalls würde ich Ihnen einige Behandlungsoptionen anbieten, über die wir dann im Detail sprechen. Dann könnte, wenn Sie wollen, auch Ihre Mutter wieder hinzukommen. Wichtig ist mir aber, dass am Ende nur Sie allein entscheiden, was gut für Sie ist und was nicht. Wie hört sich das für Sie an?«
ZUSAMMENFASSEN UND RATGEBEN Es könnte sich nach dem diagnostischen Gespräch aus Sicht der Ärztin als sinnvoll erweisen, dass der junge Mann sich in stationäre oder zumindest teilstationäre Behandlung begibt. Dies teilt ihm die Ärztin mit, in vollem Bewusstsein, dass er letztlich selbst entscheidet: »Herr B., nachdem wir nun länger miteinander gesprochen haben, erscheint es mir sinnvoll, dass Sie sich in Behandlung begeben. Sie sehen zwar nicht alles so dramatisch wie Ihre Mutter, aber Sie leiden selbst unter Ihrer Einsamkeit. Sie denken selbst manchmal, dass etwas mit Ihnen nicht stimme, und Sie haben Sorge, dass Sie sich Ihre Zukunft verbauen, wenn alles so weitergeht. Auch der übermäßige Cannabiskonsum der letzten Zeit bereitet Ihnen Sorgen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? – Aus meiner Sicht sollten Sie sich auf einer unserer Stationen für Menschen mit allgemeinpsychiatrischen Störungen behandeln lassen. ›Behandlung‹ heißt Gespräche, Information, Austausch mit Gleichgesinnten, manchmal auch Medikation, Sport und vieles andere. Die Behandlungsdauer hängt davon ab, wie lange Sie meinen zu profitieren. Wie hört sich das für Sie an?«
MIT AMBIVALENZ UMGEHEN Häufig, gerade im Erstkontakt, äußern sich Patienten solchen Angeboten gegenüber ambivalent. Sie haben Angst vor dem Eingesperrtsein, vor Sedierung, Speichelfluss, Gewalt, Einsamkeit, Stigmatisierung. Der gut gemeinte Rat ist insofern meist erst der Anfang einer gemeinsamen Wegstrecke, an deren Ende eine gemeinsam getragene Entscheidung steht. Oftmals entspringt die von uns ausgesprochene Empfehlung eher dem Maximum des Erreichbaren, die letztendliche Entscheidung gleicht eher einem Kompromiss.
Es ist wichtig, dass wir sensibel sind für Äußerungen der Ambivalenz und diese aufnehmen mit offenen Fragen, die von Interesse am Gegenüber geleitet sind: »Herr B., ich sehe, Sie winken ab. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Erzählen Sie mir bitte von Ihren Bedenken. Was spricht gegen eine stationäre Behandlung?« Dem kann nach ausreichender Würdigung auch die Frage nach der Alternative folgen: »Herr B., Sie haben mir nun einiges genannt, was gegen eine stationäre Behandlung spricht. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch etwas, was dafürspricht? Also, könnte eine stationäre Behandlung auch ihre guten Seiten haben?« Wichtig ist, dem Patienten deutlich zu machen, dass Ambivalenz normal ist und dass manche Entscheidungen etwas Zeit brauchen.
GEMEINSAM ÜBER ZIELE NACHDENKEN Einige Patienten werden zu diesem Zeitpunkt den Kontakt abbrechen. Mit anderen ist es möglich, gewissermaßen in Verhandlungen zu treten. Es gilt, Spielräume und Optionen zu skizzieren, innerhalb derer der Patient eine für sich passende Entscheidung fällen kann.
Eine solche Diskussion muss in vollem Bewusstsein der Ambivalenz geführt werden. Man darf hier nicht zu früh auf Lösungen oder Entscheidungen drängen. Das würde nur Sustain Talk aufseiten des Patienten provozieren. Behandlungsoptionen sollten im Konjunktiv ausgesprochen werden: »Wenn Sie sich zum Beispiel entscheiden würden, nicht auf eine Station, sondern in eine Tagesklinik zu gehen, welchen Nutzen könnte das für Sie haben? Wo könnte auch das schwierig werden? Und wie könnten Sie dem begegnen?«
KLEINE ZIELE VEREINBAREN Meist sind die mit Patienten zu vereinbarenden Ziele kleiner, als man es sich wünscht. Dies nicht als Misserfolg zu deuten, sondern als »ersten Schritt auf einer Reise von tausend Meilen«, um noch einmal das chinesische Sprichwort zu zitieren, erleichtert uns das Arbeiten. In der Psychiatrie geht es oft nicht um so etwas wie »Heilung«, oft nicht um den ganz großen Wurf, sondern um kleine Schritte der Linderung, des etwas gesünderen und etwas zufriedeneren Lebens. So könnte beim hier behandelten Patienten das wohlgestaltete kleine Ziel darin bestehen, dass er sich das alles zu Hause noch einmal überlegt und einen nächsten Termin akzeptiert, vielleicht dann mit der Option, sich die Tagesklinik einmal anzuschauen.
Im ambulanten Erstkontakt geht es darum, nötige Informationen zu geben, den Klienten zu verstehen, und zwar auch mit seinen Ambivalenzen, und dann kleine erste Ziele miteinander zu entwickeln.
Erstkontakt im stationären Rahmen als Folge einer Notaufnahme
Herr K., ein 32-jähriger Mann türkischer Abstammung, wurde in der Nacht von Polizei und Rettungsdienst mit Antrag auf PsychKG in die Psychiatrie gebracht. Er war zuvor in der Stadt auf den Straßenbahnschienen sitzend...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Zu den Autoren
- Impressum
- Inhalt
- Helfende Beziehungen: Was ist Motivierende Gesprächsführung?
- Was kann Motivierende Gesprächsführung leisten?
- Motivierende Gesprächsführung und Selbstbestimmung
- Grundlagen der Motivierenden Gesprächsführung in der Psychiatrie
- Vier Prozesse – fünf Kernkompetenzen
- Geschmeidig und konstruktiv mit Sustain Talk und Dissonanz umgehen
- Praxis der Motivierenden Gesprächsführung in der Psychiatrie
- Zum Schluss: einige Erfahrungen von Mitarbeitern mit der Motivierenden Gesprächsführung
- Ausgewählte Literatur